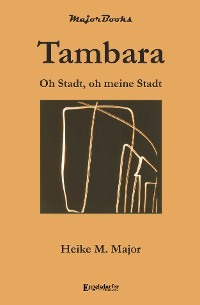Kitabı oku: «Tambara», sayfa 2
3
Sie hatten den Präsidenten der Christie’s Group of Music-Design überreden können, die Aufführung des Jazzkonzerts nicht wie sonst üblich im Musikkonzern, sondern ausnahmsweise im Zentralraum des Mediencenters stattfinden zu lassen. Die in fast allen Firmen im Gebäudemittelpunkt errichteten Zentralräume wurden hauptsächlich für Werbezwecke in eigener Sache genutzt. Hier präsentierte jeder Konzern seine Neuerscheinungen, organisierte Tagungen zu aktuellen Produktentwicklungen oder Ausstellungen zur Firmengeschichte und Managementphilosophie. Die Weltkonzerne für Mode, Medien, Medizin, Musik, Verkehrsmittel und andere Notwendigkeiten des täglichen Lebens standen in starker Konkurrenz zueinander, und so ließ sich auch der Präsident des Musikkonzerns nur ungern zu einem Verzicht auf solch einen Leckerbissen überreden. Doch als alter Freund der Familie gab er schließlich Rebs Drängen nach, zumal er einsah, dass die ausgesuchten Darbietungen zum zeitlichen Rahmen der Fotoausstellung passten und diese wunderbar ergänzen würden. Reb hatte, hartnäckig wie er war, ein paar Schwarz-Weiß-Fotos berühmter Jazzmusiker auftreiben können, die nun die Wände des zum Konzertsaal umfunktionierten Zentralraumes schmückten.
Im Innenbereich des dreigeteilten Gewölbes hatten sie eine viereckige, von allen Seiten durch Treppenstufen erreichbare Bühne aufgebaut und mit Reihen aus schwarzledernen Regiestühlen umgeben. Das Orchester spielte auf einer drehbaren Plattform, die dem Publikum in regelmäßigen Abständen eine neue Perspektive präsentierte. Die gedämpfte Beleuchtung verlieh dem vornehmlich in warmen Schwarztönen gehaltenen Ambiente ein extravagantes Flair und bildete den idealen Hintergrund für einen musikalischen Abend von außergewöhnlicher Exklusivität.
Der Veranstaltungssaal war an seinen Außenseiten durch eine Vielzahl von Durchgängen in Form arkadenartiger Rundbögen mit einem breiten Gang verbunden, der um den gesamten Innenbereich herumführte. Durch seine hellen Wände wirkte dieser zweite Teil des Zentralraumes besonders geräumig. Auf blauschwarzem Kunststoffmarmor standen, gruppiert um niedrige Acrylglastische, Sitzgruppen aus weißem Leder, großzügig geschnittene Zwei- und Dreisitzer und bequeme Einzelsessel, denen in unregelmäßiger Folge eine Reihe künstlicher Phönixpalmen zur Seite gestellt worden war. Wer hier saß, suchte ein stilles Musikerlebnis, wollte die Show ohne großen Rummel genießen oder sich bei angenehmer Musik ein wenig unterhalten. Auch der Mittelraum wurde an seiner Außenseite von Rundbögen begrenzt. Sie waren etwas kleiner als ihre Pendants an der gegenüberliegenden Seite und spärlicher an der Zahl, sodass sie noch genügend Wand übrig ließen, an die Reb seine Jazzfotos hatte hängen können.
Der dritte Bereich bestand aus einem weiteren Rundgang mit großen ausladenden Tischen für bunt gemischte Gesellschaften, etlichen Buffets und einigen Bars. In diesen Hallen konnte man nach Herzenslust dinieren, diskutieren oder ausgelassen feiern und durfte auch ein wenig laut werden, ohne Angst haben zu müssen, die Vorführung zu stören. Neuartige Materialien und eine ausgeklügelte Bauweise sorgten dafür, dass die Musik in unterschiedlicher Lautstärke in allen drei Gewölben des Zentralraumes zu hören war, die Stimmen und Hintergrundgeräusche aus den Rundgängen jedoch nur in unbedeutendem Maße in den Veranstaltungssaal eindringen konnten.
Soul hatte sich einen Imbiss geholt und sich in einem der vielen weißen Sofas im Mittelraum niedergelassen. Hier war es um diese Zeit noch am ruhigsten. Nur wenige Besucher saßen in den Sitzgruppen, plauderten leise oder gaben sich entspannt und teils mit geschlossenen Augen dem Musikgenuss hin.
Soul platzierte den Teller mit dem Imbiss auf ihren Knien und versuchte, sich auf die Mahlzeit zu konzentrieren. Doch während sie das Fleisch mit dem Messer zerteilte, wanderten ihre Gedanken immer wieder zurück zu den Ereignissen der letzten Tage. Warum nur war sie nach dem Tod der Mutter nicht sofort informiert worden? Ein Autounfall, hatte es geheißen, die Fahrerin wäre noch an der Unfallstelle gestorben. Doch an jenem Tag war ihre Mutter mit zwei Freundinnen im hauseigenen Fitnesscenter verabredet gewesen. Wie passte da eine plötzliche Autofahrt ins Bild? Der Leichnam wäre völlig zerstückelt gewesen – kein schöner Anblick für eine Tochter von gerade einmal fünfundzwanzig Jahren.
„Einäscherung aus ästhetisch-psychologischen Gründen“, hatte auf dem Formular gestanden, „ohne vorherige In-Kenntnis-Setzung der Angehörigen.“
Nur wenige Monate zuvor war Souls Vater zu einer Außenmission in ein Reservat berufen worden und von dieser Reise nicht wieder zurückgekehrt. In einem maschinell erstellten Abschiedsbrief hatte er Frau und Kinder um Verzeihung gebeten, weil er ein neues Leben beginnen wollte fernab beruflicher Verpflichtungen und familiärer Bindungen. Die Geschwister waren fassungslos gewesen. Ihre Familie hatten sie immer als eingeschworene Gemeinschaft erlebt, in der sich jeder auf den anderen verlassen konnte. Das Wohl der Kinder ging ihren Eltern über alles. Wie lange zum Beispiel hatte ihr Vater um eine Verkürzung der nachmittäglichen Hortstunden kämpfen müssen. In einer hoch technisierten Gesellschaft wie der Stadt Tambara, in der sowohl das Berufsleben als auch die arbeitsfreie Zeit nach einem bis ins Detail geplanten und größtmögliche Effizienz versprechenden Programm vonstattenging, kam es höchst selten vor, dass Eltern ihre Kinder vor Ablauf des Tages zu sich nach Hause holten, nur um mit ihnen noch ein paar Stunden gemeinsam zu verbringen. Institutsleiter, Vorgesetzte, Pädagogen, ja selbst enge Freunde hatten ihm zu bedenken gegeben, wie viele wertvolle Erfahrungen seinen Nachkommen vorenthalten blieben, wenn er die vom Erziehungsinstitut von Tambara empfohlene Betreuungszeit für Säuglinge und Kleinkinder unterschritt und Reb und Soul einen Teil des abwechslungsreichen Freizeitangebotes verpassten. Doch der Vater hatte seine Forderungen durchgesetzt und auch, trotz seiner anspruchsvollen Arbeit als Arzt, immer wieder die Zeit gefunden, mit der Familie etwas zusammen zu unternehmen. Und dieser Mann sollte seine Kinder im Stich lassen? Von einem Tag auf den anderen? Ohne Abschied, ohne ein offenes Wort? Niemals!
Soul verstärkte den Druck unter ihrer Klinge und zerschnitt das Fleisch in unzählige kleine Stücke. Nach dem Eintreffen dieses schrecklichen Briefes war ihre Mutter von einer Behörde zur anderen gelaufen, um eine Besuchserlaubnis für das Reservat zu beantragen. Sie hatte gehofft, an Ort und Stelle einen Anhaltspunkt zu finden, der vielleicht zu einer Spur ihres Ehegatten hätte führen können. Doch eine simple Familienangelegenheit war kein ausreichender Grund für einen Reservatbesuch.
Soul griff nach dem Teller, der durch eine unachtsame Bewegung ins Wanken geraten war, und setzte ihn entnervt auf der Tischplatte ab. Dabei traf ihr Blick auf den eines elegant gekleideten, jungen Herrn, der ihr gegenüber an einem der Durchgänge stand und sie allem Anschein nach schon geraume Zeit beobachtet hatte. Während er, die linke Hand in der Hosentasche, lässig an der Einfassung des Rundbogens lehnte, hob er das Glas in seiner Rechten zum Gruß. Ein angedeutetes Lächeln verriet ihr, dass sie gemeint war.
„Ach, hier bist du!“
Reb hatte seine Schwester entdeckt und sich neben sie auf das Sofa geworfen. Mit einem Druck auf den Serviceknopf in der Armlehne forderte er die Bedienung an. Eine Kellnerin im weißen Kittel räumte den Teller ab und wischte mit einem ebenso weißen Reinigungstuch über die Glasplatte des Tisches. Soul wagte einen erneuten Blick zum Rundbogen hinüber, aber der Fremde war verschwunden.
„Warum mischt du dich nicht unters Volk?“, fragte Reb. „Ein wenig Abwechslung würde dir guttun.“
„Ach, gönn mir einfach ein wenig Ruhe. Es läuft doch alles wie geplant. Das Thema der Ausstellung scheint auf Interesse zu stoßen, und wenn wir Glück haben, beschäftigen sich wieder einige Bürger mehr mit unserer nebulösen Vergangenheit.“
Erschrocken über den fast provozierenden Unterton, mit dem sie die letzten Worte ausgesprochen hatte, stockte Soul und sandte ein paar unsichere Blicke in die Umgebung hinaus. Mit gedämpfter Stimme sprach sie weiter.
„Was wohl die Presse über unsere Ausstellung schreiben wird?“
„Schwesterchen, du machst dir zu viele Sorgen. Vergiss nicht: Die Presse – das sind wir.“
Soul runzelte die Stirn.
„Sind deine Kollegen verlässlich?“
„Die, die den Artikel schreiben, schon. Und da die Ausstellung ein Kind des Medienkonzerns ist – wenn auch gefärbt durch unsere persönliche Sichtweise –, wird schon niemand wagen, sie zu zerreißen.“
Die beiden schwiegen, als ein Angestelltenpaar des Sicherheitsdienstes an ihnen vorbeischlenderte.
„Tambara-Hallo“, grüßte der Mann, „alles in Ordnung?“
„Aber sicher doch“, erwiderte Reb souverän, „und bei euch?“
„Wie immer“, antwortete die Frau freundlich und wandte ihre Aufmerksamkeit wieder der Menge zu.
Im Veranstaltungssaal verstummte das Orchester. Durch die Rundbögen hindurch sah Soul, wie sich der Dirigent an das Publikum wandte.
„Meine Damen und Herren“, sprach er in das Mikrofon, „im Rahmen unseres heutigen Konzertes haben wir für Sie einen ganz besonderen Leckerbissen vorbereitet. Wie manche von Ihnen vielleicht wissen, wurde der Jazz in damaligen Zeiten nicht von allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen verstanden und geliebt. Den Künstler aber, den wir Ihnen nun präsentieren, kannte man auf der ganzen Welt. Seine sympathische Stimme war in jenen Tagen ebenso populär wie sein Trompetenspiel. Ladys and Gentlemen, begrüßen Sie mit mir“, er hob den Arm und deutete zum Bühnenaufgang hinüber, „Louis Armstrong – the legendary Satchmo!“
Das Publikum klatschte höflich, als ein älterer Farbiger die Bühne erklomm. Die Lichter erloschen, und während das Orchester in der Dunkelheit nur noch schemenhaft zu erkennen war, suchte ein einziger greller Scheinwerfer das winzige Stückchen Bühne, auf dem sich der Sänger postiert hatte. Als der Spot sein Gesicht erhellte, ging ein Raunen durch den Saal.
„Louis Armstrong …, Armstrong, Louis …“, flüsterten die Gäste in ihr Technikarmband und betrachteten erstaunt das Gesicht, das sich auf dem kleinen Bildschirm an ihrem Handgelenk formte.
Anerkennend stellten sie fest, dass Visagisten, Kostümbilder und Beleuchter hier wieder einmal ganze Arbeit geleistet hatten, denn der Mann auf der Bühne sah dem verstorbenen Sänger zum Verwechseln ähnlich. Während das Orchester nun den Song live vom Blatt spielte, erklang aus den Lautsprechern die historische Originalstimme, und Musiker und Schauspieler stellten eine alte Filmszene nach. Nur wenige Minuten dauerte es, und der künstliche Satchmo hatte die Besucher vollkommen in seinen Bann gezogen. Berührt lauschten sie den fremdartigen Rhythmen, ließen sich umgarnen vom warmen Timbre dieser rauchigen Stimme und verfolgten befremdet und fasziniert zugleich den Auftritt eines mit sich und der Welt zufriedenen Menschen, dessen einziger Wunsch es zu sein schien, seine Zuhörer glücklich zu machen und von ihnen geliebt zu werden.
Für einen Moment vergaß selbst Soul, dass es sich um eine Attrappe handelte. Sie lehnte entspannt in ihrem Kunststoffsofa und schaute verträumt zur Bühne hinüber.
„I see trees of green, red roses too, I see them bloom for me and you …”, drang die Stimme aus dem Lautsprecher.
Ein leichtes Unbehagen bemächtigte sich ihrer, als sie jetzt den Worten des Liedes lauschte.
„I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night …”
Plötzlich erschien es ihr wie eine Provokation, in einem Zeitalter, in dem Tiere und Pflanzen nur noch in Reservaten lebten, jegliche natürliche Erde unter Hightech-Kunststoff verschwunden war und selbst das allgegenwärtige kosmische Staubkorn sich anstrengen musste, einen Platz in der Wohnung zu finden, von so etwas Verrücktem wie Bäumen und Rosen zu singen.
„The colors of the rainbow so pretty in the sky are also on the faces of people going by …”
„Ob es damals wirklich so schön war auf unserer Erde?“, wandte sie sich an ihren Bruder.
„Ich weiß nicht“, antwortete Reb. „Jedenfalls fühlt es sich verdammt gut an.“
Die Arme hinter dem Kopf verschränkt und seine Beine weit von sich gestreckt, so lauschte auch er den verführerischen Klängen.
Die Gäste im Mittelraum schienen genauso zu empfinden. Sie lehnten entspannt in ihren Sitzgruppen, verfolgten gebannt das Spektakel auf der Bühne oder konzentrieren sich mit geschlossenen Augen ganz auf die Musik. Andere schlenderten an Rebs Fotografien vorbei, blieben hier und da stehen, vertieften sich in eines seiner Bilder oder diskutierten mit verhaltener Stimme über das Für und Wider vergangener Visualisierungspraktiken. Alles wirkte so elegant, so perfekt und unendlich friedlich, als hätte es nie irgendwelche Irritationen gegeben.
„I hear babies cry, I watch them grow, they’ll learn much more than I’ll ever know – yes, I think to myself what a wonderful world …”
Reb hatte noch einige Repräsentationspflichten zu erfüllen und begab sich wieder an seine Arbeit. Soul betrachtete die Leute vor der Bildergalerie. Die ausschließlich in schwarz-weiß gehaltenen Fotografien schienen eine ungewöhnliche Anziehungskraft auf die Besucher auszuüben. Erstaunlich lange begutachteten sie die Ausstellungsstücke.
Soul stand auf und tat es ihnen nach. Mit verschränkten Armen wanderte sie die Bildreihe entlang. Es war schon irgendwie merkwürdig. Diese historischen Fotos hatten so wenig gemein mit dem Material aus dem Medienkonzern. An ihnen war nichts perfekt. Die stimulierende Farbe fehlte, das Ursprungspapier ließ keine absolute Bildschärfe zu und es waren keine professionell hergerichteten Studiogesichter zu sehen, sondern ausschließlich Menschen in ihrer alltäglichen Umgebung, die ganz ungezwungen miteinander lachten, tanzten, musizierten, so als wäre die Kamera gar nicht zugegen. Doch trotz oder vielleicht gerade wegen dieser aus moderner Sicht eindeutig kompositorischen Fehler verströmten diese Aufnahmen eine fast fühlbare physische Nähe.
Vor der Fotografie eines Saxofonisten blieb sie stehen. Der farbige Musiker hatte die Augen geschlossen und blies voller Hingabe in sein Instrument. Soul hörte den Blues, der aus dem Innenraum herüberdrang, und für einen Moment war ihr, als würde dieses Bild vor ihren Augen lebendig. Das Saxofon schien sich zu bewegen, und die Hände, die es hielten, wiegten es behutsam im Takt der Musik.
„Ist es nicht wunderschön?“
Jemand war an sie herangetreten und stand nun dicht hinter ihr. In der Reflexion des Glases erkannte sie den eleganten Fremden, der kurz zuvor an einem der Rundbögen gelehnt hatte.
„Wunderschön, ja …“
Soul überlegte, ob sie sich einem gänzlich Unbekannten anvertrauen durfte.
„Sie wollten etwas sagen?“, ermutigte sie dieser.
„Ich finde …, es hat Gefühl“, platzte sie heraus.
„Sollte uns das beunruhigen? Es ist doch nicht verboten, sich beim Betrachten eines Bildes berührt zu fühlen.“
„Verboten nicht, nein.“
Soul wagte einen Blick zur Seite.
„Trotzdem ist es Ihnen unangenehm.“
„Nun ja, in einer Welt, in der fast jeder nach Perfektion strebt und unser Alltagsleben strengen wirtschaftlichen Optimierungsprozessen unterliegt, ist es schon irgendwie merkwürdig, wenn jemand auf einer offiziellen Veranstaltung von so etwas … Unkalkulierbarem wie Gefühlen spricht. Finden Sie nicht?“
Für einen kurzen Moment standen beide wortlos nebeneinander und betrachteten das Bild. Plötzlich hob der Fremde seinen Arm und deutete mit der linken, halb geöffneten Hand auf das Saxofon.
„Schauen Sie sich diese Linie an“, forderte er seine Gesprächspartnerin auf und fuhr mit der Hand die Form des Instrumentes nach. „Sehen Sie, wie konsequent der Fotograf sie gestaltet hat? Kraftvoll und elegant ist sie, raumgreifend und fließend, erfrischend klar und doch … erfüllt von einer fast physisch spürbaren Wärme.“
Während er sprach, glitten seine Finger über das Bild, ohne das Glas zu berühren. An seinem schlanken Handgelenk registrierte Soul ein teures Technikarmband und eine weiße Hemdmanschette.
„Ich finde, das Motiv fasziniert nicht nur durch die gelungene Komposition bildnerischer Elemente“, ergänzte sie energisch und richtete sich auf. „Es ist die Aussage, die besticht. Dieses Foto will keine vorprogrammierten Inhalte im Kopf des Betrachters festsetzen, um ihn zum Kauf irgendeines Produktes zu bewegen. Hier geht es um Genuss, und zwar um den Genuss um seiner selbst willen. Der Musiker plant seine Melodie nicht im Voraus, sondern nimmt sich Zeit, sich auf sie einzulassen. Er wartet ab, wie sie sich entwickelt, und findet erst während des Auftritts seine momentane Spielart. Wahrscheinlich hat er dieses Stück schon Hunderte von Malen gespielt, doch wie er es in diesem Augenblick gestalten wird, hängt von seiner Stimmung ab, von dem Tag, den er verlebt hat, den Menschen, die ihm begegnet sind. Er legt all seine Freude hinein, seine Enttäuschung, seine Hoffnung. Indem er seinen Gefühlen Ausdruck verleiht, befreit er sich selbst. Und so wie der Musiker nur für diesen Augenblick spielt, so lebt auch das Bild nur durch sich selbst und für sich selbst …, und deshalb ist auch das Betrachten dieses Bildes … purer Genuss.“
Soul atmete tief und heftig.
Für einen Moment schwiegen beide.
Schließlich löste sich ihr Gegenüber vom Anblick der Fotografie.
„Welch weise Interpretation für eine so junge Dame. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist W.I.T., Sir W.I.T.“
Er reichte ihr die Hand.
Soul wurde blass.
„W.I.T. …? Sir W.I.T. …? Der Sir …?“, fragte sie ein wenig zu laut und merkte, wie ihr Gegenüber zusammenzuckte.
„Bitte entschuldigen Sie, ich hatte nicht erwartet, einer solchen Berühmtheit auf unserem bescheidenen Konzert zu begegnen.“
Freudig ergriff sie die ihr dargebotene Hand und war überrascht über den warmen, fast persönlich anmutenden Händedruck, der ihr zuteilwurde. Sie registrierte noch, dass er wohl nicht mehr ganz so jung war, wie sie zunächst vermutet hatte, ein Mann mit Lebenserfahrung, da wanderten sie schon gemeinsam den Säulengang entlang.
„Ich hoffe, Sie genießen den kleinen Abend, den wir arrangiert haben.“
„Ich bin entzückt. Er zeugt von Geschmack und Intelligenz … und … Mut.“
Schon wieder ein Kompliment.
Soul war sichtlich irritiert.
„Sie müssen entschuldigen, dass ich Sie nicht gleich erkannt habe, aber es gibt …“
„… kaum Bildmaterial von mir, ich weiß“, ergänzte er verständnisvoll.
Soul lächelte. Wie nett von ihm, ihr über diesen peinlichen Moment hinwegzuhelfen.
An einem der Rundbögen blieben sie stehen und blickten zur Bühne hinüber. Unter tosendem Applaus verabschiedete sich der künstliche Louis Armstrong von seinem Publikum. Soul klatschte begeistert mit. Es war wirklich eine gelungene Vorstellung gewesen. Mit so viel echtem Beifall hätte sie nicht gerechnet. Vielleicht interessierten sich die Bürger Tambaras doch mehr für die Vergangenheit, als sie bisher vermutet hatten. Plötzlich erschien es ihr unhöflich, so lange zu schweigen. Sie wandte sich wieder ihrem Gesprächspartner zu und stellte überrascht fest, dass dieser verschwunden war.
4
Soul saß an ihrem großen, fast leeren Schreibtisch und betrachtete einen Apfel. Es war ein ganz besonders schöner Apfel. Er lag vor ihr auf der Tischplatte und war groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite. Seine Haut war feinporig und schimmerte wie Porzellan, vielleicht sogar wie Seide, wie ganz besonders feine Seide, doch wenn man sie berührte, diese Haut aus Seide, fühlte sie sich fest an und fast ein wenig lederartig, so wie ein dicker Schutzmantel, der etwas zu bewahren hatte und nur unter Einsatz von Gewalt bereit war, sein Inneres zu offenbaren.
Soul nahm den Apfel in die Hand und hielt ihn in das Licht. In Zeitlupe drehte sie ihn, fuhr mit den Fingern über seine Schale, hauchte diese an und putzte sie an ihrem Blusenärmel blank, drehte den Apfel ein weiteres Mal im Schein der durch die großzügigen Scheiben ihres Wohnraumes einfallenden Sonnenstrahlen hin und her und legte ihn wieder auf der Tischplatte ab.
Ein Apfel.
Der Apfel.
Der Tambara-Apfel.
Waren sie nicht alle gleich, diese Äpfel? Ein Apfel sah doch aus wie der andere? Früher, so überlegte sie, da gab es große und kleine Äpfel, dickbäuchige und schlanke, Äpfel mit grünen, gelben, roten oder bunt gefärbten Schalen, mit süßem Fruchtfleisch oder herzhaftem Innenleben. Wie sie gehört hatte, bevorzugten die Kunden von damals sehr unterschiedliche Geschmacksrichtungen und kauften ihren Vorstellungen entsprechend auch ganz verschieden ein. Heutzutage gab es nur einen Apfel: den Tambara-Apfel. Er sah immer gleich aus: groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite. Vor gar nicht allzu langer Zeit konnten die Bewohner der Stadt noch zwischen zwei miteinander konkurrierenden Apfelsorten wählen. Doch dann kam der Tambara-Apfel. Er war größer als seine Vorgänger, fester im Fleisch und extrem haltbar – schlichtweg konkurrenzlos. In kürzester Zeit verschwanden die beiden alten Sorten vom Markt.
Soul platzierte ihre Unterarme auf der Schreibtischplatte, bettete das Kinn auf die übereinandergelegten Hände und begutachtete die Frucht aufs Neue. Auch aus dieser Perspektive betrachtet, war es immer noch ein Tambara-Apfel: groß und gelb, mit einem Hauch von Rot und Grün an einer Seite.
So sinnierend fand Reb seine Schwester, als er sie nach dem Frühstück aufsuchte, um mit ihr die Pressereaktionen durchzugehen.
„Nanu?“, wunderte er sich. „Bei welch wichtiger Gedankensitzung habe ich dich denn gerade gestört?“
Soul hob den Kopf.
„Findest du nicht auch, dass dies ein ganz besonders schöner Apfel ist?“, fragte sie, ohne auf seine Neckerei einzugehen.
„Mag sein“, entgegnete Reb halbherzig und steuerte auf das Sofa zu.
„Findest du nicht, dass dies ein ganz besonders schöner Apfel ist?“, wiederholte seine Schwester die Frage und schaute weiter unbeirrt auf den Gegenstand ihrer Unterhaltung.
Reb wusste nicht so recht, was er davon halten sollte.
„Es ist halt ein Tambara-Apfel.“
Als Soul nichts entgegnete, fügte er hinzu: „Ein Tambara-Apfel ist immer schön, sonst wäre er kein Tambara-Apfel.“
„Genau das meine ich.“
„Also komm, Schwesterchen, worauf willst du hinaus?“
Soul setzte sich auf und blickte ihren Bruder an.
„Du hast es gerade selber schon gesagt. Er muss schön sein, weil er ein Tambara-Apfel ist. Dieser Apfel ist nämlich genau definiert: seine Größe, seine Farbe, die Konsistenz des Fruchtfleisches, der Geschmack. Das heißt, wir brauchen uns gar nicht erst den Kopf darüber zu zerbrechen, ob er schön ist. Wir wissen, dass er es ist, sonst hätte er in unserer Gesellschaft nicht überlebt.“
„Ich weiß, was du meinst“, erwiderte Reb, „aber lass uns jetzt die Sonntagszeitung ausdrucken.“
Doch Soul war noch nicht fertig.
„Vielleicht ist er ja gar nicht schön.“
Reb stieß einen Seufzer aus und ließ sich auf das Sofa plumpsen.
„Woher wollen wir eigentlich wissen, wie ein schöner Apfel aussieht? Die meisten von uns haben doch noch nie einen anderen Apfel zu Gesicht bekommen. Vielleicht waren die ausgestorbenen Sorten ja auch schön. Vielleicht waren sie sogar noch schöner als dieser Apfel hier. Wie wollen wir das überhaupt beurteilen? Uns fehlt doch der Vergleich.“
Reb blieb unbeeindruckt.
„Der Markt hat verglichen.“
Seine Antwort machte Soul wütend.
„Himmel, ich weiß, dass unser Alltag marktwirtschaftlichen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Aber schließlich mussten Forscher durch gezielte Veränderungen des Erbgutes diese Frucht doch erst einmal entwickeln.“
„Richtig, und dann hat der Markt entschieden. Und geforscht wurde immer schon nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten.“
„Aber vielleicht waren unter den vielen dazwischenliegenden Entwicklungsstufen ja auch attraktive Sorten. Vielleicht gab es sogar unter den natürlich gewachsenen Äpfeln schöne Exemplare, und vielleicht schmeckten einige von ihnen ja sogar besonders gut.“
Reb wusste, wenn seine Schwester sich in ein Thema verbissen hatte, war mit ihr nicht zu spaßen. Also holte er ein wenig aus.
„Wie du weißt, konnten die natürlichen Äpfel unseren Ansprüchen irgendwann nicht mehr genügen. Die im Labor entworfenen Früchte sahen besser aus, waren widerstandsfähiger und da die natürlichen Äpfel niemand mehr kaufte, pflanzte auch niemand mehr Bäume mit diesen Sorten an. Davon abgesehen hatte sich das Erbgut der Gen-Äpfel längst mit dem der Naturfrüchte vermischt. Die Vorstellung, Samen manipulierter Pflanzen auf Dauer vom natürlichen Bestand fernhalten zu können, erwies sich als Illusion. Die Wissenschaftler hatten die Macht der Evolution schlichtweg unterschätzt. Und da sich das Erbgut der Laborprodukte aufgrund der höheren Widerstandskraft durchsetzte, starben die natürlichen Früchte allmählich aus. Was übrig blieb, waren Mischsorten. Das heißt, Natur oder natürlich gezogene Pflanzen ohne gentechnische Veränderung gab es ja sowieso schon lange nicht mehr. Aber auch diese Mischfrüchte, die bei unseren Vorfahren noch in freier Wildbahn wuchsen, verschwanden allmählich von der Erdoberfläche. Man brauchte mehr Platz für die guten und schönen Äpfel, die auf dem Markt bestanden. Die besten haben überlebt. Heutzutage gibt es eben nur noch den Tambara-Apfel, die Lianca-Birne, die Chicotora-Banane. Die meisten Kunden haben sich vor langer Zeit für diesen Apfel entschieden. Immerhin gehört Tambara zu den wenigen Städten auf unserem Erdball, die sich mit der Entwicklung einer marktbeherrschenden Design-Frucht schmücken können.“
„Weißt du was“, unterbrach Soul ihren Bruder, „ich besäße gern einmal einen natürlichen Apfel, einen von der Art, wie er auf der Erde wuchs, noch bevor die Menschen die Gentechnik entdeckten.“
„Und was würdest du mit ihm anfangen?“
„Ich würde ihn essen und ausprobieren, wie er schmeckt. Vielleicht schmeckt er ja ganz gut. Vielleicht schmeckt er mir, und ich betone ausdrücklich ‚mir’, ja sogar noch besser als unser Tambara-Apfel. Und vielleicht wäre er auf seine eigene, ganz besondere Art ja sogar schön.“
„Schön ist, was sich verkaufen lässt und auf dem Markt besteht!“
Reb wollte nun endlich seine Zeitung lesen.
„Ja, ich weiß, und die Katze beißt sich in den Schwanz.“
Missmutig wandte Soul sich ihrem Computer zu. Geräuschlos spuckte das Gerät die Sonntagszeitung aus.
Der Schriftzug des Titels fiel sofort ins Auge: „Triumph der Forschung – Fotografien vergangener Jahrhunderte dokumentieren medizinischen Fortschritt.“
Neugierig breiteten die Geschwister das Endlospapier auf dem Fußboden aus.
Reb hatte recht behalten. Seine Kollegen waren verlässlich. In ihrem Artikel lobten sie die Fleißarbeit des Medienfachmannes, beschrieben die einzelnen Abteilungen der Ausstellung, Größe, Art und Zusammenstellung der präsentierten Fotografien und vermerkten lobend, wie dem aufmerksamen Besucher beim Rundgang durch die Ausstellung bewusst würde, mit welch enormem Fortschritt der Alltag der modernen Menschheit gesegnet sei. Nur eine kleine Notiz am Ende des Artikels verwies auf Bezugsquellen weiterführender Literatur. Souls Jazzkonzert wurde als ungewöhnlicher, aber schmackhafter Kunstgenuss eingestuft, der Auftritt des Louis-Armstrong-Doubles als Höhepunkt herausstaffiert und als Hintergrundinformation gab es detaillierte Beschreibungen über Maske, Kostüme und Beleuchtungseffekte. Kein Wort über die Geschichte des Jazz, über den kulturellen Hintergrund oder das damit verbundene Lebensgefühl. Nichts …, doch, wieder diese unscheinbare Fußnote am unteren Seitenrand. Dem Durchschnittsleser mochte sie nicht viel sagen. Auf ergänzende Quellen wurde an solchen Stellen häufig hingewiesen, auch wenn kaum ein Abonnent heutzutage noch die Zeit fand, sich eingehender mit Zeitungsnotizen dieser Art auseinanderzusetzen. Wer sich jedoch mit solch oberflächlicher Information, wie der Artikel sie lieferte, nicht begnügen wollte, konnte im Net mithilfe der Schlüsselwörter ausführliche Erläuterungen zu den Schlagzeilen abrufen – vorausgesetzt, die Regierung hatte die Seiten noch nicht gelöscht.
Es war immer ein Wettlauf mit der Zeit. Vom Staat eingesetzte Controlsurfer sollten Netbetrüger aufspüren und Firmen bzw. deren Kunden vor Missbrauch schützen. Merkwürdigerweise verschwanden dabei aber immer wieder auch Informationen, die private Nutzer eingegeben hatten in der Absicht, mit Gleichgesinnten über ein Thema aus der Medienwelt vergangener Jahrhunderte zu diskutieren. Jemand hatte zum Beispiel einen Artikel über einen missglückten Forschungsversuch ausfindig gemacht und eine Datei dazu angelegt. Wer Fragen stellen, eigene Gedanken äußern oder Ergänzungen zum Thema anbieten wollte, schloss sich an. Man traf sich auf anonymen Plattformen, deren Absender dank eines ausgeklügelten Sicherheitssystems nur selten zu ermitteln waren. Auf diese Weise gelangte man häufig an Informationen, die nirgendwo sonst mehr nachzulesen waren. Oft befanden sich darunter auch Seiten offiziell nicht mehr existierender Bücher. So mancher Leser erinnerte sich beim Durchforsten dieser Sammlungen an ein von seinen Vorfahren ererbtes Schriftstück und vervollständigte die Dateien mit Texten aus seiner privaten Informationsquelle. Reb und Soul waren der Überzeugung, dass in vielen Haushalten noch Bücher von unschätzbarem Wert schlummerten, die aufgrund ihrer Einstufung als wertlos oder minderwertig im Laufe der Zeit in Vergessenheit geraten waren. Diese galt es zu aktivieren.
Neuerdings erfreuten sich solche Plattformen eines regen, stetig zunehmenden Interesses. Nur gab es anscheinend Kräfte in der Regierung, denen dieser unkontrollierte Informationsaustausch ein Dorn im Auge war. Wie sonst sollte man es sich erklären, dass diese Seiten immer wieder von den Bildschirmen verschwanden.