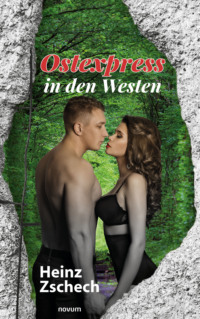Kitabı oku: «Ostexpress in den Westen», sayfa 8
„Auf bald!“ – Bald geht sein Stern auf unter dem Himmel. –
„So aber bleiben noch drei“, meint Lewon weise. „Und zu dritt spielt man gewöhnlich Karten bei uns.“ – Er packt Martins französisches Geschenk auf den Tisch. „Wer verliert, muss ein Kleidungsstück setzen.“
Man setzt sich zur Erde, mischt, teilt aus und gewinnt. Alle verlieren. Am meisten aber Larissa – sie bleibt im kurzen Unterrock sitzen. „Ich kann nichts mehr bieten“, bedauert sie sehr, doch Ljowa ist eingenickt und liegt in seiner giftgrünen Turnhose mit den bunten Trägern als Klips auf dem Bett. Er ist einfach nicht mehr zu rühren. Schwindlig, aber ein wenig unverständig-anständig noch, starrt Martin in die Grübchen Larissas und traut sich nicht, weiter nach unten zu sehen. „Der schläft“, murmelt er leise. „Wir müssen jetzt gehen.“ – Sie schaut auf die Uhr: „Um diese Zeit gibt es hier keinen Bus, keine Taxe, kein Nichts.“ – Und mit einem gewagten Blick auf das Bett meint sie: „Das ist so breit wie für drei.“
Schwer fällt Martin das Herz bis hin zu den Ohren, hat sich verhört, hat sie überhaupt nicht gehört. Doch Larissa steckt bereits unter der Decke mit dem, was sie noch nicht am Abend verspielte:
„Mach das Licht bitte aus!“ – Er macht’s und macht, dass er ins Bett kommt – an seinen äußersten Rand. Sie aber nimmt ihn geschickt unter das Laken, legt ihren Körper und ihre Lippen zu ihm. Mit diesem Mund könnte sie beide Jungen umarmen, und er ist heiß wie die Beine von ihr. Martin rührt zaghaft daran, und er zittert, er bewegt ihre Haut, den Nacken unter dem Haar, er rührt an dem Glück. „Ich kann es einfach nicht glauben“, zweifelt er leise. Indes, das Mädchen glaubt dran, hatte schon immer gehofft, von dem allerersten Sehen im Heim: „Ja.“ – Ihre Zunge – sie lacht. Ein Rauschen. Nur schön. Halten, sich krallen am Reiz, und alles ist jetzt. Alles ist Kosten, ist Nießnutz und Nießbrauch, und man atmet den Atem des anderen ein. „Warum habe ich noch nie so geküsst? Bin nie versunken gewesen in solche Lippen, die von irgendwo herkommen ohne ein Halt und ins Nicht-mehr-Erinnern verlaufen, in Sand?“ – Probierte er nicht vormals, in früheren Tagen hinzukommen, zu wünschen, hinzubekommen den Wunsch? Und war es trotzdem immer und um Gottes willen nicht bloß ein Nebenan, war lediglich ganz dicht, nur eben nahe daran? Wie oft hatte er es gehabt dieses „Fast genau“, das „Beinahe ein Mädchen“, das „um ein Haar“, das „Bald“, das „Es fehlte nicht viel, und es wäre ideal“? Doch ein Schier ist ein Ungefähr, und ist tausend Werst vom haargenau weg – es ist das Gleiche wie nichts. Und plötzlich zählt das alles nicht mehr, war trivial, war niemals und kalt. Neben ihm liegt das Mädchen, und Martin brennt in sein Herz: „Bloß es nicht mehr verschenken!“ – Und Larissa reicht hin: „Nimm, was du willst, und was du willst, ist für mich übergenug.“ – Seitwärts am anderen Rande schläft Lewon seinen seltsamen Traum, schläft leicht zuckend sein Babygesicht und ruhen seine geschlossenen Augen.
„Ljowa könnte uns hören“‚ mahnt Martin.
„Er hört nichts, er sieht nichts, er ahnt nichts“, lacht sie und küsst Martin geschwind. Und er fühlt den Wandel an sich, das Lose, die verlorene Angst. Er ist in Frieden mit sich. Jede Zeile von ihr ist ein Strömen in ihm, ein Kuss, die Hand auf dem Bein ist ein „Niemals genug“. Martin denkt nicht an „mehr“, er denkt überhaupt nichts, er hat das Denken verlegt. Es ist ihm eine sichere „Bank“, und jede Winzigkeit ist ihm neu, ist ihm Wunder und schön. „Wie kann ich bloß alles genießen, versuchen und schmecken?“ – Es wird jetzt eine Zeitlupenprobe für ihn, ein Tasten in ihre Welt.
Und das Mädchen ist da, ist „an-sich“, weiß eigentlich nur: „Alles ist uns erlaubt, alles ist möglich“ – es gibt keine Achtungssignale, kein Halt vor dem Reiz, der aus den Zellen ihm fließt. Wie viel Zeit muss man haben, um alles zu spüren? – Es ist ein Ring in die Ringe, das Einringen zu dem Blühen, ein Letztes. Larissa aber hat keine Angst vor Martin, vor dem schlafenden Armenier, vor der fremden Haut an der ihren. Sie hat nur Freude daran, vor dem Hingeben an den Lauf aller Dinge, dem Tun, dem Gefühl. Wer freilich könnte behaupten, dass die beiden sich bereits an die Grenze gefühlt, sich gezogen bis an den Schlussstein, dass sie etwas konkret Genaues möchten mit einem „bestimmt“ – in ihn, in sie –, wo die Leiber befrieden in einem einzigen Kuss, in einem Blick, einer Frage, wo Erregung kommt von dem, dass man ist, dass man „zwei“ ist, eine Seele, und dass man unendlich genießt an dem Nichtgewesenen, an dem, was im Traum existiert? Als ob eine einzige Nacht Befriedigung schafft! Als ob die Nacht nicht Befriedigung in Kristalle zerlegt. – So suchen zwei sich wie ewig, um alles zu finden darin. –
Als es schon graut, und von unten die Straßenbahnen durch die Fenster aufschreien, als Lewon sich streckt bis zur Decke und die Augen sich reibt, lösen sie sich – das Lösen verwünschend – und wünschen sich: „Schönen Tag!“.
„Bist du müde?“, fragt er, und leichtfertig leicht antwortet sie:
„Ich liebe.“ – Nichts wissend, ahnend, schmunzelnd und an seiner Bergnase ziehend, bemerkt Lewon:
„Seit gestern bin ich ein Jahr älter als du, kleine Larissa. Ich bin achtzehn geworden.“
„Seit gestern bin ich wieder geboren“, antwortet sie nur zart lächelnd, verschmitzt. –
Die Straßenbahn schüttelt in den Tag, in die Trennung. Jeder hat jetzt wieder seinen eigenen Weg.
Als Ljowa und Martin ins Institut langen, greifen von weiter Hand Flüche sie an: Samwel ist längst informiert. „Ich reiß dir die Hoden aus deinem Sack, du Fotzenreiter, du Sacklaus und Scheißhaufen! Deine Mutter lass ich über meine steife Klinge springen …! In das Arschloch gefickt …! Sauhund räudiger! Den Freund an der Knolle rumführen! Mistkrücke! Mieser Zuhälter von Nutten …!“
Nervös schnappt Lewon Luft wie ein Fisch auf sumpfigem Kies und ringt mit kränklicher Blässe, hat plötzlich überhaupt keine Zeit mehr für Dialoge und für die harten Worte und spielt den angepinkelten Pudel vor dem Landesbruder aus Tiflis.
„Aus deinem elenden Maul schlag ich dir alle Zähne heraus!“, attackiert ihn Samwel. „Scheiße sollst du fressen, drei Tage lang.“
„Was ist eigentlich los?“, fragt endlich nach einer peinlichen Pause scheinheilig Lewon.
„Bastard!“ – Samwel ist spitz, spitzfindig, spitzkommend. Er spitzt die Sache zur Stecknadel im Heu und hat es im Riecher. Der Teufel hat ihm eine Nachricht geritten. „Dieser armenische Zwitter von Lewon glaubt mich austricksen zu können. Deinem Puff werd’ ich es schon zeigen!“ Lewon aber acht und ocht unschuldig über die Maße und macht einen Rotznasenbogen um seinen Kompatrioten. Indes, der packt ihn am Kragen: „Ausgeburt von der Hölle, syphilitischer Kuppler! Hat der Faschist dieses Mädchen gevögelt?“
„Ach, Sjoma!“ – Lewons Kragen wird eng, das Gesicht knallig, und er japst wie vom Kloße gewürgt: „Ich kann dir wirklich nichts sagen. Ich schwöre. Ich habe geschlafen.“ – Lang zieht Samwel ihm die Hosenträger über die Ohren und schnippt sie brutal wie eine Schleuder schmerzhaft zurück:
„Stinkender Potz!“ – Alsdann wendet er sich an die andere „Krücke“: „Faschist! Hast du ihr das Ding reingesteckt?“
„Nein“‚ antwortet Martin.
„Nein?!“, brüllt Sjoma zurück. „Dieses Schwein schwarze hat das Maul noch zum Lügen.“ – Ärgerlich schiebt er den Neinsager zur Wand und wuchtet noch einmal die Stimme: „Und dieser Schlampe mit der Flappe für zehn Schwänze näh ich heut noch die Schamlippen zu.“
Leute laufen aufgeregt zusammen, Mädchen halten sich erschreckt den Mund mit den Händen, Pädagogen öffnen die Türen und schließen sie schnell wieder zu, und Neugierige gehen uninteressiert wieder und wieder vorbei. Jemand lacht auf, jemand schüttelt den Kopf, jemand verliert ihn, jemand hat nur seine Farbe verloren und alle gewinnen dabei. Lauschig tritt die Rosanowa – Dozentin am Institut – an das Grüppchen heran:
„Wer philosophiert denn hier so unintellektuell?“
„Das ist Metaphysik, meine liebe Frau Zenon“, antwortet Samwel. „Der Fritz da glaubt mir meine kleine Hure ausspannen zu können.“
„Im Prinzip muss man Huren nicht ausspannen, sie spannen sich selbst“, kommentiert die Dozentin klug.
„Aber nicht auf meine Kosten!“
„Das ist schlecht ohne Kost. Mit Huren sollte man erst schlafen und dann sie bezahlen. Wie viel ist sie dir schuldig?“
„Der Armenier hat sie angemacht, und der Deutsche legt sich in sie“, wiehert einer hinter der Ecke.
„Ich werde beide vernageln!“, droht Samwel und verlässt in unendlicher Rage die Stunde.
„Beide …“, murmelt Wolodja mechanisch ihm nach. Reizsam und fahrig hat er seine Hände versteckt, seinen Blick – fahlgräulich versunken im Abstand, im Abgrund –, und wie einen Aussätzigen meidet er von nun an den Deutschen. Enttäuschung, Trauer und Hass, ein unendender Riss frisst sich fest in seinem Hirn und lässt ihn für lange ganz alleine zurück.
2
Mit flachköpfigen Reißzwecken picken die Studenten Seiten von Zeitungen an die Wand – an die Hinterwand, an die Seitenwand und vis-à-vis an die Seite. Sogar auf den Fußboden heften und kleben sie sie und auch an die Decke des Raumes. Sie bauen einen Zeitungskiosk von innen, in den man hineinschauen, sich hineinkaufen kann, oder in dem die Zuschauer selbst als Verkäufer, als gedruckte Zeile sich finden. Dahinter aber ist nichts, ist die andere Seite, das „Nur Weiße“, die Wand. Und alles ist auf der Mauer geschrieben, steht schwarzzeilig dort.
In diesem gezeitungten Raum richten die Mädchen und Jungen eine Bude sich auf, einen Jahrmarkt, eine Wartehalle, eine geschützte Rednertribüne – geschützt aber vor wem? – und ein Nichts zieht in ein Nichts, ein Kiosk in Kiosk. Zwei Säle stehen zum Spielen oder zwei Zuschauerräume werden fiktiv sich erdacht. Keine Schwelle, kein Podest, keine Rampe beklemmt. Das Auditorium ist ein gewöhnliches Zimmer nur, ein in die Länge gezupfter Saal, hingeblasen von der Dichte der sitzenden Zuspieler, die das Theater bedingen. Der magische Kreis ist die Lücke, und die Spieler sind bloß durch die Gucker, durch die Gaffer lebig-lebendig. Ihr Herz ist unselbst geschlagen, denn auf dem Markt hat der Schreier gefälligst die Angeschrienen zu befragen, der Redner schaut auf die Massen, und der Wartende wartet auf was. Er wartet auf die Bewegung. „Wie das züngelnde Weich einer angedunkelten Flamme“, sagte dazu der Dichter.
Die Studenten spielen „Die Schaubude“ von Alexander Blok. Aus dem Zimmer haben sie die Stühle geräumt und Kissen auf den Boden gebreitet. Hingegen setzen möchte sich niemand, man bleibt nicht, sondern läuft – hierhin, dahin – umhin, nimmt sich ein Getränk von dem Tisch in der Ecke, grüßt den Professor, dem man einen Rollwagen gab, wie sie Körperbehinderte normalerweise benutzen. An der Tür lehnt André mit einer Drehorgel und brüllt aus der bemalten Visage Bänkellieder zum Flur, über den Clowns, die mit am Hemd angenähten Programmzetteln handständlich purzeln. Am Ende des Ganges ragt ein Wegweiser auf: „Rektorat – Kantine – Jahrmarkt – Toilette.“
Aus der Bude kratzt verstimmte Musik. Der „Autor“ klettert unter dem Vorhang hervor und wendet sich an die Schaulustigen mit einer heftigen Beschwerde über seine Akteure, doch eine kräftige Hand zerrt ihn in die Kulissen zurück. Unvermittelt hallen Paukenschläge, und Musik fliegt wie ein Tiefschlag über die Leute.
Der breite rote Lappen der Schaubühne hebt sich, und ein ovaler Tisch mit lang aushängendem schwarzen Samt und einem goldenen Samowar in der Mitte blickt darunter hervor. In der Tischplatte lugen fünf Löcher, in denen die „Mystiker“ mit Zipfelmützen und weiten Ärmeln einsitzen. Als der Vorhang dann von ober zur Mitte sich senkt, hängt mit grellweißem Gesicht und gesteppten Rüschen Pierrot von dem Szenendach ab. Auf die Bühne tritt Kolombine, und wie vor einer unsichtbaren Kraft fliehend, weicht der Vorhangtüll zur Seite. Das ganze Theater ist frei. – Erschrocken sind die Mystiker mit einem Ruck fort. Bloß die hohen Mützen und ihre leblosen Ärmel bleiben auf dem Tisch von ihnen zurück. Dann, nach einer Weile tauchen die fünf von Neuem auf, und ihre Arme beleben wieder zur Geste: „Der Tod ist erschienen.“ Da springt wie ein Komet blitzschnell Pierrot von der Decke, widerspricht seinen Mitspielern:
„Meine Herren! Sie irren. Das ist Kolombine. Das ist meine Braut.“ – Ein Gesicht schiebt sich vorsichtig unter dem Samt: Es ist Harlekin, und er beginnt seine pantomimische Harlekinade. Eine Beziehung zu dritt spielt sich nun ab – Pierrot, Kolombine, Harlekin. Ein jeder von ihnen bezirzt, verführt, macht dem anderen den Hof, und am Ende ist Harlekin Sieger: Er führt Kolombine mit sich von dannen. Wie eine Puppe zerbrochen indes bleibt der verlassene Pierrot auf dem Boden zurück. – Aus den Zuschauern sprengt André, der Regisseur auf die Bühne, fuchtelt ärgerlich mit den Armen: „Das ist doch nicht so. Diese Schauspieler machen mir alles kaputt. Ich habe es ganz anders probiert. Es ist doch keine Komödie!“ – Die Umstehenden aber stoßen ihn weg, und auf den Brettern schmettert Musik zu dem Ball. Elegante Mädchen in Masken schreiten feierlich vom Korridor in den Raum, stellen sich vor, drehen sich, beugen sich, machen vor den Zuschauerreihen einige Schritte und zeigen ihre Beine und Farben. Dann gleiten sie auf die Bühne, formen sich zusammen zu einem Ring und vollenden danach unter süßen Klängen ihren Tanz.
Jäh aber setzt die Musik aus, die Figuren erstarren in ihren Posen, und in die Stille schallen die Verse von Blok, gesprochen von geheimnisvollen Gestalten, die sich dann auf einmal als verkleidete Jungen aus dem Studienkurs ausweisen. Alsdann singt die Melodie weiter, die Bewegung gefriert wieder abrupt, und die Verse fallen über die schiefen Figuren. Erneut tönt die Musik, hektischer werdend, eskalierend und sich gar zu einem Totentanz wandelnd, der von Harlekin angeführt wird. Mit seinem Zauberstab wischt er über die Rückwand der Bude, so dass der Stoff von dieser zerfetzt, und Kolombine dahinter vor der beklebten schmutzigen Zeitungswand zum Vorscheine tritt. Jetzt aber ist sie wirklich der Tod, mit der Sichel auf ihrem Rücken, und marionettenhaft wankt Pierrot, traurig, seinen Augen nicht trauend, mit ausgestreckten Armen zu ihr. Noch einmal springt Andre, der Regisseur, auf die Bretter, um vergeblich das Stück noch zu retten. Vergebens versucht er, die Hände der beiden Liebenden zu vereinen. Ein schweres Donnern jedoch macht dem Spuk ein unvermitteltes Ende. Kolombine und der Regisseur werden in den Zeitungskiosk verschluckt. Pierrot fällt, getroffen kopfüber vorn über die Rampe. Hinter seinem Rücken aber schließt sich der Vorhang. — Seinen hängenden Kopf zum Publikum drehend, schaut Pierrot – es ist Martin! – bewegungslos lange, Reihe für Reihe streifend, um dann endlich einen letzten Monolog von der Bühne zu deklamieren:
„Ich bin sehr traurig. Und ihr? Könnt ihr denn eigentlich lachen?“ – Er zieht aus der Tasche eine Flöte und fängt an, ein Lied darauf vorsichtig zart zu blasen. Im Raum aber verlöscht langsam das Licht.
Als es wieder aufleuchtet, ist die Szene schon leer. Allein der Tisch mit dem herunterbaumelden Fahnentuch steht noch unter den tief-schlotternden Zeitungsparolen der Decke.
3
Über Neujahr reist Martin mit Lewon nach Jerewan. Sie sind da keineswegs allein auf dem Weg. Viele fahren nach Jerewan Neujahr, fahren nach Hause, fahren irgendwo hin, fahren vergessen, abtreten und den größten Feiertag festen: bloß essen, gut essen, gut trinken, sich ins neue Jahr wachen mit einem wachen und einem traurigen Auge, seine Melancholie tränken, mit seiner Frau wieder in einem Bett liegen, abspannen, schlafen. – Alle Flugkarten sind bereits seit Wochen bestellt, ausgeschrieben, bezahlt, ausspekuliert. Mit einem Studentenausweis kann man außerdem erst 24 Stunden vor dem Abflug Tickets erwerben. – Auf der Warteliste warten Lewon und Martin einen langen Tag über, eine Nacht. „Jerewan können wir in die Wolken verbuchen“, schlussfolgert der Armenier.
„Was tun?“ – Tbilissi ist voll, Baku ist voll – jeder Platz hat wenigstens drei, vier, fünf, die daran zerren; selbst die Notsitze werden überbezahlt. Und die beiden können heuer den Piloten das Wasser nicht reichen: Es fließt zu teuer für sie.
„Wenn es bloß am Jahresende nicht wäre!“
„Zwei Karten für Mineralnyje Wody!“, bietet man da plötzlich marktschreierisch an. Die beiden greifen, ohne zu fragen.
„Wo liegt eigentlich dieser Ort?“, fragt Martin. „Warum nicht gleich Nowosibirsk?“
„Weil es nach Nowosibirsk auch nichts gibt“, antwortet ihm Ljowa gereizt. „Außerdem befindet sich Mineralnyje Wody im Kaukasus, also ganz neben und dicht. Es riecht nach Heimatluft sozusagen wenn du willst, und im Winter hat dort sowieso niemand etwas zu suchen.“ – Freilich in Min-Wody dann stehen sie ratlos und hohl. Der Kurort schläft kurig in Höhen, die frieren, und auch nicht so alleine sind die zwei hier: Sie waren nicht die einzigen Schlauen. „Jerewan bitte?“
„Nichts.“
„Tbilissi?“
„Nichts.“
Nach Stunden wird dann um Sotschi gefeilscht. Man schlägt ein und schlägt zu – es ist die andere Richtung.
„In Sotschi kommen die Züge Moskau–Jerewan durch“, tröstet Lewon, „und das läge für uns auf der Strecke.“ – Doch die Züge sind bereits voll bis zum Knacken, und auf dem Perron warten mindestens noch mal so viel Leute wie bereits in den überladenen Waggons drinnen schon sind. „Das käme uns wohl zu teuer“, meint der Armenier. „Nehmen wir einen billigeren lieber! – Die S-Bahn kostet Kopeken: Sotschi–Suchumi. Das wäre dann sozusagen schon Georgien.“ – Je näher – je weniger Wünsche.
– In Suchumi später sind dann schon einhundert Kilometer auf den Gleisen geblieben und dazu eine sehr lange trostlose Nacht.
„Der nächste Zug nach Jerewan kommt in achtzig Minuten erst an. Wir könnten inzwischen was essen“‚ schlägt Lewon vor. Chinkali – Teig und innen ist Fleisch. –
„Für jeden zehn Stück!“ – Der schnurrbärtige Kellner schiebt die Teller mit den heißen Fleischtaschen und zwei große Bier über den Stand.
„Für mich bitte keins!“, drängt Martin das Getränk von sich fort. Schwerhörig sich gebend aber wackelt der Mann nur schräg mit dem Bart, und das Bier steht wieder bei Sarodnick an der Seite.
„Chinkali isst man zu Bier“, erklärt Lewon.
„Aber ich trinke niemals so enn Zeug!“ – Der Verkäufer wirft einen treffsicheren Blick auf den eigenartigen Gast:
„Fremdsein ist hier keine Entschuldigung.“ – Sarodnick gibt drei Rubel, der Wirt steckt sie lässig ins Hemd und pfeift sich ein Lied.
„Den Rest!“, will Martin noch bitten, doch der Armenier stellt ihm das Bier vor den Mund. So schnell hat Sarodnick noch niemals getrunken. –
Es ist Nacht. Und Georgien. Auf dem Bahnhof in Suchumi stehen gefährliche Schlangen.
„Zwanzig Rubel nach Jerewan“, verlangt der Wagenbegleiter. „Moskau–Jerewan kostet doch nur achtzehn“, denkt Lewon laut und zögert sehr lange. Langsam rollen die heruntergelassenen Fenster der Wagen vorbei. „Wir hatten hier eine große Chance gehabt“, ärgert sich zu spät der Armenier.
Nach zwanzig und zwanzig Minuten kommt der Zug nach Tbilissi. Vor jedem Waggon stehen zehn Leute. „Zehn Rubel!“ –
„Einverstanden.“
Spät bekommt Sarodnick eine Pritsche im dritten Stock, Lewons Stunde aber wird erst nach Kutaissi geschlagen.
„Zehn Rubel mal zehn. Jeder Wagen hat zwei Kondukteure – zehn mal zehn durch zwei …“, kalkuliert Martin hart. „In die eigene Tasche.“ – „Nicht ganz“, widerspricht ihm der Armenier. „Teile mit Freunden! Der Zugleiter, der Stellvertreter. Vielleicht die Direktion. Sein Chef ganz bestimmt. Wer Bescheid weiß, will etwas haben, wer etwas zu sagen hat, bekommt ab. Und für die stille Reserve noch etwas zur Seite: Eines Tages kommt ein Inspektor gefahren … ‚Guten Tag, Herr Inspektor!‘ – ‚Guten Tag, Herr Begleiter! Sie haben fünfzehn Plätze im Wagen zu viel besetzt, aber die nötigen Fahrkarten fehlen dazu.‘ – ‚Ich weiß. Wie viel möchten Sie haben?‘ – Der Inspektor geht zufrieden nach Hause, er hat den Zug kontrolliert. Sein Gehalt reicht nicht aus, will er etwas erreichen, so aber reicht’s. Fünfzehn Waggons. Er teilt’s mit seinem Direktor – versteht sich von selbst. Er hat die Quelle, sein Chef aber kennt sie, deckt sie, trägt das Geschäft und muss womöglich weiter höher noch teilen. So gibt man besser ab. Und dann wird gemeldet: Ich melde: ,Alles in Butter.‘ – Einmal freilich kam einer gefahren, der wollte es nicht: ‚Guten Tag, Herr Inspektor!‘ – ‚Guten Tag, Herr Wagenbegleiter …!‘ – Nein, der grüßte nicht mal, er notierte, zählte, schrieb aus seine Strafen. Die versuchte Bestechung machte es teurer. Dieser unbestechliche Trottel! Mit den vollen Taschen der vollen Strafen kam er nicht mal nach Hause. Unterwegs ist er traurig verschieden: Vergiftung. – Er hätte den gebotenen Tee ablehnen sollen! Strafe geht auf den Magen, geht verdammt in die Kehle – die falsche.
Heute kommen die Inspektoren gefahren, kennen den Tee, ihren Magen, haben in der Tasche nur noch die Angst, und sie ermahnen bloß wie aus Spaß – schließlich gibt es die Regeln, die Formalitäten. Ehrlich währt kurz – jeder will leben.“ – Die im Bahnhof schließen die Schalter, der Wagenbegleiter verdient sich die Nacht um die Ohren, und Lewon und Sarodnick sind in Tbilissi. Endlich. –
„Es ist warm“, merkt Martin und knöpft sich das Hemd auf.
„‚Tbili‘, die warme Quelle – man konnte eine Kuh darin kochen oder fünfzigtausend Georgier im Jahre 853“, erzählt Ljowa Geschichten. – Die Häuser scheinen steil in die Kura zu fallen und klammern sich an ihren geschnitzten Balkons. Wie Loggen sind die, und unter Bögen gehüllt, verstecken sie Stein, geben den Bittergeschmack unter der Decke. Während anbei süß auf der Landzunge Metechi – ein Fenster mit ornamentalem Kreuz und Quadrat – als trauriges Auge verflacht.
„Eine Zunge ohne den Gaumen“, meint Ljowa schlau. „Den haben die Mongolen verschluckt. Den Palast und die Vorkirche noch zu. Narikala aber hat es vergessen; hätte er sonst überleben können en face, Gesicht in Gesicht?“
„Die Mongolen. Was hat Gorgosali damit zu tun?“, fragt Martin. „Auf dem Pferd! In die Quelle gerutscht.“ – Die Kura feuchtet die Schrägen zu krummen Terrassen, fürchtet den Ritter und seine erhobene Hand.
„Mit ihm beginnt die neue Geschichte“‚ sagt der Armenier.
Im Netz. Das andere bleibt in den Trümmern.
„Und die Ikone aus Antschi?“, fragt Martin und zeigt auf die Antischisschati-Kirche am Ufer.
„Sie ist der Mutter geweiht“, antwortet Ljowa. Geweiht und entstellt. Ein kaustischer Heiland ist vom Himmel gestiegen: Dreischiffig gewölbt, ohne Emporen – ein schleifendes Kreuz wie das Bild, das aus ihr genommen. Die Mutter ist in der Flamme nur Wachs.
„Danach kam Arabien … Und die Quellen, die heißen, in denen Fleisch und Gemüt zum Kochen gebracht wurden. Eine kühle Endung kam zu: ‚Tbili-ssi‘. – Da ist es auch genießbar geworden.“ –
Auf den großen Boulevards, auf dem Rustaweli trinken sie Wasser mit Himbeergeschmack – für alle Geschmäcker. Wertlos gießt Martin sich ein, um die Schärfe der Tschachochbili zu dämpfen, die Ungewissheit wohl auch: „Fahren wir irgendwann ab?“
So spazieren die zwei die totgeschlagene Zeit zwischen die Häuser, um des Abends zu harren, des Zugs. Auf dem Bahnhof liegt Warten in Haufen – zum Umdrehen ist da kein Platz. Man steigt über, auf Bänken, darunter; auf den Boden sind Menschen gestreut. Man steigt über lebende Leichen. „Bloß der Tod hat es eilig. Erst schlafen einmal!“
Eine Zigeunerin presst Sarodnick einen Kasten an seine Brust: „Dein Schicksal! Ich spiele es dir.“ – Schicksalsverstrickt stecken kleine Zettel darin, und ein Papagei ist die Zaubermaschine. „Ein Rubel!“ – Drei Mal streicht die Frau den Vogel über die Rätsel und drückt ihn dann in ein Fach. Im Schnabel steht Martins Schicksal geschrieben: „Suche dein Glück von der anderen Seite.“
– Ein kleiner Junge bietet Fahrkarten an. „Falsche natürlich“, ahnt Ljowa, der vorweislich ahnt. Die Schalter sind alle geschlossen. Ein Mann verlangt dreißig Rubel für echtebis Jerewan. Lewon indes kann beim armenischen Wagenbegleiter den Preis günstig gestalten: zehn Rubel.
„Das hätten wir von Suchumi aus schon haben können“, ist Sarodnick schadenfreudig erbost.
„Was man hat, hatte man nicht“, antwortet Ljowa. „Ohne Preis keine Weis.“
Am frühen Tag sind sie endlich zu Hause, und der Tuff lässt das Morgenrot rosig erscheinen. Es ist der 31. Dezember. – Ljowas Eltern wohnen in Jerewan in einem normalen Haus mit normalem Standard und ungewöhnlichen Leuten: Regierungsmitglieder, Mitglieder, Mitarbeiter von nicht genannten Organisationen, Ungenannte, Ungenannt-bleiben-Wollende, Nicht-Wollende.
„Ich freue mich, Sie endlich wiederzusehen“, drückt der Vater lautstark Martin die Hand. Er hat seinen politischen Weg ohne eigene Wohnung gelegt, ohne Vater und Mutter, mit eigenem Rücken, schmerzend vom Weiterkommen. Aus der neuen Generation – nach den 26 Kommissaren und den Hunderten Häschern danach – wär er fast selber gefasst worden, wenn das Alter nicht wäre. Zu jung war er, noch nicht aus den Kinderschuhen gewachsen, um ihm die Schuld in die Schuhe schieben zu können. Die Maße hatte er sich alleine genommen, hat politische Ökonomie studiert und alsdann einen Großbetrieb im Norden des Landes regiert. Später rief man ihn nach Jerewan, machte ihn zum stellvertretenden Wirtschaftsminister, danach Minister für Sport und endlich für die Kultur. Er ist ein Kulturmensch, ein Mensch mit Sinn für Verstand, mit einer bestimmten Ästhetik. „Das Land wird nach vorne gekurbelt über Vergangenheitsdrang“, sagt er zu Martin. „Es wird in die Erde gewühlt. Die Zeit wird gesammelt und alsdann rausgestampft wieder. – Hast du die Lieder des Aschuchs gelesen? Das sind drei Jahrtausende Leid. Es ist in die Steine geflossen, und ich versuche, dies zu Erinnerungen zu schichten – die alte Kultur zwischen drei Meeren: Griechen, Römer, Perser, Iberer, Araber, Seldschuken, Mameluken, Mongolen und Türken –, der Todesgang, der Tod unter den Füßen, der Tod in eine Grenze gefetzt. Enver Pascha und Tala’at Pascha haben sich zum Henker gekrönt, und bei euch in Berlin hielt man sich vor Entsetzen den Mund: Eine Million für diese Totenstille gab es in bar. Hundepascha – Hunde sind für ewig verfolgt. Aus den Gräbern graben wir Tränen. Araber, Mongolen, Perser, Seldschuken. Aus den aufgesammelten Knochen formen wir einen Menschen. Den Menschen von Haik. In der Berginsel zwischen Taurus, Antitaurus und Kaukasus.“
In der Küche dampft es vor Eifer. Ljowas Mutter hat eine Verwandte bei sich, und die Frauen füllen die Töpfe, das Feuer, Aroma. Der Tag ist aus Rezepten geschrieben – jeder hat seine im Kopf.
Dunkelschön ist die Mütter, kräftig, der Berge Kraft, kraft dieses Landes – sie hat drei Kinder geboren, drei Söhne. Die schwarzen Haare zum Knoten gebunden, lächelt sie bescheiden devot: „Der Freund meines Ljowotschkas.“ – Ein leichter Akzent summt mit in der Stimme: Sie ist bis zum Fuße armenisch. Und sie küsst ihren Sohn auf den Mund: „Esst wenigstens eine Winzigkeit hier!“ – Alles scheint winzig, fipsig und lütt, und immer gibt man schließlich klein bei. „Einen kleinen Salat, ein kleines Stück Fleisch, ein kleines Stück Kuchen, ein kleines Glas Wein!“
Am Abend dann ist die richtige Tafel gedeckt, man geht hinein in das Fest und schlemmt für Tage darin. Tolma, weiße Bohnen, Weißkrautsalat mit Oliven, Gemüsesalat, Spinat mit Nüssen, Bosbasch, Musaka mit Kürbis, Muntapur, Hammel mit getrockneten Aprikosen, Schaschlik, Kalbfleisch mit gebackenen Tomaten. Kuchen und Süße und Gata, Nasuk, Bagardsh und Nschablit. Martin bekommt den Mund nicht mehr zu. Und Weißwein und Rotwein und Wodka und Kognak und Sekt laufen schwer auf den Grund, der schon lange besetzt ist wie die Toilette, die leichttürig wie Schall sich direkt neben der Küche befindet. „Der beste Kognak …“ – Drei Sterne, vier Sterne, fünf … – je weiter man trinkt. „Der beste der Welt.“
– „… weil das Holz alt ist und speziell“, erklärt der Vater, „weil der Großvater es von seinem Großvater hat. Ein Handwerk, der den goldenen Boden bewahrt bis in die ewigen Gründe.“ – Ewige Sprüche. Die kaukasischen Trinksprüche sind Anfang und Ende.
„Wir trinken auf die Mutter … auf die Kinder … auf die Hüter Armeniens, berghoch, da, wo einst der große Stalin sich zum Monument hob und stürzte wie Nichts in den Abgrund“, predigt der Vater und trinkt mit allen im Chor. „Manche fremden Zungen aber behaupten, er wäre nur in den Sockel gerutscht, und einmal wird er wieder nach oben geleiert.“ – Die alte Leier, die gefährliche Leier … „Auf die Mutter Hayastans! Oder auf den bastardierten Vater gestrichen, den byzantinischen falschen Theologen, Seminaristen, Prschewalskiabguss und Alanenverspross, auf das reinste grusinische Giftkraut, welches je aus dem Schoße geschlüpft, unzeitgemäß! – Wir trinken auf das, das es nie wieder! Nie wieder gute Worte gute Worte nur sein!“ – Eine Phrase perlt eine andere, und natürlich bleibt es dabei, bei dem Wort, von dem viele gesprochen – von unten bis oben hinauf.
„Im Namen der Worte sind Menschen gefallen, im Worte des Friedens, der Freiheit, der Menschlichkeit – mit dem Ellbogen über das Maul –, und Mäuler sind mit Zangen gekniffen – der Schrei! –, die armenische Tragödie, die menschliche Tragödie gesamt. – Alles ist menschlich, alles menschliche Vernichtung, alles verzeihbar. In Worten. Über die Berge der Schall. Verhallt. Über den Bergen dort ist die Mutter, und auf die Schultern des anderen Menschen laufen Tränen entlang. Irgendwann hebt sich die Schulter und drückt die Mutter ins Grab: ‚Zurück! Von dort kommst du her!‘ – Die Vormütter werden aus dem Schoße verstoßen. Auf die Berge. – Das unsere Kinder glücklicher werden als wir!“
„Stellt eine neue Flasche über die Tafel!“ – Hände fassen sich hinter dem Tisch, Schultern umarmen die Brust. Dann, wenn auf die Frau, auf das andere Geschlecht angestoßen wird, schlüpfen flink, mit dem Halbmond der Geste, die Geschöpfe aus der Küche in den Saal, heben befriedet, schamtemperiert, das ihnen gereichte Glas und nippen, mit Glanz in den Augen, wie am Spielzeug daran. Hernach sind sie wieder aus dem Sinne gewandelt, lange, bis zum nächsten und nächsten. Das neue Jahr ist im Ganzen eine Männergeschichte, im Großen die Arbeit der Frau.