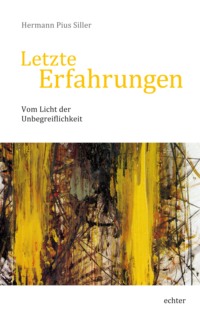Kitabı oku: «Letzte Erfahrungen», sayfa 5
Schleiermacher
Eine so durchgreifende Strömung wie der Liberalismus lässt natürlich auch das Christentum und die Theologie nicht unberührt. Selbst an der katholischen Kirche und Theologie ging sie nicht spurlos vorbei, nicht in England, nicht in Frankreich, Holland, Italien und Deutschland. Der Modernismus und die Reaktionen von Pius IX. und Pius X. waren nur die deutlichsten Zeichen. Die antiliberale Signatur der römischen Kurie war so nachhaltig, dass man sich das bis heute fast nicht anders vorstellen kann. Andererseits zeigte das Zweite Vatikanische Konzil, dass sich die katholische Kirche wesentliche Anliegen des Liberalismus längst zu eigen gemacht hat; ohne dass freilich die liberalistischen Frontstellungen, die an der Kirche ständig hochgezogen werden, seltener werden. Dabei hatte die Theologie eine große Blüte des Liberalismus zuerst in der deutschen protestantischen Theologie des 19. Jahrhunderts hervorgebracht und dadurch selber zum Liberalismus einen wesentlichen Beitrag geliefert. Die historisch-kritische Bibelwissenschaft stand dabei über weite Strecken im Vordergrund. Eine andere, vornehme und bis heute nachhaltige Antwort auf den Liberalismus hat Friederich Schleiermacher formuliert. Ich will versuchen, ihn in seiner zentralen Denkfigur kurz zu kennzeichnen.
Der spätere Schleiermacher schreibt zum erstenmal eine Dogmatik als Darstellung des „christlichen Glaubens“, also nicht direkt der Glaubensinhalte; das meint, dass diese Dogmatik sich zwar an die Grundsätze der evangelischen Kirche halten möchte, aber sie entfaltet weniger ihre Lehre, als vielmehr die Auffassungen davon in den „christlichen frommen Gemütszuständen“58. Schleiermacher sucht eine Rekonstruktion der christlichen Religion aus der kirchlichen Frömmigkeit. Diese ist weder ein Wissen noch ein Tun, sondern eine Bestimmtheit des „Gefühls“ oder – was damit gemeint ist – des „unmittelbaren Selbstbewusstseins“.59 So kommt Schleiermacher zu einem maßgeblichen Leitsatz, an dem sich seine Theologie orientiert: Religion ist das „Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit“, das „Betroffensein durch das Transzendente als Unendliches und Unbedingtes“60. „Gefühl“ darf freilich nicht sentimental missverstanden werden. Nach Steffens definiert es die Auffassung der unmittelbaren Gegenwart „des ganzen, ungeteilten Daseins“61. Schleiermacher charakterisiert die möglichen Sätze einer Glaubenslehre als Beschreibung menschlicher Lebenszustände. Alle Aussagen über die Welt und unser Handeln haben darin ihre Grundbedingung. Die Beschreibung der menschlichen Zustände ist für Schleiermacher die dogmatische Grundform. Alles andere ist nur zulässig, sofern es sich aus Sätzen dieser Grundform entwickeln lässt. „Wenn nun alle der christlichen Glaubenslehre angehörigen Sätze in der Grundform unstreitig ausgedrückt werden können und Sätze, welche Eigenschaften und Beschaffenheiten der Welt aussagen, doch erst auf Sätze von jener Form zurückgeführt werden müssen, … so scheint es, dass die christliche Glaubenslehre nur jene Grundform folgerecht durchzuführen habe, um die Analyse der christlichen Frömmigkeit zu vollenden.“62 Die Sätze müssen in Formeln für bestimmte Gemütszustände umformuliert werden, denen innere Erfahrungen entsprechen. So scheint mir, dass bei Schleiermacher das kirchliche Glaubensbekenntnis sein Kriterium und seinen verbindlichen Auslegungshorizont in der Beschreibung eines anthropologischen Zustandes, eben in einer „Erfahrung“ haben.63
Newman hat Schleiermacher und die deutschen liberalen Theologen selbst nicht gelesen, aber er hat die liberale Theologie in ihrem Grundriss adäquat verstanden. Er nimmt in ihr eine paradoxe Verwandtschaft mit den Evangelikalen wahr.64 Von den Evangelikalen sagt Newman: „Der Glaube oder die geistliche Gesinnung wird als Ziel der Religion angesehen. Der größere Nachdruck liegt auf dem Glauben statt auf dem Gegenstand des Glaubens, auf dem Trost und auf der Überzeugungskraft der Lehre statt auf der Lehre selbst.“65 So kommt es, „dass die Religion mehr in der Selbstbetrachtung als in der Betrachtung Christi bestehe; dass sie nicht einfach auf Christus schaue, sondern auf unsere Gewissheit.“66
Der Liberalismus belässt es nicht bei dieser evangelikalen Veränderung der Blickrichtung auf den geistlichen Nutzen, sondern formuliert daraus eine Kritik der Offenbarung, sowohl der biblischen Tradition als auch der Lehre. In der Biglietto-Rede lautet Newmans Darstellung der liberalen Theologie so: „Geoffenbarte Religion ist keine Wahrheit, sondern eine Sache des Gefühls und des Geschmacks, sie ist kein objektives Faktum, gehört nicht in den Bereich des Wunderbaren. Jeder einzelne hat darüber hinaus das Recht, ihr die Aussagen zuzuschreiben, die ihm gerade an ihr gefallen. Frömmigkeit gründet nicht notwendig auf Glauben.“67 So hat Newman wohl als einer der frühesten ernst zu nehmenden Kritiker die liberale theologische Denkstruktur deutlich erkannt und exakt angesprochen, ein halbes Jahrhundert vor dem großen Schleiermacherkritiker und Schleiermacherbewunderer Karl Barth.68
Wie bewältigt Newman den Liberalismus theologisch? Ich wiederhole: Der theologische Liberalismus war ihm zwar in seiner deutschen Version nicht unmittelbar vertraut, wohl aber die englische Variante aus seiner Zeit am Oriel. Diese Form des Liberalismus bestimmte zeit seines Lebens befruchtend und kritisch sein theologisches Denken. Um dies zu verdeutlichen, halte ich mich an eine Predigt, die er am 5. April 1835 gehalten hat,69 und suche in vier Abschnitten darüber zu meditieren, jedenfalls nicht historisch zu argumentieren.
Du, o Gott, siehst mich
„Geradeso ist es heute mit uns“ – ich zitiere aus der Predigt –. „Man spricht wohl im allgemeinen von Gottes Güte, seinem Wohlwollen, seinem Mitleid, seiner Langmut; aber man stellt sich dies vor wie eine Atmosphäre, welche die Welt umhüllt, oder wie sich das Sonnenlicht über das ganze legt – nicht wie eine sich stets wiederholende Tätigkeit eines wissenden, lebendigen Geistes, der sich bewusst ist, wem er sich kundgibt, und mit seinem Wirken auf etwas hinzielt. Darum wissen die Menschen, wenn sie in Trübsal geraten, nichts anderes zu sagen als: ‚Alles ist zum Guten, Gott ist gut‘ und dergleichen mehr, und davon fällt nur ein frostiger Trost auf ihre Seele, der ihre Leiden nicht mindert.“
Newman holt uns genau dort ab, wo wir liberalen Christen uns vorzüglich aufhalten: in einer unpersönlichen Atmosphäre, in einer Weltanschauung. Eine Person, ein fremder Wille, der uns behaften und „fremd bestimmen“ möchte, bleibt ausgeklammert. Solange wir dabei bleiben, kann uns Gott nicht als freier, als liebender erscheinen. Mit der Formel „Gott ist gut“ „entwaffnen“ wir ihn und definieren ihn funktional zu unseren Bedürfnissen, ohne ihn in seine Souveränität wieder frei zu geben, die Gott überhaupt erst ausmacht. Die Selbstmächtigkeit und Selbstzufriedenheit dieser Atmosphäre hat etwas von der Kühle an sich, der auch auf den Systemen wie Markt, Verwaltung und Information liegt.
Auf den liberalen Adressaten geht Newman auch mit der Erzählung von der Hagar aus der Abrahamsgeschichte zu: „Als Hagar vor ihrer Herrin in die Wüste floh, hatte sie die geheimnisvolle Erscheinung eines Engels, der sie zurückkehren hieß. Zugleich aber mit diesem unausgesprochenen Verweis für ihre Verzagtheit sprach er zu ihr ein Wort der Verheißung, sie zu ermutigen und sie zu trösten. In der Mischung von Beschämung und Freude, die sie empfand, erkannte sie die Gegenwart ihres Schöpfers und Herrn, der sich den Seinen stets in dem zweifachen Lichte kundgibt: einem strengen, weil er heilig ist, und einem milden, weil er von überfließender Erbarmung ist. Darum rief sie zu ihm, der sich ihr kundgetan hatte: ‚Du, o Gott, siehst mich‘ (Gen 16,13).“ Newman will sagen: Der Engel mahnt nicht „Richte deine Augen auf Gott“, sondern er stellt an den liberalen Adressaten eine ungeheure Zumutung: Du stehst in Gottes Aufmerksamkeit, er ist gegenwärtig, er sieht dich. Das ist ein Trost von anderer Qualität. Der Trost lautet nicht: Gott steht deinen Bedürfnissen zu diensten, wenn du deinen Blick auf ihn richtest. Sondern dir zuvorkommend hat er sich dir schon längst zugewandt. Nur weil er keine funktionale Verlängerung deiner Bedürfnisse ist, er also einen dir gegenüber souveränen Willen hat, nur deshalb ist er von unausdenkbarer überfließender Erbarmung.
Um das Gewicht von Newmans Redeweise zu ermessen, stelle ich der Hagar-Erzählung eine andere Erzählung gegenüber. Sartre erzählt in seiner Autobiographie „Les Mots“70: „Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versengt; ich war im Begriff meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes und auf meinen Händen; ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut: ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit, ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an.“ Was war das für ein Sehen, das der kleine „Liberale“ Jean-Paul nicht ertrug, das er abschüttelte, um sich nicht verloren geben zu müssen? Er fühlte sich als Zielscheibe.71 Dieses Gesehenwerden von seiten anderer wird „liberal“ erfahren als Bedrohung der Selbstbestimmung und der Unabhängigkeit. Es kränkt die Würde des autonomen Subjekts. Es erwartet von ihm keine Zukunft, sondern legt auf Vergangenes fest. Hagar erfährt dieses auf sie gerichtete Sehen anders, nämlich als den eigenen Wünschen, Vorstellungen und Bemächtigungen entzogen und gerade so als befreiend. Sie erfährt es als erneute Zuwendung, als Chance, einen falschen Weg zu korrigieren, als vergebend, als Einweisung in einen neuen Anfang. Sie sieht sich heimgesucht, nicht übersehen, nicht vergessen, sondern gewürdigt.
Um die Bedeutung des Ausrufes „Du, o Gott, siehst mich“ nochmals weiter zu explizieren, will ich eine phänomenologische Annäherung versuchen. Der phänomenologische Blick lautet: „Ich sehe dich.“ Die phänomenologische Perspektive hat einen Standpunkt, einen umgrenzten Horizont, einen Ausschnitt von Sichtbar-gemachtem aus einer größeren Menge von Nicht-sichtbar-gebliebenem. Das „ich sehe dich“ reduziert, weil es anderes verbirgt und verschließt. Die dabei leitende Intention wählt aus und konstituiert eine Vorstellung, projektiert eine Gestalt. „Ich sehe dich“ heißt immer auch: „Ich mache mir ein von anderen unterschiedenes Bild von dir“. Und: „Ich wirke an einem Bild von Dir mit“, „Ich mache das Bild“. Dabei dürfte die Schwierigkeit des Gesehenen bleiben, sich in einem Bild, das ein anderer von ihm macht, wiederzufinden und sich als dieser anzuerkennen. Die Differenz potenziert sich noch, weil auch das Selbstbild dessen, der sich von einem anderen gesehen weiß, nur ein Ausschnitt seiner Wahl, ein Projekt ist, das ihn nicht erschöpft. Es stoßen also zwei Konstrukte aufeinander: das Bild, das ein anderer von mir macht, und das Bild, das ich selbst von mir mache. Auf diesem Hintergrund ist die Erfahrung zu sehen, die in dem Ausruf laut wird „Du, o Gott, siehst mich“. Was Hagar erfahren hat, ist, dass Gottes Sehen, anders als ein endliches Sehen, nicht den begrenzten Standpunkt eines selektiven Sehens einnimmt; es abstrahiert keinen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Gottes Sehen erfasst über alle reduzierten Selbst- und Fremdbilder hinweg mich in meiner auch für mich selber und für jeden anderen unüberschaubaren Komplexität. Er erkennt mich in meiner komplexen und umfassenden Bedingtheit durch viele andere, in einer von vielen mitgestalteten und einer von mir selber mitgestaltenden Lebensgeschichte. Das ist die Erfahrung, die in dem Wort Providenz angesprochen wird. Gottes Providenz ist äußerst konkret und konkretisierend, gerade weil sie umfassend ist. Das dürfte die beglückende Einsicht Newmans sein. Der Glaube, unter Gottes Augen zu leben, kann sich deshalb in dem befreienden Ruf Luft machen: „Du, o Gott, siehst mich.“ Früher als mein Sehen ist: Ich bin gesehen. Der Glaube an dieses Sehen, an die Providenz ist imstande, sich von den immer verkürzten Selbst- und Fremdbilder zu distanzieren, die eigenen oder von anderer Seite zugedachten Lebensprojekte in Klammer zu setzen oder vom Sockel zu stürzen. Der Glaube an die Providenz öffnet definitive Verstehensweisen, verunsichert Selbstbilder und Fremdbilder, schafft Bereitschaft, Neues und Anderes für möglich zu halten, auf Rufe und Winke zu merken. Der Glaube, dass Gott mich sieht, realisiert, dass ich noch einmal anders bin, als andere und ich selber es für möglich gehalten hätten.
Zutiefst ist Providenz eine Sache der erwählenden Freiheit. „Du, o Gott, siehst mich“ heißt: „Ich stehe in Deiner Aufmerksamkeit“, „Ich vertraue mich Deinem Willen an“. Darin sieht Newman wohl ein dem Liberalismus entgegengesetztes Freiheitsverständnis impliziert. Nicht Freiheit als eine nur abstrakte Autonomie, sondern als ein kommunikativer Akt, in dem einer für den anderen in einer konkreten Situation gegenwärtig ist, ihn freigibt, ihn anerkennt, ihm Raum und Zeit gibt, ihn auch gegen sich aufkommen lässt, gerade darin dann aber auch selbst seine Identität gewinnt. Vielleicht kommt der Erfahrung Newmans am nächsten die Metapher von dem unter den Augen der Mutter spielenden Kind. Ein Providenzbegriff, der von diesem „Du, o Gott, siehst mich“, ausgeht, zielt weckend, berufend, orientierend auf praktisches Verhalten. Vielleicht wird man sagen können, dass Newman Providenz in Beziehung zu dem denkt, was Kant Praktische Vernunft nennt, und was er selber in der Phronesis bei Aristoteles findet.72
Der uns teilnehmend behütet
Newman macht Providenz denkbar konkret: „Als der ewige Sohn in unserm Fleisch auf Erden erschien, sahen die Menschen ihren unsichtbaren Herrn und Richter; er offenbarte sich nicht mehr bloß im Walten der Naturkräfte oder in dem verschlungenen Lauf der Menschheitsgeschichte, sondern er offenbarte sich wie einer von uns: ‚Gott, der aus der Finsternis Licht aufgehen ließ, hat auch unsere Herzen erleuchtet, dass uns das Licht der Erkenntnis Gottes im Antlitz Jesu Christi leuchte‘ (2 Kor 4,6), also in sichtbarer Gestalt eines persönlichen Einzelwesens. Es war in gewissem Sinn eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht.“
Wir sind gewohnt, die Providenz in eine immer noch relativ für sich stehende Gotteslehre einzuordnen, und außerdem denken wir in der theologischen Christologie – anders als Newman – stärker „antiochenisch“, nehmen also eine betonte Trennung zwischen Gott und dem sogenannten „historischen“ Jesus vor. Die Sprache Newmans erscheint uns dann als anthropomorph. Providenz als die Zuwendung der „erbarmungsvollen Liebe unseres Heilands“ in ihrem Eingehen auf den Lazarus und seine Schwestern, auf Petrus, Thomas, Johannes, Judas, den reichen Jüngling. Aber Newman spricht und denkt, vielleicht angeleitet durch die Kirchenväter, theologisch genauer. Providenz als die Aufmerksamkeit des „Du, o Gott, siehst mich“ wird in Jesus unerhört konkret, wenn sie als Begegnung mit Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen wird. Thomas von Aquin hat im Erbe der Väter die Menschheit Jesu Christi noch als „Instrument“, als Organ der Gottheit auffassen können.73 Uns ist diese Kategorie trotz aller von Thomas angebrachten Korrekturen zu mechanisch und instrumentell. Vielleicht könnten wir, Newman erläuternd, besser mit Karl Barth sprechen: Er ist der Erwählte und der Erwählende, der Berufene und der Berufende, der Geliebte und der Liebende, der Vorgesehene und der Vorsehende. In seinen Augen begegnen wir der uns vorsehenden Aufmerksamkeit. Wir leben bei Jesus in Gottes teilnehmender Providenz. Das Kreuz bliebe ein magischer Totempfahl, wenn uns von dort aus keiner sehen würde.
Im Walten der Naturkräfte und im verschlungenen Lauf der Geschichte
Ich knüpfe nochmals an den eben zitierten Text an: „Er offenbarte sich mehr als bloß im Walten der Naturkräfte oder im verschlungenen Lauf der Geschichte der Menschheit, sondern er offenbarte sich wie einer von uns.“ In der ganzen Predigt Newmans ist wie selbstverständlich von der Kreatur und Geschichte umfassenden Providenz die Rede. Darin impliziert ist die über den christlichen Glauben hinausreichende Überzeugung, dass in der Weltgeschichte Allgemeines herrscht, das sich – wie Newman sich ausdrückt – auf der Linie der Wahrheit und Gerechtigkeit bewegt und kein Ansehen der Person kennt. Auf dieser Ebene wird allerdings noch „nicht wirklich erfasst, dass wir in Gottes Gegenwart sind“ oder mit anderen Worten aus der hier ausgelegten Predigt: „Wir glauben nicht innerlich, dass er uns sieht.“ Vielleicht dürfen wir es uns, wie bisher schon, erlauben, Newmans Gedanken dort weiter zu denken, wo sie sich eigentlich schon immer bewegen, nämlich auf dem Boden der Gnadenlehre. Er setzt mit den älteren Kirchenvätern so etwas wie eine allgemeine Gnadenbestimmung voraus, eine alle übergreifende Erwählung. Dann aber ereignet sich dort, wo wie bei Hagar das Bewusstsein von der persönlichen Nähe Gottes aufbricht, eine besondere, kategoriale Heilsgeschichte. Da tritt für einen Moment ins Tageslicht der Geschichte, was so klar und zentral sonst nicht ins Bewusstsein tritt, wozu sich aber jeder auch ausdrücklich verhalten kann und irgendwann auch muss. Hier wird das Aufmerken auf Gottes Sehen, also das Sehen von Gottes Sehen möglich. Sehen wird reziprok.
Theologisch wäre dann festzuhalten: Die Lehre von der allgemeinen und besonderen Providenz hätte bei Newman nicht wie in der Summa Theologiae des Thomas ihren Ort in der Gotteslehre74, sondern wie in der seiner Summa contra gentiles75 innerhalb der gnadenhaften Finalisierung der Wirklichkeit. Bei Newman und bei Thomas in der Summa contra Gentiles ist sowohl die allgemeine Providenz wie auch die besondere Providenz final bestimmend und macht so jetzt schon aufmerksam auf die führende Präsenz Gottes.
Die besondere, also geschichtlich-kategorial greifbare Providenz in ihrer unübertreffbaren Deutlichkeit in Jesus Christus zielt nicht elitär auf eine besondere Auswahl. Sie beruft vielmehr zum Dienst in der allgemeinen, also universalen Providenz. Das also ist das Mehr der kategorialen Geschichte: Es geschieht ein Ausbruch aus der Blindheit und Befangenheit, aus dem einseitigen, anonymen, Bestimmtsein. In der Öffentlichkeit wird Reziprozität sichtbar. Was schon in der allgemeinen Providenz jedem geschenkt ist, bekommt nun einen deutlichen Ort in der Geschichte. Auch bei Hagar kommt die Reziprozität der Providenz ans Licht. Sie weiß nun klar, dass sie gesehen ist; das heißt: Providenz wird für sie denkbar, sagbar und erzählbar. Ein „Leben unter der Providenz“ ist damit überhaupt erst biographisch darstellbar.
Die keinen Sinn ihres Daseins finden können
Ein Schlüssel des liberalen Bewusstseins ist der Begriff „Sinn“. Die Frage nach dem Sinn steht in Korrelation dazu, ob sich einer als Subjekt begreift. Das individuelle, liberale Bewusstsein sieht sich durch die Wirklichkeit in der Weise herausgefordert, dass es für diese eine Rechtfertigung suchen muss. Wirklichkeit muss sinnvoll sein. Sinnvoll aber ist für das neuzeitliche Subjekt, was verständlich und begreifbar ist, vor allem aber was verfügbar und machbar ist. Wenn sich die Wirklichkeit diesem verfügenden Anspruch verweigert, droht das Subjekt in den leeren Abgrund der Sinnlosigkeit und Verzweiflung zu stürzen. Nun verweigern sich aber gerade die schwerwiegenden Kontingenzen der Lebensgeschichte und die Katastrophen im Gang der Weltgeschichte dem Tribunal der Vernunft und ihrem Sinnpostulat. Sie sind unverfügbar. Die Alternative dazu scheint dann nur die Abschaffung dieser unsere Vernunft beleidigenden Wirklichkeit oder die Auslöschung der nach Sinn verlangenden Vernunft zu bleiben.
Wie geht Newman mit diesem Sinnbegriff um? Er fragt in seiner Predigt: Was kann der Christ denen sagen, die der Wirklichkeit einen solchen Sinn nicht abgewinnen können? „Tiefer empfindende Menschen würden von Mutlosigkeit erfasst und selbst des Lebens überdrüssig werden, müssten sie sagen, sie unterständen lediglich dem Walten starrer Gesetze und hätten keinerlei Möglichkeit, einen Blick von jenem zu erhalten, der diese Gesetze gab. … Was sollten vor allem solche denken, die mit Menschen zusammenleben müssen, die ihr Inneres nicht verstehen können, … oder solchen, die in innere Schwierigkeiten geraten sind, die sie sich selbst nicht erklären, geschweige denn lösen können, … oder die keine Aufgabe für sich erkennen können und keinen Sinn ihres Daseins finden können und anderen im Wege zu stehen glauben.“ Newman spricht damit die Rechtfertigungsansprüche des liberalistischen Subjekts an die Wirklichkeit an und weist überzogene Sinnansprüche zurück. Wir werden inne werden müssen, dass die Vernunft weiter zu spannen ist, dass wir noch andere sind als nur Verfügende und Begreifende, dass es daneben die radikalere Möglichkeit gibt: sich vertrauensvoll fügen zu können. Es kann durchaus sinnvoll und vernünftig sein, sich dem unbegreifbaren und unverfügbaren Geheimnis zu überantworten. Es kann sinnvoll und vernünftig sein, sich in der Aufmerksamkeit Gottes zu erfahren. Die anthropomorphe Vorstellung eines beobachtenden Gottes, der den Menschen kühl und unbeteiligt zusieht und von außen in den Gang der Geschichte gelegentlich eingreift, ohne die Faktoren, die Geschichte machen, einzubeziehen geht an dem, was Newman unter Providenz versteht, vorbei. Providenz meint, dass das Geheimnis der Schöpfung und der Geschichte ein wissendes und beteiligtes Geheimnis ist. Man könnte, wenn man von dem anthropozentrischen Bedeutungsgehalt von „Sinn“ abstrahiert, statt Providenz auch sagen, Schöpfung und Geschichte haben einen eigenen Sinn, der uns entzogen ist.
32 Karl-Otto Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik: Können die Rationalitätsdifferenzen zwischen Moralität, Recht und Politik selbst noch durch die Diskursethik normativ-rational gerechtfertigt werden?, in: Karl-Otto Apel / Matthias Kettner (Hg.), Zur Anwendung der Diskursethik in Politik, Recht und Wissenschaft, Suhrkamp Frankfurt a. M. 1992, 29–61, hier 47.
33 I. Kant, in: Werkausgabe, Frankfurt a. M. 1964, Bd. VI, 34–50.
34 Ebd. 38.
35 Ebd.
36 Ebd. 47.
37 Ebd. 48.
38 Ebd. 49.
39 John Burke, Betrachtungen zur Französischen Revolution, in der Bearbeitung von Friedrich Gentz, Berlin 1793, hrg. von Hermann Klenn, Akademie Verlag Berlin 1991.
40 Hannah Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Piper München 1991.
41 Ebd. 455. Vgl. Sabine Rothemann, Aufweichung der Menschenrechte. Zur Aktualität von Hannah Arendt, in: Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte 12/ 2005, 60–63.
42 Karl-Otto Apel, Das Anliegen des anglo-amerikanischen ‚Kommunitarismus‘ in der Sicht der Diskursethik. Worin liegen die ‚kommunitä-ren‘ Bedingungen der Möglichkeit einer post-konventionellen Identität der Vernunftperson?, in: Micha Brumlik / Hauke Brunkhorst (Hg.), Gemeinschaft und Gerechtigkeit, Fischer Frankfurt a. M. 1993, 149–172, hier 156.
43 Ebd. 169.
44 Karl-Otto Apel, Diskursethik vor der Problematik von Recht und Politik [Fn. 31], 36.
45 Ebd.
46 Ebd. und 46.
47 Ebd. 60.
48 Odo Marquard, Ende des Schicksals? Einige Bemerkungen über die Unvermeidlichkeit des Unverfügbaren, in: ders. Abschied vom Prinzipiellen, Reclam Stuttgart 1981, 67–90, hier 69.
49 Gotthold Ephraim Lessing, Die Erziehung des Menschengeschlechts, in: ders., Die Erziehung des Menschengeschlechts und andere Schriften, Reclam Stuttgart 1965, 29; vgl. dazu: Arno Schilson, Geschichte im Horizont der Vorsehung. G.E. Lessings Beiträge zu einer Theologie der Geschichte, Grünewald Mainz 1974.
50 Immanuel Kant, Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, Werkausgabe Bd. IV, Suhrkamp Frankfurt a. Main 1964, 683; ders., Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis, ebd. 169; ders., Zum ewigen Frieden, ebd. 217; ders., Der Streit der Fakultäten, ebd. 356.
51 Zum ewigen Frieden ebd. 217.
52 Anthropologie ebd. 683.
53 Über den Gemeinspruch ebd. 169.
54 Odo Marquard, Abschied vom Prinzipiellen, Reclam Stuttgart 75.
55 Ebd. 76.
56 Ebd. 80.
57 Ebd. 85.
58 Friedrich Wilhelm Schleiermacher, Der christliche Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt, Band 1 und 2, Berlin 1861, § 30.
59 Ebd. § 3.
60 Ebd. § 4.
61 Ebd. § 3.
62 Ebd. § 30.
63 Günter Biemer hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass Newman sich ausdrücklich in seinem Postskript zum Traktat 73, verfasst 1835, ECH, Vol I, 30–101, London 1871 auf Schleiermacher bezieht. Schleiermachers Glaubenslehre hat er kaum gelesen, wohl aber einen amerikanischen Artikel in The Biblical Repository, Nos 18 and 19 mit dem Titel: Schleiermacher’s Comparison of the Athanasian and Sabellian Views of the Trinity. Dieser Artikel trifft die §§ 170–172 am Ende von Schleiermachers Glaubenslehre sehr gut. Schleiermacher fragt sich, ob der ewige Hervorgang des Wortes und des Geistes aus dem Vater, wie es das Athanasianum will, biblisch zwingend ist, ob die Ablehnung des Sabellianismus mit seiner Betonung des einen Wesens notwendig daraus gefolgert werden kann, ob nicht doch die Widersprüche, die sich bei Athanasius ergeben, im Sabellianismus vermeidbar sind. Schleiermachers Option geht unverkennbar in Richtung des Sabellianismus. Newman referiert die Schleiermachersche Ansicht korrekt, bemerkt aber in kritischer Absicht drei – wie mir scheint – leitende Kriterien:
– That the one object of the christian Revelation, or Dispensation, is to stir the affections, and soothe the heart.
– That the realy contains nothing, which is unintelligibel to the intellect.
– That the misbelievers, such as Unitarians, etc. are made so, for the most part, by Creeds; which are to be considered as the great impediments to the spread of the Gospel, both as being stumbling-blocks to the reason, and shackles and weights on the affection.
64 Hermann Pius Siller, Newman – ein ausgeprägt autobiographischer Mensch. Zur Pragmatik autobiographischen Handelns, in: Günter Biemer / Lothar Kuld / Roman Siebenrock (Hg.), Sinnsuche und Lebenswelten. Internationale Cardinal-Newman-Studien, XVI. Folge, Frankfurt a. M. 1998, 15–29.
65 John Henry Newman, Selbstbiographie nach seinen Tagebüchern, hg. v. Henry Tristram, Schwabenverlag Stuttgart 1959, 180.
66 Ebd.
67 Zitiert nach Günter Biemer und James Derek Holmes (Hg.), Leben als Ringen um Wahrheit, Grünewald Mainz 1984, 111.
68 Vgl. dazu Karl Barths lebenslange Auseinandersetzung mit Schleiermacher abschließend, mit Respekt und sehr fair das Nachwort zur Schleiermacher-Auswahl, München und Hamburg 1968, 290–312.
69 John Henry Newman, Predigten, 3. Band, Stuttgart 1953, 127–141; hier wird die Übersetzung von Otto Karrer benutzt in: Kardinal John Henry Newman, Christliches Reifen. Texte zur religiösen Lebensgestaltung, Einsiedeln 1954, 40–51.
70 Jean Paul Sartre, Die Wörter, Rowohlt Hamburg 1965, 78.
71 In „Die Eingeschlossenen“ („Bei geschlossenen Türen“) wird dieses Gesehenwerden zur Hölle; analysiert wird dieser Blick in „Das Sein und das Nichts“, Rowohlt Hamburg 1962, 338–397.
72 Bernd Trocholepczy, Realizing. Newmans inkarnatorisches Prinzip als Beitrag zum Theorie-Praxis-Verständnis der Praktischen Theologie, in: Günter Biemer / Bernd Trocholepczy (Hg.), Realisation – Verwirklichung und Wirkungsgeschichte, in: Internationale Cardinal-Newman-Studien XX. Folge, Peter Lang Frankfurt a. M. 2010, 77–239.
73 Vgl. Thomas von Aquin, Sum. Theol. I-II, 112, 1 ad 1; III, 7, 1 ad 1; III, 19. Dazu D. van Magerem, De causalitate instrumentali humanitatis Christi iuxta D. Thomae doctrinam, Venlo 1939.
74 Thomas von Aquin, Summa Theologiae I, q. 22.
75 Ders., Summa contra gentiles, LIII, 71–77.