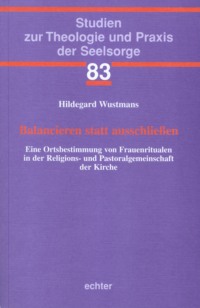Kitabı oku: «Balancieren statt ausschließen», sayfa 2
1. Einleitung: Von der Not der Zweiheiten, aus der ein Segen werden kann. Das pastorale Problem der Balance und die Methode der Arbeit
In Kapitel 1 werden die Zumutungen und Herausforderungen im Umgang mit Zweiheiten aus verschiedenen Ansichten in den Blick genommen und zugleich wird der allgemeine Rahmen der Fragestellung bearbeitet. Dies geschieht aus der Perspektive der Geschlechterdifferenz, des allgemeinen Wandels in den Biografien von Frauen und den daraus resultierenden Konsequenzen, wie der Entstehung einer Frauenliturgiebewegung. Auf der Basis des Vorausgegangenen werden dann methodische Konsequenzen für das Design der Arbeit gezogen.
1.1 Die fehlende Balance der Geschlechter – ein bedrängendes pastorales Problem
„Ohne Frauen geht es nicht, die Frauen sind wichtige Träger, wenn es um die Weitergabe des Glaubens an die kommende Generation geht, und wenn die auswandern, dann ist der Ofen wirklich aus“ (Sekretariat der DBK 1993, 98). Noch ist dieser Ofen nicht aus, man wird aber sagen müssen, immer weniger Holz wird nachgelegt. Frauen, und inzwischen sind es nicht nur die jüngeren Frauen, verlieren mehr und mehr ihre kirchlichen Bindungen. Dies hat u. a. die Konsequenz, dass die Frauen immer öfter nicht mehr der Rolle als Tradentinnen des Glaubens nachkommen (vgl. Foitzik 1993, 307–311). Gerade diese Entwicklung wird längerfristig erhebliche Auswirkungen haben, denn sie hat zur Folge, dass immer weniger Kinder und Jugendliche in einem von religiösen Überzeugungen geprägten Umfeld aufwachsen werden. Freilich sind noch immer mehr Frauen als Männer in den Pfarrgemeinden engagiert. „Sie arbeiten haupt-, neben- und ehrenamtlich in den Bereichen religiöser Erziehung und Katechese, engagieren sich pfarrlich in diversen Arbeitskreisen und Aktionen sowie in sozial-diakonischen und liturgischen Zusammenhängen. Keinen Zugang hingegen haben sie zur Ordination und deshalb zur umfassenden Leitungsvollmacht. In der Kirche bleibt also den Frauen ihr gelebtes Christ-sein, ihr Engagement in der Alltagsseelsorge, ihre Frömmigkeit (und deren Weitergabe), den Männern aber die definitorische und institutionelle Macht“ (Aigner/Bucher 2004, 64). Wohl auch angesichts dieser Tatsachen ist eine zunehmende Reserviertheit von Frauen (vor allem jüngeren Frauen) in Bezug auf die Kirche feststellbar. Und die Kirchenbänke, die sie verlassen, werden aller Voraussicht nach auch vakant bleiben. „Die Entfeminisierung der Kirchen ist nicht mit einer ‚Re-Maskulinisierung‘ gepaart, sie ist vielmehr eine generelle Entkirchlichung“ (Wolf 2000, 81). Angesichts dieser Prognose ist es verwunderlich, wie zögernd die katholische Kirche auf die neuen Frauenbiografien reagiert und dass sie sie nur rudimentär begleitet. Damit entzieht sie sich der Herausforderung, das Evangelium aus der Perspektive der Frauen zu entdecken und die „neue“ Wirklichkeit der Frauen mit dem Evangelium und der Tradition zu konfrontieren (vgl. Aigner/Bucher 2004, 70).
Diese Ausgangslage ist problematisch und prekär zugleich. Problematisch in dem Sinn, dass es wohl nur noch eine Frage der Zeit ist, bis Frauen diese Form der Arbeitsteilung in der Kirche aufkündigen. Prekär ist diese Entwicklung deswegen, weil so die Perspektive der Frauen als Bereicherung, Ergänzung und Konfrontation in der Kirche verloren gehen kann. „Der Preis, den das Patriarchat Kirche und Gesellschaft kostet, muss offenkundig werden – nicht nur, dass es für Frauen Unterdrückung und Ausgrenzung impliziert, sondern es bedeutet auch für die Männer die Entbehrung weiblicher Qualitäten als Bereicherung, Ergänzung und Konfrontation. Den subtilen Fallen und Verstrickungen, denen eine patriarchale Kultur unterliegt, auf die Spur zu kommen, wäre die Aufgabe von Männern und Frauen in einer Kirche, die Interesse daran hat, einen Gott zu verkünden, der den Menschen jenseits von Geschlecht, sozialer Stellung und religiöser Herkunft (Gal 3,28) nahe ist“ (Aigner/Bucher 2004, 78). Diesen Gedanken ernst zu nehmen und umzusetzen würde bedeuten, in dieser prekären Situation auch eine Chance zu sehen. Die Praxis wird darüber entscheiden, ob diese Möglichkeit letztlich obsiegen wird (vgl. Bucher 2004c).
Dabei ist die Frauenfrage ein Zeichen der Zeit. Diese Einsicht wurde erstmals von Papst Johannes XXIII. formuliert.1 Zeichen der Zeit sind keine markanten Phänomene des Verfalls und Niedergangs, sondern Wegmarken, die die Botschaft vom Reich Gottes immer wieder neu herausfordern. Sie bezeichnen spezifische gesellschaftliche Ereignisse und Prozesse, die den Rahmen des Gewohnten sprengen. Sie bezeichnen gefährdete und bedrohte Existenz. Sie decken Zustände auf, in denen die Würde von Menschen und der Schöpfung auf dem Spiel steht. Sie bringen zum Ausdruck, wie es um die Existenz von Menschen und der Welt, in der sie leben, bestellt ist. Zugleich verweisen sie aber auf die Potenziale von Menschen, sich diesen Gefährdungen zu widersetzen (vgl. Wustmans 2000, 325–327).
„Wer diese Zeichen benennt, wird dazu genötigt, sich mit den Menschen zu solidarisieren, die in diesen Zeiterscheinungen um die Anerkennung ihrer Würde ringen. Wer also auf die Zeichen der Zeit verweist, wird dazu getrieben, im Modus von Solidarität bei diesen Menschen eine alternative Lebensperspektive zu unterstützen oder ihnen eine solche anzubieten. Mit dem Benennen von Zeichen der Zeit werden zum einen Zeichen auf kritische Orte in den realen Lebensverhältnissen des Lebens gelegt wie zum anderen Zeichen für alternative Lebensverhältnisse gesetzt, die im Modus der sprachlich wie tatkräftig ausgeführten Solidarität bereits anwesend sind. Die Zeichen der Zeit und das, was in der Botschaft Jesu das Reich Gottes genannt wird, gehören deshalb zusammen. Es handelt sich um Heterotopien an den Orten, an denen die Menschwerdung von Menschen gefährdet ist“ (Sander 2005b, 868).
In diesem Sinne ist die Aufgabe, „nach den Zeichen der Zeit zu forschen und sie im Licht des Evangeliums zu deuten“ (GS 4, DH 1965, 4304), keine beiläufige und zu vernachlässigende Aufgabe, sondern eine von grundsätzlicher Bedeutung. Die Zeichen der Zeit haben gestaltende Kraft für die Kirche. Erst in der Auseinandersetzung mit ihnen wird die Kirche zur Kirche in der Welt von heute. „Das Handeln der Kirche zeigt, wo sie steht und wer sie ist. An ihren Taten wird gemessen, was sie sagt. […] Ihr Handeln besitzt Offenbarungsqualität im strikten Sinn“ (Klinger 2003, 139).
Die Zeichen der Zeit fundieren in diesem Sinne die Pastoral und sie sind ein konstitutiver Faktor für die Darstellung des Evangeliums in der Welt von heute. Dabei kommt es darauf an, die Zeichen der Zeit vonseiten der Pastoral zu entschlüsseln und zu einem Paradigma für die eigene Praxis zu machen. Und diese Entscheidung wird nicht folgenlos bleiben. Eine solche Pastoral versteht ihre eigene Berufung und Aufgabe von denen her, die unerhört sind. Und damit stellt sie sich selber, wie die kirchliche Verkündigung überhaupt, vor die unbequeme, aber unausweichliche Frage, ob sie Befreiung ist oder sich der Menschwerdung des Menschen in der Gegenwart verschließt (vgl. Sander 1995, 93). Und so führen die Zeichen der Zeit letztlich auf Christus hin (vgl. Sander 2005b, 839). Angesichts der Zeichen der Zeit ist eine sinnvolle und bedeutsame Verkündigung der befreienden Botschaft vom Reich Gottes in der Welt von heute möglich. Und vor diese Aufgabe stellen die Frauen die Kirche und ihre Pastoral. Wenn die Kirche die Frauen als ein Zeichen der Zeit wahrnimmt, dann folgt daraus ein „Auszug aus altvertrauten Bastionen zugunsten von mehr Beziehung: zu den Frauen, aber auch unter den Männern, zu mehr Gemeinschaft, zu mehr ebenbürtiger Gegenseitigkeit und Identitätsgewinn“ (Aigner/Bucher 2004, 75). Sie fordern die Kirche und die Pastoral heraus, die Zweiheit von den Zeichen der Zeit und dem Evangelium in den Blick zu nehmen und eine Pastoral der Balance zu entwickeln.
1.1.1 Der Mensch ist zwei – und die Rituale? Eine pastorale Frage der Geschlechterdifferenz
Die Zweiheit ist eine Kategorie im feministischen Diskurs. Der Mensch ist zwei: Mann und Frau (vgl. Diotima 21993). Ein Faktum, eine Tatsache, die das Leben entscheidend prägt und Männer und Frauen immer wieder herausfordert.2 Das Heikle an der Geschlechterdifferenz besteht gerade darin, dass sie Männer und Frauen gleichermaßen betrifft. Leben aus der Perspektive der Geschlechterdifferenz gestalten bedeutet, gemeinsames Leben auf der Basis der Differenz zu entwickeln. Versuche, mit dieser Differenz umzugehen, finden sich im Patriarchat, im Matriarchat, aber auch in der Frauenbewegung.
Im Rahmen der Frauenbewegung wird der Diskurs so geführt, dass das Ziel die Gleichstellung zwischen Mann und Frau ist. Im Kontext von Gender-Mainstreaming wird dieses Ziel nun allerorten diskutiert und quasi verordnet (vgl. www.gender-mainstreaming.net, 14. Februar 2011).3 Das Konzept der Gleichstellung von Mann und Frau ist jedoch voller Ambivalenzen und konnte noch immer nicht wirklich realisiert werden, denn es zeigt sich in der Gesellschaft, dass die Frau zwar als ein dem Mann gleiches Subjekt einbezogen wird, aber vielfach wird sie doch als unterlegenes Subjekt betrachtet und behandelt. „Die gleichen Rechte also, für die die Frauen kämpfen, greifen nicht eine Gesellschaft an, die auf der männlichen symbolischen Ordnung gründet; die Gleichheit de jure schwächt nicht die Herrschaft de facto“ (Cavarero 1997, 95).
Vor diesem Hintergrund entstand unter Philosophinnen und Frauen aus Gewerkschaften und Politik zunächst in Italien ein neuer Diskurs, das Denken der Geschlechterdifferenz. Dieser Diskurs hat seine Impulse im Wesentlichen von der französischen Philosophin Luce Irigaray4 erhalten. Die Geschlechterdifferenz wird in diesem Denken zu einem Ort der Konstitution einer autonomen Subjektivität der Frauen. „Die Geschlechterdifferenz ist nicht nur ein biologischer, historischer oder ontologischer Begriff: sie ist all dies zusammen“ (Cavarero 1997, 96).
Dieser Wechsel in den Diskursen von der Gleichheit zur Differenz ist signifikant, denn es zeigt sich hier sehr deutlich das Problem, mit der Zweiheit umzugehen. Jener Diskurs, der die Zweiheit über die Gleichheit ausschließen will, kommt an seine Grenzen, wie die Praxis zeigt. Er hat weder den Frauen noch den Männern all das gebracht, was er verheißen hat. Ob der Diskurs der Geschlechterdifferenz eine echte Alternative ist, wird sich noch erweisen müssen, aber es deutet sich an.
Im Patriarchat wird Frau-Sein als Zeichen der Unterlegenheit gedacht, die die ‚natürliche‘ Rolle der Frau bestimmt und daher als eine Art Schicksal verstanden wird, das der Frau ihren Platz in der Familie und Gesellschaft zuweist. Das Denken der Geschlechterdifferenz geschieht aus der Perspektive der Frauen und es koppelt Frauen von der Unterlegenheit und Unterdrückung ab, um sie zu einem weiblichen Maßstab in der Welt zu machen. „Dies bedeutet nicht nur Solidarität und gegenseitige Hilfe, sondern vor allem, sich auf eine andere Frau zu beziehen, um eine weibliche symbolische Ordnung existieren zu lassen, in der die Tatsache, als Frau geboren zu sein, einen Sinn für sich hat (einen von den Frauen frei entschiedenen Sinn) in einer Welt zweier Geschlechter“ (Cavarero 1997, 96; vgl. Libreria delle donne di Milano 1991).
Das Theorem der Gleichheit, das in der Frauenbewegung so zentral und wichtig war, ist im Denken der Geschlechterdifferenz nicht mehr das Ziel des politischen Projektes der Frauen. Im besten Fall ist es ein Instrument politischen Handelns. Das Denken der Geschlechterdifferenz erkennt an, was ist: dass es verschiedene Geschlechter gibt. Aber keines repräsentiert die ganze Menschheit. Das bedeutet, dass es strukturell und unleugbar eine Differenz zwischen Mann-Sein und Frau-Sein gibt. Diese Differenz ist erst dann in eine Balance zu bringen, wenn jedes der beiden Geschlechter an der Balance arbeitet, wenn von jedem der Geschlechter aus an der Balance gearbeitet wird. „Anders ausgedrückt: keines der beiden Geschlechter gilt als universal und auch für das andere Geschlecht als Modell oder Paradigma des ganzen Menschengeschlechts“ (Cavarero 1997, 99). Nicht Angleichung, die dann meist verstanden wird als Angleichung an das männliche Modell, ist die Basis des Zusammenlebens, sondern die Kenntnisnahme und Akzeptanz des konstitutiven Andersseins.5 Und von dieser Basis aus werden neue Dialoge und Prozesse nötig und möglich; dann treten die Geschlechter in eine Balance.
Im Denken der Geschlechterdifferenz haben die Beziehungen der Frauen untereinander eine besondere Bedeutung (vgl. Markert 2002). Es lenkt den Blick bewusst auf die Frauen und versucht, Frauen in Unabhängigkeit zu Männern zu sehen. Dies bedeutet nicht, Männer zu leugnen, zu verdrängen, sich von ihnen zu separieren, sondern es wird vielmehr deutlich, dass die Männer nicht mehr länger der einzige Maßstab der Welt, des Denkens und Fühlens sind. Das Denken und Handeln von Frauen schiebt gewissermaßen die Männer von dem Vordergrund in den Hintergrund. In den Mittelpunkt rücken zunächst die Beziehungen der Frauen untereinander. Indem Frauen den Blick konsequent auf Frauen richten, überwinden sie den Mythos des Patriarchates von der schwachen, abhängigen Frau. Sie durchkreuzen das Denken, das Frauen zu Beherrschten, Unterlegenen, Opfern und Mängelwesen macht. Sie verabschieden sich konsequenterweise von Versuchen, Frau-Sein in Bezug auf Mann-Sein zu konstruieren.
Das „Neue“ im Denken der Geschlechterdifferenz liegt darin, dass Frauen sich gegenseitig Wert und Bedeutung verleihen. Frauen brauchen Frauen, um ihren Weg ins Leben zu finden, um als Frau in der Welt zu sein (vgl. Günter 1996, 16). Die Beziehungen, die Frauen untereinander pflegen und entwickeln, sind Quelle für persönliche Stärke und soziales Eingebundensein. Die Beziehungen zu Frauen und die Bezugnahme auf Frauen werden zu einem Ort, an dem Frauen Kraft, Energie und Bestätigung für den eigenen unerhörten Lebensentwurf schöpfen können. Frauen machen ihre Erfahrungen zu einem Maßstab für die Welt, aus ihren Interessen ein Kriterium für die Welt und aus ihrem Begehren den Antrieb für die Veränderung der Welt (vgl. Libreria delle donne di Milano 1991, 150). „Um groß zu werden – in jeglichem Sinn – braucht sie [die Frau; H. W.] eine Frau, die größer ist als sie“ (ebd., 150). In diesem Wissen begeben sich Frauen auf die Suche nach weiblichen Vorbildern und Freundinnen und damit auch auf die Suche nach ihren eigenen Potenzialen und Möglichkeiten. Indem Frauen einander in gesellschaftlichen und religiösen Kontexten Autorität und Wert zuschreiben, verleihen sie sich selbst, der eigenen Erfahrung, ihrem eigenen Begehren Wert.
Noch etwas ist „neu“ und von fundamentaler Bedeutung im Denken der Geschlechterdifferenz: Es denkt nicht nur die Verschiedenheit der Frauen zu den Männern, sondern auch die Verschiedenheit der Frauen untereinander. Dieser Gedanke mag banal erscheinen, in seiner Bedeutung ist er es jedoch nicht. Im Denken der frühen Frauenbewegung war die Verschiedenheit der Frauen ein Tabu. Die einzelne Frau definierte sich über die Gruppe der Frauen, eine Gruppe von Opfern im Patriarchat. Raum für Kritik untereinander war nicht vorgesehen und wurde auch nicht zugelassen. Wurde die Verschiedenheit thematisiert oder Kritik geäußert, galt dies schnell als unsolidarisch und Verrat am Befreiungsprojekt der Frauen.
Im Denken der Geschlechterdifferenz werden Frauen jedoch nicht mehr als Gruppe von Gleichen, sondern als ein in sich vielfältiges und unterschiedliches Geschlecht wahrgenommen und damit grenzt sich dieser Ansatz fundamental von der Kategorie einer allgemeingültigen Frauenerfahrung ab. Mehr noch, hier wird das Denken von der allgemeinen Frauenerfahrung als Ideologie im Feminismus entlarvt: „Die schlimmste Vereinfachung in der Frauenbewegung war es, nicht mit den Unterschieden zwischen Frauen umgehen zu wollen bzw. zu können“ (vgl. Libreria delle donne di Milano 1991, 97). Das Postulat einer allgemeingültigen Frauenerfahrung führt dazu, dass der Mangel an gegenseitiger Kritik die Solidarität selbst untergräbt. Wenn jedoch die Differenz zum Ausgangspunkt gemacht wird, stellt sich unabwendbar die Frage nach den verschiedenen Standpunkten. Das ist prekär, denn es ist erforderlich, vom eigenen Standort aus zu sprechen. Von diesem Standort aus sind Aussagen über sich selbst und das Gegenüber zu machen. Das ist eine Zumutung, weil es eine neue Grammatik erfordert. Aber erst mit dieser neuen Grammatik, die auf dem Boden der Differenz entworfen wird, kann man dem Ausschluss entgehen und die Möglichkeit der Balance schaffen. Das ist fortdauernde Anstrengung, denn die Balance ist immer wieder neu herzustellen.
Auf dem Boden der (vermeintlichen) Gemeinsamkeiten wird vielfach ein Harmoniediskurs geführt. Die Gemeinsamkeiten schließen die Differenz aus, weil sie diese letztlich nicht ertragen können. In Harmoniediskursen werden vorschnell die Gemeinsamkeiten gesucht und dabei werden auch jene Potenziale und Energien zugedeckt, die in der Differenz stecken. Indem verschiedene Standpunkte benannt werden können, wird die Differenz sichtbar. Es wird erfahrbar, dass die Differenz die Dinge in Bewegung setzt und nicht das Gleiche. Es wird erfahrbar, dass Verschiedenheit zu einer sprudelnden Quelle werden kann, die das Prinzip der Gleichheit überwindet, das in seiner Starrheit nur Stagnation bedeutet. Differenz ist ein Wert, auch und gerade weil sie eine Zumutung ist, wachsen lässt und ein Zusammen auf der Basis der Balance erst ermöglicht.
„Aber wie sieht dieses ‚Zusammen‘ aus? Ohne Riten und Mythen, die uns lehren könnten, diejenigen, die uns gleichen, zu lieben und mit ihnen zu leben, besteht permanent die Gefahr der Zerstörung unter uns. Wir brauchen Werte, die wir teilen, damit wir koexistieren und gemeinsam etwas kreieren können. Und es ist wichtig, daß wir als Frauen existieren und uns als Frauen lieben können, um den anderen, den Mann lieben zu können“ (Irigaray 1987, 124; vgl. dies. 1998, 223; dies. 1991a; dies. 1991b).
Im Denken der Geschlechterdifferenz wird die Zweiheit sehr deutlich als eine grundsätzliche Fragestellung erkannt. Zugleich ist auf dieser Basis eine Perspektive für den Umgang mit Zweiheiten möglich: die ständige Arbeit an der Balance. Die Balance der verschiedenen Pole bedeutet ständige Bewegung und Dynamik. Die Dominanz der Gleichheit führt in die Stagnation, die Anerkennung der Verschiedenheit kann immer wieder einen neuen Anfang bedeuten.
Ein besonderer Ort, sich der Differenz zu stellen und an ihrer Balance zu arbeiten, können Rituale sein. Rituale stehen auf der Basis der verschiedenen Erfahrungen von Männern und Frauen, ihren verschiedenen Aufgaben und Rollen in der Gesellschaft, und gestalten sich unterschiedlich. Dies belegen zumindest eindeutig Rituale im Kontext anderer Gesellschaften und Kulturen. In ihnen gibt es Initiationsrituale für Jungen, die sie für ihre neue Rolle als Mann befähigen sollen. Für Mädchen gibt es vergleichbare Rituale, die den Prozess vom Mädchen zur Frau begleiten (vgl. Kubick 1993; Rauter 1993). In bestimmten Kulturen gibt es auch im weiteren Lebenslauf geschlechtsspezifische Rituale. Victor Turner, auf den in Kapitel 4 noch sehr ausführlich eingegangen wird, berichtet von dem Isoma-Ritual bei den Ndembu, einem Stamm in Nordwestsambia, wo er zweieinhalb Jahre Feldforschung betrieb (vgl. Turner 2000). Bei diesem Ritual handelt es sich um die von den Ndembu selbst so aufgefasste Klasse der „Frauenrituale“ bzw. „Fortpflanzungsrituale“. Das Isoma-Ritual wird bei Unfruchtbarkeit angewandt. Im Ideal sollte eine Frau, die im Frieden mit ihren Mitmenschen lebt und ihrer verstorbenen Verwandten gedenkt, verheiratet und Mutter ‚lebhafter und schöner Kinder‘ sein (vgl. ebd., 18). Bei Unfruchtbarkeit liegt ein Schatten auf der Frau. Dieser Schatten ist eine Ahnin aus ihrer matrilinearen Verwandtschaft, die die Frau vergessen hat. „Man hält die von dem Schatten verursachte Unfruchtbarkeit für einen vorübergehenden Zustand, der mit Hilfe der Durchführung entsprechender Riten aufgehoben werden kann. Sobald eine Frau sich dieses heimsuchenden Schattens und daher ihrer primären Bindung an ihre matrilineare Verwandtschaft erinnert, wird die Unfruchtbarkeit aufhören; sie kann mit ihrem Mann weiter zusammenleben, denn ihr Bewußtsein ist nun dafür geschärft, wem ihre Loyalität und die ihrer Kinder gebührt“ (ebd., 19).
Bei der Untersuchung dieses Rituals wie auch anderer Frauenkulte zeigt sich, dass es eine Dreiphasenstruktur (vgl. Kapitel 4.3.1; van Gennep 1999) aufweist. „Die erste Phase, Ilembi genannt, trennt die Kandidatin von der profanen Welt; die zweite namens Kunkunka (wörtlich: ‚in der Grashütte‘), isoliert sie teilweise vom alltäglichen Leben, während die dritte, die die Bezeichnung Ku-tumbuka trägt, einen festlichen Tanz umfaßt, mit dem man die Heilung der Kandidatin und ihre Rückkehr zum normalen Leben feierlich begeht. Diese letzte Phase des Isoma-Rituals ist erreicht, wenn die Kandidatin ein Kind zur Welt bringt und es das Kleinkindalter überlebt“ (Turner 2000, 20 f.).
In unserer Gesellschaft gibt es solch kulturell eingebundene Rituale nicht. Aber das heißt nicht, dass es keinen Bedarf dafür gibt. Vor allem Frauen formulieren den Wunsch nach Ritualen in Krisenzeiten oder bei besonderen Ereignissen in ihrem Leben. Es gilt auch heute, was Turner schon bei den Ndembu entdeckte, „daß die Entscheidung, ein Ritual auszuführen, sehr oft mit Krisen im Sozialleben“ zusammenhängt (Turner 2000, 17; vgl. Riedel-Pfäfflin/Strecker 1998).
Wenn Frauen heute Rituale entwickeln und feiern, ihre eigene spirituelle Kompetenz entfalten, dann tun sie etwas Unerhörtes. Sie beanspruchen für sich, dass Rituale heil machende, befreiende und segnende Zustände menschlicher Existenz und menschlichen Zusammenlebens vorwegnehmen und erfahrbar machen und dass mit ihrer Hilfe Krisen durchschritten und überwunden werden können. Durch Rituale wird es ihnen möglich, neue soziale Orte zu erobern. Dies zeigt sich in besonderer Weise dann, wenn Frauen Rituale entwickeln und feiern, die verworfene Teile des Lebens benennen (das Ende einer Beziehung, bei einer Frühgeburt, nach einer Vergewaltigung), und wenn sie diese Erfahrungen im Ritual in heilvollere Zustände überführen. Die Themen, die sie benennen, verstören. Zugleich gelingt es durch die Zeichen, die sie ausbilden, Schritte ins Leben zu weisen. Die Rituale vergegenwärtigen Situationen und ermöglichen aber auch, diese abzuschließen und zu überschreiten. Eine Veränderung tritt ein, Perspektiven und Zukunft werden eröffnet. Die Themen, die Frauen in Frauenliturgien und in Ritualfeiern aufgreifen, bestechen durch ihre Lebensnähe, durch ihre ansprechende und kreative Form in der Umsetzung (vgl. Baumann u. a. 1998). Die Frauen entscheiden, welches Thema, welche Lebensfrage im Ritual beschrieben und transformiert werden soll. Dabei übertragen sie besondere Ereignisse, Fragestellungen, Erfahrungen auf etwas, was sie in den von ihnen entwickelten spirituellen Feiern und Ritualen selbst vollziehen. Sie stellen ihre Erlebnisse und Fragen in einen spirituellen Kontext, den die Teilnehmerinnen aktiv erfahren und erleben können.
„Frauen erleben sich hier als liturgieschöpferisch und liturgiegestaltend und insofern als Trägerinnen dieser Gottesdienste. Es sind besonders ihre spezifischen Anliegen, die in den gottesdienstlichen Feiern ihren Platz finden: Wo sonst finden Frauen Aufnahme als mißbrauchte und vergewaltigte Frauen, als Frauen, die Kinder durch Fehlgeburten und Totgeburten verloren haben, als kinderlose oder alleinerziehende Frauen, als Frauen in der Doppelbelastung von Familie und Beruf, als alleinlebende, als in hetero- oder homophilen Beziehungen lebende und als alternde Frauen, als Frauen in Lebenskrisen, als Frauen in der Auseinandersetzung mit der Amtskirche, als denkende und fühlende Frau?“ (Jeggle-Merz 2000, 364 f.).
In diesen gottesdienstlichen Feiern wird nicht nur bislang Unerhörtes zur Sprache gebracht, es geschieht auch etwas: Heilung, Befreiung, Versöhnung. Sie verändern die Teilnehmenden und die Situationen, in denen diese stehen. Die liturgischen Feiern und Rituale werden so zu wirkmächtigen Zeichen. Und die Nachfrage nach dem Thema Ritual erweckt den Anschein, als seien sie in einer immer komplexeren und unübersichtlicheren Welt notwendig, wie eh und je.