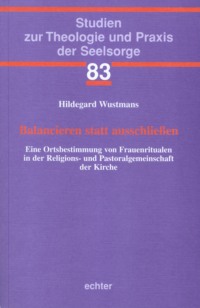Kitabı oku: «Balancieren statt ausschließen», sayfa 3
1.1.2 Lebensentwürfe und Selbstbilder von Frauen im Wandel. Ambivalenzen – Herausforderungen – Überforderungen
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gesellschaft und damit ihre Sozialstruktur, ihre Kultur und das Leben der Individuen massiv verändert. Diese Veränderungen haben zur Konsequenz, dass die unterschiedlichen Systeme und Welten in der Gesellschaft immer beweglicher werden. Die entfaltete Moderne verändert die gesamtgesellschaftlichen Strukturen grundlegend und sie macht vor dem Raum der Kirche nicht halt. Die Modernisierung der Gesellschaft setzt sich dabei systemisch auf der Ebene der individuellen Lebensführung und Lebensgestaltung fort. Dieser Prozess wird in der Soziologie unter dem Stichwort „Individualisierung“ behandelt und beschreibt die neue Form der Vergesellschaftung des Individuellen (vgl. Beck 1998; Beck/Beck-Gernsheim 1994; Sennett 1998). Alle gesellschaftlichen Anforderungen und Regelungen, vom Arbeitsmarkt bis hin zu den sozialstaatlichen Unterstützungen, sind auf die Einzelpersonen hin orientiert und erwarten deren aktive Beteiligung. Diese Entwicklung birgt Chancen und Lasten für die/den Einzelne(n). Es ist ein ambivalenter Prozess, mit enormem Freiheitsgewinn, seitdem der eigene Lebensweg nicht mehr von Ordnungen und Rollen der traditionellen Gesellschaft abhängig und vorbestimmt ist. Dabei tun sich für die Individuen eine Fülle an Möglichkeiten auf, sodass jede und jeder ihren/seinen Lebensweg gestalten kann. Die Biografie des/der Einzelnen ist nicht mehr determiniert und durch Familie, Milieu und Tradition bestimmt. Sie ist zu einem selbst zu verantwortenden Projekt von Individuen geworden. Dabei hat das Individuum auf die unterschiedlichsten Anforderungen von außen zu reagieren. Dies bedingt, dass die Arbeit an der eigenen Biografie zu ersetzen hat, wofür ehemals die sozialen Bindungen in den Milieus zuständig waren: nämlich Haltepunkte und Orientierungen in der Welt zu geben (vgl. Gabriel 31994, 80–119).
Der Prozess der Individualisierung wird von der Pluralisierung der Lebensformen und Möglichkeiten begleitet. Die Lebensstile und Weltanschauungen werden vielfältiger und für so manche(n) auch unübersichtlicher. Diese Entwicklungen der Individualisierung und Pluralisierung bedeuten nicht den gänzlichen Untergang traditioneller Deutungsmuster, sondern sie verlieren vielmehr ihre unhinterfragte normative Gültigkeit, die sie vormals für eine Gruppe besaßen. Deutungsmuster werden nicht mehr länger von einem kollektiven Milieu ausgebildet. Andere Ansprüche, Weltsichten und Werte treten hinzu und das Individuum hat nun die Möglichkeit und die Aufgabe, aus einem Set von Anschauungen zu wählen. Dies bedeutet für die alten Werte und Ordnungen, dass sie sich in Konkurrenz zu neuen Werten gestellt sehen und in der Regel nun auch einer Prüfung unterzogen werden. Was vormals nicht zu hinterfragen war, wird nun zu einem Objekt der Wahl. In einer pluralisierten Welt werden Entscheidungskompetenzen immer pluraler und dezentraler. „Die Moderne kann daher in aller Vorläufigkeit mit drei Schlagworten charakterisiert werden: Individualisierung der Lebensführung, Verlust traditioneller Sicherheiten sowie funktionale statt traditionale Differenzierung der Gesellschaft. Anders gesagt: Freisetzung des Individuums, Entzauberung der Welt und Aufhebung ständischer Organisationsmerkmale kennzeichnen die Moderne“ (Bucher 1999, 94).
Die neuen (Wahl-)Möglichkeiten bedeuten für die Individuen nicht nur einen ungemeinen Freiheitsgewinn, sondern es treten zugleich neue Anforderungen hinzu. Es gilt, das eigene Leben, die eigene Biografie in die Hand zu nehmen. In früheren Generationen gab es unverrückbare Grundsätze und Plausibilitäten. Das, was man dachte, wer man war, waren nicht (zwingend) Ergebnisse eines individuellen Reifungs- und Entscheidungsprozesses, sondern ein kollektives Ereignis. Unsere heutige Gesellschaft differenziert sich aber nicht mehr nach geburtsabhängigen Ständen. Im Rahmen der „neuen“ Biografien ist es erforderlich, sich selbst zu entwerfen und sich souverän zwischen und in verschiedenen Welten zu bewegen. „Erforderlich ist Passagefähigkeit als die Kompetenz, unterschiedliche Lebensbereiche, Wertsphären, Kulturen und Weltdeutungen kontrolliert miteinander in Verbindung bringen, aufeinander beziehen, voneinander abgrenzen zu können. […] Das Individuum hat heute die Möglichkeit, steht allerdings auch vor der Notwendigkeit, sich seine eigenen Muster der Lebensführung, der Weltbetrachtung und eben auch der religiösen Weltwahrnehmung zusammenzustellen. Denn es ist frei den bestehenden Mustern der Lebensführung gegenüber, da es ihren sozialen Trägern gegenüber frei ist. Deren soziale wie moralische Sanktionsmacht ist geschwunden“ (Bucher 1999, 95 f.).
Dies hat u. a. zur Folge, dass heute Dinge miteinander kombiniert werden können, die in den vergangenen Generationen weitgehend mit einem Tabu belegt waren, und ganz neue Lebensentwürfe werden möglich. Besonders deutlich zeigen sich die Veränderungen in den Lebensläufen junger Frauen im Vergleich zu denen ihrer Mütter und Großmütter. Zu den deutlichen Veränderungen gehören vor allem die sehr viel besseren Bildungsmöglichkeiten für Frauen, die sehr viel stärkere Einbindung von Frauen in den Erwerbsarbeitsmarkt und die Tatsache, dass sie über eigenes Einkommen verfügen. Frauen haben eindeutig das Bestreben nach einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Dies zeigt auch die Frauenerwerbstätigenquote, die in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen ist. Inzwischen sind fast 60 Prozent aller Frauen erwerbstätig (vgl. BMFSFJ 2004, 23), wobei ein großer Anteil der Frauen teilzeitbeschäftigt ist. „Nach Angaben des Mikrozensus 2002 stellen Frauen rund 86 % der Teilzeitbeschäftigten. Weit über die Hälfte (62,2 %) der teilzeitbeschäftigten Frauen geben dafür persönliche oder familiäre Verpflichtungen als Grund an“ (BMFSFJ 2004, 58). Dies bedeutet aber gleichzeitig, dass auch Frauen mit Kindern zunehmend erwerbstätig sein wollen. Fast zwei Drittel der Mütter mit Kindern sind heute erwerbstätig. Zu berücksichtigen ist jedoch in diesem Kontext das Alter der Kinder. Je jünger die Kinder, desto seltener sind die Mütter berufstätig (vgl. BMFSFJ 2004, 23). Die Soziologin Elisabeth Beck-Gernsheim hat die Veränderungen in den Biografien von Frauen als eine Entwicklung vom ‚Dasein für andere‘ zum Anspruch auf ein Stück ‚eigenes Leben‘ gekennzeichnet (vgl. Beck-Gernsheim 1983).
Die Entwicklungen im Bereich der Biografien von Frauen zeigen, dass die sogenannte ‚weibliche Normalbiografie‘ einen deutlichen Individualisierungsschub erlebt hat (vgl. Beck-Gernsheim 1983, 308 f.). Neue Handlungsräume, neue Entscheidungsmöglichkeiten und neue Lebenschancen sind für Frauen möglich. Aber diese verursachen auch neue Unsicherheiten bei den Frauen und nicht zuletzt auch im Verhältnis der Geschlechter. Es zeigt sich gerade an dem Punkt der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, dass aus den neuen Chancen auch neue Zumutungen hervorgehen. Die Chance der Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist gerade auch für die Frauen zu einer neuen Belastung geworden. Vielfach sind sie es, die die Kosten dieser neuen Möglichkeiten zu tragen haben. Auch wenn Frauen sich heute nicht mehr selbstverständlich über das Familiendasein und den Mann als Ernährer definieren, sind sie immer noch weitaus häufiger als Männer für die Familienaufgaben zuständig. Studien belegen, dass die klassische Rollenverteilung der Betreuung der Kinder (und des Haushalts) nach wie vor die Hauptaufgabe der Frauen ist, und dies trotz steigender Erwerbsbeteiligung von Frauen und auch unabhängig vom sozialen Status, Bildungsniveau sowie Anzahl der Kinder. „Männer übernehmen bei der Betreuung der Kinder am liebsten Aktivitäten im Bereich von Sport und Spiel (81 % der Zeit, die Frauen dafür aufwenden). Bei der Körperpflege und Betreuung der Kinder bleiben Männer gerade bei einem Drittel dessen, was ihre Partnerinnen leisten. Erwerbstätige Frauen mit Kindern unter 6 Jahren wenden für die Betreuung ihres Nachwuchses mit knapp 2,5 Stunden doppelt so viel Zeit auf wie erwerbstätige Männer“ (BMFSFJ 2004, 88). Diese Daten belegen zugleich einen weiteren wichtigen Punkt, nämlich dass nach wie vor die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Deutschland faktisch ein reines Frauenproblem ist.
Die Auflösung der Milieus produziert auch neue Überforderungen und führt zu neuen Belastungen. Effektivität und Nutzen sind zum allgemeinen Kriterium geworden. Dies erklärt auch, warum es nicht nur jene gibt, die von den Wahlmöglichkeiten und dem gesellschaftlichen Reichtum profitieren, sondern auch diejenigen, die durch die Maschen fallen. In der Gesellschaft sind sehr deutlich jene auszumachen, die vom Freiheitsgewinn überfordert sind, die mit den neuen Entwicklungen nicht mehr mithalten können und die nun von keinem Milieu mehr aufgefangen werden. Während in vormodernen Gesellschaften durch die Familie Sicherheit und Orientierung gegeben wurde, entsteht jetzt ein Vakuum, das jede/jeder Einzelne neu füllen muss. Die Normalbiografie wird damit zur ‚Wahlbiografie‘, zur ‚reflexiven Biografie‘, zur ‚Bastelbiografie‘. Alle menschlichen Lebensbereiche stehen zur Wahl. „Leben, Tod, Geschlecht, Körperlichkeit, Identität, Religion, Ehe, Elternschaft, soziale Bindungen – alles wird sozusagen bis ins Kleingedruckte hinein entscheidbar, muß, einmal zu Optionen zerschellt, entschieden werden“ (Beck/Beck-Gernsheim 1994, 16). Die zunehmende Komplexität von Entscheidungsmöglichkeiten und Entscheidungszwängen führt auch zu einem erhöhten Konfliktpotenzial in Partnerschaften und in den Zusammenhängen von Ehe und Familie, weil verbindliche Regeln fehlen (vgl. Beck-Gernsheim 1986, 144–173). Dafür stehen die hohen Scheidungsquoten und die Zahl der alleinerziehenden Mütter, von denen ein großer Teil auf Sozialhilfe angewiesen ist.6 Der moderne Sozialstaat übernimmt im Kontext der sozialen Absicherung einige Aufgaben, aber auch diese werden durch neue Sozialgesetzgebungen immer weiter zurückgefahren. Die Situation für die Modernisierungsverlierer/-innen wird immer prekärer.7
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass im Generationenvergleich Frauen heute in der Regel besser dastehen als ihre Mütter und Großmütter, ohne jedoch mit den Männern gleichgezogen zu haben. Das Interesse von Frauen an eigenständiger ökonomischer Absicherung und Berufstätigkeit gerät immer wieder in Konflikt mit dem Wunsch nach Partnerschaft und Mutterschaft. Häufig sehen sich Frauen in ihrem Bestreben nach einer Vereinbarkeit von Familie und Beruf Mehrfachbelastungen ausgesetzt, da sie zum einen noch immer mit einem vielfach traditionellen Rollenverhalten der Partner konfrontiert sind und zum anderen ausreichende Ganztagsbetreuungseinrichtungen für Kinder nach wie vor Mangelware sind, gerade in ländlichen Gebieten. Für viele Frauen gilt, dass sie die Differenz zwischen den neuen Möglichkeiten und den alten Erwartungen deutlich und mit aller Macht spüren. Sie bewegen sich zwischen Herausforderung und Überforderung. Auf diese Zusammenhänge macht die französische Philosophin Elisabeth Badinter (2010) aufmerksam. Sie plädiert dafür, die Mutterrolle zu entlasten und auf die Fähigkeiten von Frauen, das eigene Leben und die Beziehung zu ihren Kindern zu gestalten, zu vertrauen. „Je mehr man die Mutterrolle entlastet, umso mehr respektiert man die Entscheidungen der Mutter und der Frau und umso stärker wird diese geneigt sein, das Experiment zu wagen, ja es sogar zu wiederholen. Das Modell der Halbzeitmutter zu unterstützen, das einige allerdings immer noch unzureichend und damit verwerflich finden, ist heutzutage der ideale Weg, Frauen zum Kinderkriegen zu ermuntern. Wenn man hingegen von der Mutter verlangt, die Frau zu opfern, die in ihr steckt, wird sie nur die Geburt des ersten Kindes noch weiter hinauszögern oder gar ganz davon absehen“ (Badinter 2010, 182 f.).
Die Lage der Frauen ist von einer ausgeprägten Ambivalenz gekennzeichnet und sie sind von der potenziellen Gefahr bedroht, zwischen den Polen und den unterschiedlichen Erwartungen zerrieben zu werden. Eine Möglichkeit, dieser Gefahr zu entgehen, besteht darin, sich immer wieder neu den eigenen Ansprüchen und Erwartungen zu stellen und sie in eine Balance zu den Erwartungen im Außen zu bringen. An dieser Arbeit an den Balancen führt wohl kein Weg vorbei, wenn Frauen einem Nullsummenspiel entgehen wollen.
1.1.3 Pluralität in der Kirche – die pastorale Herausforderung der Balance
Diese gesellschaftlichen Entwicklungen machen selbst vor der Kirche nicht halt, auch wenn sie mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung bei ihr zu verzeichnen sind. Der gesellschaftliche Prozess von Individualisierung und Pluralisierung hat auch bei ihr Einzug gehalten und fordert Konsequenzen. Das katholische Milieu ist zerbrochen. In den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts zerfiel das pluralitätskanalisierende katholische Milieu in einem unaufhaltsamen Prozess (vgl. Bucher 1999, 93; Kaufmann 1979; Gabriel 31994). Inzwischen besteht auch in jenen Bereichen eine Wahlmöglichkeit, wo religiöse Normen die Wahl immer zu verhindern suchten. Es gibt zwar nach wie vor die Vorgaben der Institution, aber diese stehen „unter dem permanenten Zustimmungsvorbehalt ihrer eigenen Mitglieder. […] Auch der Katholik und die Katholikin haben heute die Möglichkeit, sich ihre eigenen Muster der Lebensführung, der Weltbetrachtung und der religiösen Weltwahrnehmung selbst zusammenzustellen – und das mehr oder weniger sanktionsfrei“ (Bucher 2004c, 19). Zudem haben die Kirchen längst nicht mehr das Monopol im Bereich des Religiösen (vgl. Gabriel 31994, 142–156). Immer mehr verlassen die Kirchen oder sie stellen sich aus einer Vielzahl von religiösen Werten und Formen ihre ganz private Religion zusammen. Menschen definieren für sich ganz persönlich, woran sie glauben und worauf sie hoffen. „Es gibt mehr Protestanten und Katholiken, die an Schutzengel glauben (56 beziehungsweise 66 Prozent) als an die göttliche Dreifaltigkeit (23 beziehungsweise 45 Prozent) und daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist (43 beziehungsweise 60 Prozent) – so das Ergebnis einer Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (1997). Nur Minderheiten der Kirchenmitglieder akzeptieren den Glauben an die Auferstehung der Toten (Protestanten: 29; Katholiken: 49 Prozent), an das Jüngste Gericht (Protestanten: 18; Katholiken: 36 Prozent), und ‚dass es eine Hölle gibt‘ (Protestanten: 16, Katholiken: 29 Prozent). Gerade im Zusammenhang mit solchen ‚letzten Dingen‘ kehrt sich inzwischen sogar der gängige statistische Erfahrungssatz ‚Je älter, desto frömmer‘ um. Nach einer Umfrage des Markt-und Meinungsforschungsinstituts Emnid aus dem Jahre 1997 finden Glaubensaussagen, ‚dass meine Seele in irgendeiner Form weiterlebt‘, bei den über 60-Jährigen mit 50 Prozent weniger Zustimmung als bei den 14- bis 29-Jährigen (mit 56 Prozent) und bei den 30- bis 39-Jährigen (mit 60 Prozent). Die Aussage ‚Es gibt ein Leben nach dem Tod‘ wird nur noch von einem guten Drittel (36 Prozent) der über 60-Jährigen akzeptiert und stößt bei 59 Prozent dieser Altersklasse auf Ablehnung, während diese Überzeugung von mehr als der Hälfte der jüngsten Befragtengruppe geteilt wird. Von diesen sagen 41 Prozent: ‚Mit dem Tod ist alles aus‘, unter den 60-Jährigen und Älteren stimmen sogar knapp zwei Drittel (61 Prozent) dieser Aussage zu. Von beträchtlichen Teilen der älteren Generationen werden somit die auf das Jenseits und die Endzeit gerichteten Glaubensüberzeugungen stark in Zweifel gezogen. […] Es nehmen zu: die rituelle Abweichung der Kirchenmitglieder in Glaubenshandlungen, die von den Kirchen erwartet werden, die Abwehr von Glaubensvorstellungen, die als zentral definiert werden (Gottesbild, Lehre von der Auferstehung und vom ewigen Leben), und ‚Synkretismusbildungen‘, das heißt persönliche Kombinationen von christlichen und anderen religiösen Wertvorstellungen. Solche ‚Glaubenskomponisten‘ bilden inzwischen mit 47 Prozent die Mehrheit der europäischen Bevölkerung“ (Ebertz 2003, 23 f.; vgl. ders. 1998; ders. 1997).
Dies spricht für eine Umgestaltung des Religiösen (vgl. Kaufmann 1991, 269). Dabei sind die Ambivalenzerfahrungen im Leben von Menschen auch heute noch religionsproduktiv (vgl. Zulehner 1999, 95). Menschen suchen auch heute noch Halt und Sinn und sie greifen dort zu, wo ihnen die Angebote für den Moment plausibel und hilfreich zu sein scheinen (vgl. Först/Kügler 2010). Ändern sich die Umstände, dann kann sich auch der Bereich des Religiösen ändern. Religion ist somit nicht aus der Gesellschaft verschwunden, aber sie ist immer weniger kirchlich eingebunden und verwaltet (vgl. Ebertz 2003, 65). Zugleich spielt sich der religiöse Pluralismus eben auch unter dem eigenen kirchlichen Dach ab (vgl. Gabriel 2009, 121). Darüber hinaus zeigt sich bei genauerer Betrachtung, dass sich der Wahrnehmungshorizont in Sachen Religion immer mehr auf das eigene Ich verlagert. Es geht im Kontext des Religiösen um Selbstfindung, Selbsterfahrung, Selbstvergewisserung und um die Intensivierung des eigenen Lebens, der eigenen Existenz, um Erlebnisverdichtung und um ungestillte Sehnsüchte und Erfahrungen. Diese Erwartungen werden auch von einigen Interviewpartnerinnen deutlich in Gesprächen benannt. Im Kontext der Auseinandersetzung mit Spiritualität und in den unterschiedlichen Frauenliturgiegruppen ist Selbsterfahrung ein wichtiger Punkt (vgl. Kapitel 3).
Religion zeigt sich in neuem Gewand an ganz unterschiedlichen Orten und säkulare Orte und Ereignisse treten als neue Anbieter hinzu. Dies führt zu der Konsequenz, dass die Bedeutung des Religiösen im Leben von Menschen und in der Gesellschaft längst nicht mehr eindeutig zu benennen ist. „Es kommt zu einer Mehrfachbewegung im Felde des Religiösen. Religiöse Versteppung, etwa in den neuen Bundesländern, kirchlich verwaltete traditionelle Religiosität und die Renaissance einer sehr individuell gestrickten, auf das eigene Ich bezogenen und von ihm her entworfenen, nichtsdestoweniger sehr ernsthaften Religiosität koexistieren – und dies beileibe nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch im Individuum und eben wohl auch im Katholizismus“ (Bucher 1999, 97).
Auf diese Entwicklungen hat die Kirche bislang nur unzureichend reagiert. Zum einen hat sie seit den 70er Jahren versucht, mit einer enormen Professionalisierung und Pluralisierung ihrer Angebote verlorenes Terrain gutzumachen. „Man weitete den nicht-klerikalen Teil des kirchlichen Personals bedeutend aus und besetzte viele Stellen mit hauptamtlich tätigen, zunehmend auch professionell qualifizierten und professionell entlohnten Personen. Wesentliche Teile des von der Kirche beschäftigten Personals, etwa in den Bereichen Diakonie, Aus- und Weiterbildung, Erwachsenenbildung oder auch Religionsunterricht, werden in Deutschland und Österreich von professionell ausgebildeten Laien gestellt“ (Bucher 2001, 268). Die Rolle des Pfarrers, der sich als Hirte um alle Belange seiner Herde kümmert, wurde durch den neuen Typ des Hauptamtlichen ausdifferenziert. Kirchliches Handeln geschieht heute eben nicht mehr nur in den Pfarreien, sondern in Schulen, Beratungsstellen, sozialen Einrichtungen, Betrieben, Krankenhäusern usw. durch hauptamtliche pastorale Mitarbeiter/-innen. Die Kirche hat in diesem Bereich die Pluralität aus ihrem Außen in ihr Innen getragen. Jedoch zeigt die Praxis inzwischen, dass oftmals die einzelnen Bereiche wenig oder nichts voneinander wissen. Vielfach gibt es keinen Austausch zwischen den einzelnen Systemen und im schlimmsten Fall machen sie sich gegenseitig Konkurrenz (vgl. Bucher 2004b, 114).
Die Lage ist prekär und zunehmend wird deutlich, dass die katholische Kirche im deutschsprachigen Kontext eben auch mit dem Abstieg ihrer altbewährten Sozialformatierungen zurechtkommen muss. Besonders die Pfarrgemeinden stehen massiv unter Druck. Es fehlt an Priestern und auch die Aktiven kommen ihnen mehr und mehr abhanden. Zudem sind sie davon gekennzeichnet, dass sie viele Milieus überhaupt nicht erreichen (vgl. Wippermann/De Magalhaes 2005; Ebertz/Wunder 2009).
Hervorstechend ist in diesem Zusammenhang das fast überall mehr oder minder gleiche Lösungsmuster: Es werden Pastoral- und Personalpläne entwickelt, die die Versorgung von immer weniger Gläubigen bei gleichzeitigem Priestermangel gewährleisten sollen. Diese Versorgung ist im Grunde an nur einer Größe ausgerichtet und diese nimmt im deutschsprachigen Bereich merklich ab: dem Priester (vgl. Sellmann 2010, 1010). Gerade diese Problemlösungsstrategie steht für ein Prinzip, das im Modus des Status quo handelt.
Ein weiteres Problem von nicht minderer Tragweite ist der Rückgang der finanziellen Mittel. In besonders drastischer Weise wurde dies bereits in den Bistümern Aachen und Essen erlebt. Aber nahezu alle Bistümer haben mehr oder weniger drastische Sparpakete geschnürt. Vor allem durch Personalabbau und Kürzungen in der Seelsorge, im Kindergartenbereich und der Verwaltung sowie durch Reduzierungen des Gebäudebestandes sollen die Haushalte wieder ausgeglichen werden. In den 70er und 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hat man noch von reichlich fließenden Kirchensteuermitteln profitiert und in diesem Zusammenhang wurden viele Einrichtungen und Stellen geschaffen, was sich die Kirche heute nicht mehr leisten kann. Einrichtungen, die in den sogenannten fetten Jahren gegründet wurden, erscheinen heute als Luxus, den man sich nicht mehr leisten kann oder will. Mit den Sparmaßnahmen werden somit unweigerlich auch Einschnitte in die inhaltliche und pastorale Arbeit vorgenommen. Für so manchen Kürzungsbeschluss werden keine inhaltlichen Begründungen geliefert, sondern es wird mit der prekären Finanzlage argumentiert. Diese Entwicklung ist mindestens so heikel wie die finanzielle Situation so mancher Diözese.
Die Krisenphänomene zeigen, dass die Kirche in Deutschland in der gesellschaftlichen Realität angekommen ist. Was sich in anderen Bereichen der Gesellschaft schon längst abgezeichnet hat und eingetroffen ist, greift nun auch in ihr Raum und stellt sie vor besondere Herausforderungen, die sich zum einen im Feld der finanziellen Belastungen bewegen, zum anderen im Kontext innerkirchlicher Pluralisierungen. Die erste Herausforderung ist relativ neu und die Wege, ihr zu begegnen, sind in den deutschen Diözesen unterschiedlich. Die einen haben einen Spar- und Erneuerungsprozess mit internen Kräften beschritten (Bistum Limburg). Wieder andere suchen im Kontakt und durch die Hilfe externer Berater, wie z. B. die Bistümer Aachen und Mainz, ihre Probleme schnell und effizient zu lösen. Zu der Lösungsstrategie, externe Berater wie McKinsey hinzuziehen, merkt Zulehner kritisch an: „Die Philosophie von McKinsey kommt aus der Wirtschaft und nicht aus der Ekklesiologie des Zweiten Vatikanischen Konzils. Umso verwunderlicher ist es (aber was kann die Angst vor einem Konkurs nicht theologisch alles bewirken!), dass sich just dieser ökonomische Umgang mit der Kirche solch großer Beliebtheit erfreut. Ökonomische Effizienz ist insgeheim zur obersten Richtschnur geworden“ (Zulehner 2004, 111).
Für die Bewältigung der zweiten Herausforderung, der innerkirchlichen Pluralisierung, ist ein Blick in die Kirchengeschichte nützlich. Es zeigt sich dann sehr schnell, dass innerkirchliche Pluralität keine Erfahrung neueren Datums ist. Aber mit dem Zweiten Vatikanum und mit der Pastoralkonstitution von Gaudium et spes und der dogmatischen Konstitution von Lumen gentium liegt der Kirche ein Entwurf vor, wie Pluralität gestaltet werden kann. In Lumen gentium wird Kirche von der Berufung aller Menschen durch Gott in Christus her entwickelt und verstanden. Kirche wird von ihren Mitgliedern her verstanden und zeigt sich somit als plurale Gegebenheit. In Gaudium et spes erkennt und benennt die Kirche die Chance und Notwendigkeit, von den Zeichen der Zeit her sich selber immer wieder neu zu entdecken. Der/die Einzelne und die Gesellschaft sind Orte der Theologie und damit wird die Pluralität zum Fundament und zum Prüfstein der Kirche selber (vgl. Bucher 1999, 99 f.).
Die Kirche steht in der Differenz von innen und außen, von inhaltlichen Ansprüchen und gravierenden ökonomischen Engpässen, von den eigenen Glaubenssätzen und einer zunehmenden Tendenz der eigenen Mitglieder, sich über diese hinwegzusetzen und individuelle Neuarrangements des Religiösen und Spirituellen zu entwickeln (vgl. Höhn 2004, 16). Diese Differenzen sind eine massive Anfrage und Herausforderung, denen die Kirche nicht ausweichen kann. Sie muss sich diesen Differenzen stellen, denn nur so besteht die Möglichkeit, glaubwürdige und taugliche Antworten für die Menschen in der Welt von heute zu finden.
Das Problem der Differenzen stellt sich nicht nur für die Kirche allein, sondern auch für ihre Mitglieder. Auch von ihnen verlangt die Situation, dass sie sich zu den Differenzen in der Welt von heute und in der Kirche in Beziehung setzen, und in besonderer Weise gilt dies vielleicht für die Frauen. Dabei hat es den Anschein, als würde gerade die Gruppe der Frauen auf die Ambivalenzen ihrer Biografien und die Differenzen, in die sie sich gestellt sehen, mit einem besonderen Bedürfnis nach Spiritualität reagieren. An ganz unterschiedlichen Orten kommen Frauen zusammen, um miteinander Liturgien und Rituale zu feiern. Sind sie ein Ausdruck von Pluralität und tatsächlich eine Reaktion auf die bedrängenden Ambivalenzen und Differenzen? Was suchen und entwickeln Frauen an diesen Orten? Wie werden diese von der institutionellen Seite der Kirche wahrgenommen? Wo finden sie Unterstützung? Wo wird ihnen mehr als nur Befremden entgegengebracht? Und wie beziehen sich die Frauen auf die Kirche und ihre traditionellen Formen der Glaubensfeier und der Inhalte des Glaubens? Diesen Fragen muss man sich stellen, wenn man verstehen will, was die Frauen bewegt, und zugleich davon ausgeht, dass ihre Praxis nicht nur für die Frauen einen Sinn hat, sondern auch für die Kirche von Bedeutung ist. Im Rahmen dieser Arbeit sind diese Fragen zentral. Sie soll eine Antwort auf diese Fragen bieten und zugleich einen Weg aufzeichnen, wie mit Pluralitäten und Differenzen in einer produktiven Art und Weise umgegangen werden kann.
Bevor Frauen an unterschiedlichen Orten und aus sehr verschiedenen Kontexten zu Wort kommen, sollen hier zunächst zwei Blitzlichter vorgestellt werden, die den Rahmen weiter erhellen. Diese Blitzlichter legen den Schluss nahe, dass es sich bei der Frage nach dem Umgang mit der Pluralität in der Kirche und unter den Frauen um eine Herausforderung handelt, die sich nicht nur in Deutschland stellt, sondern auch in einem ganz anderen gesellschaftlichen Kontext, und exemplarisch sei hier auf den Kontext Brasilien verwiesen. Die Bezugnahme zu Brasilien hat eine biografische Begründung. Ich habe nach dem Abitur ein sozial-pastorales Jahrespraktikum in Brasilien absolviert und im Rahmen des Theologiestudiums auch ein Auslandssemester in São Paulo absolviert. In einer Millionenstadt in Brasilien treffen sich im großen Saal einer Ordensgemeinschaft ca. 30 Frauen. Sie tun dies regelmäßig. Sie kommen an einem Sonntag zusammen, um miteinander eine Frauenliturgie zu feiern. Eine Gruppe von Frauen hat die Liturgie vorbereitet, das Thema gewählt, den Raum, die Mitte gestaltet. Eine Ordensfrau, die diese Gruppe ins Leben rief und seither begleitet, sorgt für Absprachen und Koordination mit der Ordensgemeinschaft und unterstützt die Frauen, wo immer sie Hilfe benötigen. Die Frauen, die kommen, nehmen zum Teil einen langen Anfahrtsweg in Kauf, um dabei zu sein. Der feste Kern der Gruppe trifft sich nun schon seit mehreren Jahren.
Auch in einer Kleinstadt in Deutschland treffen sich einmal im Monat Frauen, um Frauenliturgie zu feiern. Zwei Frauen haben die Liturgie vorbereitet. Sie haben das Thema gewählt, den Ablauf durchdacht, den Raum gestaltet. Es sind in der Regel 12 bis 15 Frauen, die an diesen Abenden zusammenkommen. Die Gruppe wurde von einer Gemeindereferentin initiiert und seither begleitet sie die Frauen. Auch hier hat sich ein fester Kern herausgebildet, der sich schon über viele Jahre hinweg trifft.
Beiden Gruppen ist gemeinsam, dass die Frauen aus ungleichen Bezügen kommen und dass sie unterschiedlich alt sind. In der brasilianischen Gruppe sind alle Frauen katholisch, in der deutschen Gruppe fast alle, wenige sind evangelisch. Einige der Frauen sind in ihren Pfarrgemeinden aktiv. Sie alle sind sehr verschieden und doch gibt es eine entscheidende Gemeinsamkeit: den Wunsch, im Glauben das Leben zu feiern, sich mit religiösen Traditionen und Formen auseinanderzusetzen und dafür eigene, neue Formen zu entwickeln. Sie denken sich rituelle Handlungen vor dem Hintergrund ihrer konkreten Lebenserfahrungen aus, ganz konkret im geschützten Raum einer Gruppe von Frauen. Viele tausend Kilometer, ganz andere kulturelle, wirtschaftliche und soziale Hintergründe trennen die Frauen und doch sind ihre spirituellen Sehnsüchte so ähnlich. Alle diese Frauen suchen ihren spirituellen Ort und wollen ihn selbst gestalten. Sie tun dies selbstbewusst und entschieden, manchmal auch in bewusster Abgrenzung zur Kirche und deren spirituellen Formen und Angeboten.
Diese Blitzlichter sowie weitere Facetten und Orte werden im Verlauf der Arbeit noch sehr viel deutlicher in den Blick genommen und analysiert. Aber diese Orte sind allesamt signifikant in ihrer Bedeutung für das, was Kirche ist und wie sie wahrgenommen wird. Sie zeigen an, wie es um den einen oder anderen Ort bestellt ist, an dem Menschen zusammenkommen, um liturgische Feiern miteinander zu gestalten und zu erleben. Damit geben sie unmittelbar Auskunft über einen zentralen Bereich von persönlicher Glaubenspraxis und Kirche. Die Beispiele sprechen beim genaueren Hinsehen eine sehr deutliche Sprache in Bezug auf Liturgien, denn sie sagen alle auf die eine oder andere Art, dass die Liturgien ein Lebensmittel sind, das Menschen brauchen, um gut leben zu können. Dem Anschein nach gibt es bei Frauen diesbezüglich ein besonderes Interesse; die Frauen, die in dieser Arbeit zu Wort kommen, suchen nach neuen, nach anderen Orten in Form und Inhalt als die „gewöhnliche“ Liturgie. Es sind Frauen, denen die Nahrung in den gewohnten Strukturen und Formen nicht mehr ausreicht, denen sie sogar manchmal unbekömmlich ist. Sie suchen nach Orten, an denen sie belebende Nahrung bekommen, weil sie wissen, dass sie sie brauchen, um wirklich leben zu können. Auch die Kirche braucht solche Orte, weil sie ein lebendiger Organismus ist. Jedes Lebewesen braucht Nahrung, um am Leben zu bleiben. Das Nahrungsmittel der Kirche ist die Liturgie (vgl. Wustmans 22005a, 238–254). Und in der Liturgie geht es dabei um nichts Geringeres als um Gott selber.