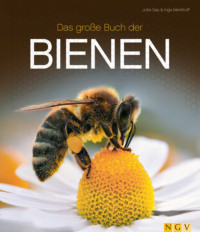Kitabı oku: «Das große Buch der Bienen», sayfa 5
Die Honigbiene

Die neun Honigbienenarten der Welt
»Der Weiser rief darauf den Rest der Untertanen,
Um sie zur Eintracht zu ermahnen.
›Der Unterschied in eurer Pflicht
Erzeugt‹, sprach er, ›den Vorzug nicht.
Nur die dem Staat am treusten dienen,
Dies sind allein die bessern Bienen.‹«
CHRISTIAN FÜRCHTEGOTT GELLERT: DIE BIENEN
AUS: FABELN UND ERZÄHLUNGEN
Unter all den Bienengattungen der Welt bilden die der Honigbienen, lat. Apis, eine recht kleine Gruppe. Lediglich neun Arten weltweit zählt sie der allgemeinen Auffassung nach, doch gibt es Meinungen, dass beispielsweise die Kliffhonigbiene nur eine Unterart der Riesenhonigbiene sei. Von neun Arten ausgehend, sind allein acht ausschließlich auf dem asiatischen Kontinent beheimatet. Einzig Apis mellifera, die Westliche Honigbiene, also unsere »Hausbiene«, ist auch in Afrika ansässig und konnte bis in gemäßigte Klimazonen vordringen. Bemerkenswert ist, dass diese wenigen Arten weltweit eine so wichtige Rolle für die Ökosysteme einnehmen: Obwohl sie mit anderen staatenbildenden Insekten wie Termiten und Ameisen gerade einmal zwei Prozent der bekannten 900.000 Insektenarten ausmachen, sind die Honigbienen beispielsweise in Europa für die Bestäubung von rund 80 Prozent aller Blütenpflanzen, die durch Insekten bestäubt werden, verantwortlich.
WAS ZEICHNET DIE HONIGBIENE AUS?
Ihren Namen haben die Honigbienen nicht deshalb erhalten, weil ihnen Honig als Nahrung bzw. Energielieferant dient – das haben sie mit allen Bienen gemein –, sondern weil sie große Mengen an Honigvorräten anlegen. Weit mehr als sie in der Regel verbrauchen, sodass der Mensch einen Teil davon ernten kann.
Allen Honigbienenarten sind einige wesentliche Eigenschaften und Merkmale gemeinsam: Sie bilden Staaten und bauen aus einer oder mehreren Waben ihre Nester, deren einzelne sechseckige Zellen als Brutzellen und als Honig- und Pollenlager dienen. Sie leben in selbstorganisierten Kolonien, verwenden vielschichtige Arbeitsteilungs- und Kommunikationssysteme und sie sind in der Lage, sich zu einem Großteil von ihrer Umwelt unabhängig zu machen, indem sie etwa die Baustoffe ihrer Nester selbst produzieren oder fähig sind, die Temperatur innerhalb der Kolonie zu regulieren. Bei den Westlichen Honigbienen bedeutet das beispielsweise, dass es im Winter mancherorts einen Unterschied zwischen der Außentemperatur und der Kerntemperatur innerhalb des Stockes von 60 °C gibt, den die Insekten allein mit ihren Körpern und dem Honig als Energielieferanten erzeugen. Außerdem bilden die Honigbienen eusoziale Gemeinschaften, haben eine Königin, die ausschließlich Eier legt, und eine Arbeiterinnenkaste, die alle anderen Arbeiten erledigt. Und sie zeigen alle Voraussetzungen eines sogenannten Superorganismus, dessen Grundelemente nicht wie bei einem Organismus Zellen und Gewebe sind, sondern einzelne, miteinander kooperierende Individuen, die in ihrer Gesamtheit Wirbeltieren und sogar Säugetieren ähneln.

Die abgerundeten, hexagonalen Zellen der Bienenwabe gelten als die am besten untersuchten Strukturen der Natur. Sie zeichnen sich trotz ihres weichen, zerbrechlichen Materials durch eine außerordentliche Stabilität bei ungeheurer Leichtigkeit aus, sodass ihr Aufbau zunehmend als Vorbild technischer Materialien dient.

Der Mythos von der Killerbiene
Ihre Geschichte klingt wie die eines Science-Fiction-Horrorfilms: 26 Bienenschwärme der Ostafrikanischen Hochlandbiene (Apis mellifera scutellata) brechen wegen der Unachtsamkeit eines Mitarbeiters 1956 aus einem brasilianischen Versuchslabor aus. Sie paaren sich mit den eingebürgerten europäischen Honigbienen und so entsteht die afrikanisierte, amerikanische Honigbiene. Unaufhaltsam dringt diese Biene, die im tropischen und subtropischen Klima bestens in freier Wildbahn überleben kann, nach Mittelamerika und in den Süden der USA vor. Im Jahr 2014 ist sie in San Francisco angelangt. Soweit stimmt die Geschichte.
Was ansonsten in aller Welt über die Killerbiene beziehungsweise »the assasin«, den Attentäter, wie sie in Brasilien genannt wird, geschrieben, berichtet und in Hollywoodfilmen »dokumentiert« wird, gehört eher ins Reich der Mythen. Äußerst aggressiv und stechlustig sei sie, ein erbarmungsloser Killer, der allenthalben Todesopfer zurücklassen würde.
Es stimmt, dass Apis mellifera scutellata und mit ihr auch die afrikanisierte Honigbiene eine andere Verteidigungsstrategie verfolgt als die europäischen Rassen. Durch ihren ostafrikanischen Lebensraum an eine wesentlich höhere Prädatorenmenge angepasst, reagieren die Insekten bereits bei Annäherung an das Nest, greifen dann in Schwärmen an und verfolgen den Feind über weite Strecken hinweg. Doch zum einen zeigt sich darin ein Notwehr-, nicht ein Killerinstinkt, zum anderen ist die Biene deutlich kleiner, die Stärke ihres Giftes um 30 Prozent geringer als die der europäischen Rassen. Rund eintausend Stiche sind nötig, um einen gesunden erwachsenen Menschen zu töten. Und die Biene greift nicht etwa im freien Feld an, selbst dann nicht, wenn sie gerade schwärmt. Sie ist allein bei der Nestverteidigung stechfreudig.
Was die Imker Süd- und Mittelamerikas aber längst für die »Killerbienen« eingenommen hat, sind die enormen Honigerträge, die Resistenz der Insekten sowohl gegenüber der Varroamilbe als auch gegenüber der Amerikanische Faulbrut, die hervorragende Bestäubungsleistung und die allgemeine Entwicklungsfreudigkeit der Völker. Die Arbeit mit den Bienen erforderte eine Umstellung der Arbeitskleidung und der Arbeitsweise, doch die Mühe lohnte sich: Statt 20 Kilogramm Honig mit den europäischen Honigbienen liegen die Ernteerträge mit der »Killerbiene« bei etwa 60 Kilogramm Honig pro Jahr und Volk.
Aber natürlich gibt es zahlreiche Unterschiede zwischen den verschiedenen Arten, in körperlicher Hinsicht ebenso wie in Bezug auf Lebensraum und Lebensweise. Die Körpergröße ist hier ganz entscheidend, die Färbungen des Körpers und der Haare und – als eines der wesentlichen Unterscheidungsmerkmale der Arten – die Genitalorgane der Königinnen und Drohnen. Grob lassen sich auch die freibrütenden Honigbienen, die an Ästen oder im Busch nisten, von den Höhlenbrütern, die ihre Kolonie in einer schützenden Höhle ansiedeln, unterscheiden.
DIE RIESENHONIGBIENE, APIS DORSATA
Bis zu zwei Meter breit können ihre spektakulären Nester, die nur aus einer einzigen frei an einem dicken Baumast hängenden Wabe bestehen, werden. Und an solch einem Baum hängt nicht nur eines der halbmondförmigen bis dreieckigen Apis-dorsata-Nester, es können Dutzende sein. Bis zu 100.000 Bienen bilden eine Kolonie, schnell kommen an einem der sogenannten »Bienenbäume« also mehrere Millionen Individuen zusammen. Warum die Riesenhonigbienen – zwischen Pakistan und Vietnam, in Indien und auf den indonesischen Inseln beheimatet – in Gruppen siedeln, ist noch ungeklärt. Auch ist nicht klar, warum manche Bäume in Scharen besiedelt werden und andere, völlig gleich erscheinende Bäume, gar nicht. Fest steht, dass die einzelnen Völker gänzlich unabhängig voneinander leben und keinerlei Nutzen daraus ziehen, dass in ihrer unmittelbaren Nähe ein anderes Volk ihrer Art lebt. So verteidigen sie nicht etwa gemeinsam ihre Nester vor Feinden, sondern verharren ungerührt, solange nicht das eigene Volk bedroht ist. Fest steht auch, dass die Riesenhonigbienen Wanderbienen sind: Sie haben Winter- und Sommerquartiere und je nach Lebensraum wandern sie zwei- bis viermal im Jahr. Das erfordert ein wesentlich längeres Leben als bei anderen Bienenarten: In den Sommern vor allem in höheren Lagen (bis maximal 2000 Meter) anzutreffen, verlassen die Bienen beispielsweise bei Abklingen des Monsuns ihre Wabe. Die Königin hat schon vor einer Weile die Eiablage eingestellt, die Bienen bereiten sich auf die Wanderung vor, die Brut ist meist geschlüpft und neue wird nicht mehr herangezogen. Die Wanderung kann bis zu 200 Kilometer weit sein und bis zu sechs Wochen dauern, denn spätestens nach fünf Kilometern müssen die Bienen ruhen und frischen Nektar und Pollen suchen. Sind sie am Ziel ihrer Wanderung angekommen, müssen neue Nester gebaut, Honigvorräte angelegt und die neue Brut betreut werden – erst dann hat eine Bienengeneration ihre Pflicht erfüllt und die nächste übernimmt deren Aufgaben. Die Riesenhonigbiene wird also in der Regel mehrere Monate alt – im Vergleich dazu wird unsere »Hausbiene« im Sommer nur etwa 42 Tage, im Winter sechs bis sieben Monate alt.

In Süd- und Westindien gehören die gewaltigen Banyanbäume zu den wichtigsten Nistbäumen der Riesenhonigbiene. Weil sie und andere wichtige Nistplätze in Südostasien immer häufiger großflächig abgeholzt werden, weicht Apis dorsata beim Bauen ihrer Nester zunehmend auf das Balkenwerk menschlicher Gebäude aus und wird damit ganz allmählich zum Kulturfolger.

Auf einem Banyanbaum im südwestindischen Bundesstaat Bangalore wurden im Jahr 2005 insgesamt 625 Bienennester gezählt. Der Baum ist umgeben von Eurkalyptusbäumen, deren Blüten den Insekten eine exzellente Futterquelle bieten.
Jedes Jahr kehrt ein Großteil der Bienenvölker im Zuge ihrer Wanderung zu ihrem Baum zurück, was Forscher des Institute for Natural Resources Conservation, Education, Research and Training (INCERT) dazu bewog, den Bienenbaum für das UNESCO-Naturerbeprogramm vorzuschlagen. Und auch die Einwohner der benachbarten Dörfer erkannten seinen Wert: Sie stellten die Honigernte an diesem Baum ein, als bekannt wurde, dass durch sie die Zahl der Nester stetig dezimiert wurde.
Kennt man die Westliche Honigbiene in ihren Bienenbeuten, so bietet die frei brütende Riesenhonigbiene in ihrer ganzen Lebensweise einen spektakulären Kontrast dazu. Die riesige Wabe wird an eine breite waagerechte Fläche angebaut und besteht aus einem Vorratsspeicher und einem Brutbereich, die sich durch ihre Zellentiefe deutlich voneinander unterscheiden. Die gleich großen, aber sehr viel tieferen Honigzellen nehmen bei großen Völkern bis zu 50 Kilogramm Honig auf, in sehr viel flacheren Zellen wird die Brut herangezogen. Auf der senkrecht hängenden Wabe selbst sind etwa zehn Prozent des Bienenvolks mit der Brut- und Zellenpflege, mit dem Beheizen oder Kühlen der Wabe und mit der Honig- und Pollenverarbeitung beschäftigt. Ein ebenso kleiner Teil sammelt Blütenpollen und Nektar. Die übrigen Bienen aber hängen dicht an dicht neben- und übereinander, halten sich an den anderen Bienen fest und bilden so einen dichten Schutzmantel um die Wabe. Ihr Hinterleib ist dabei frei beweglich, der Kopf fast gänzlich unter den Hinterlieb der darüberhängenden Biene geschoben, die Flügel leicht ausgebreitet. Gegen Regen, der an ihren Leibern und Flügeln abläuft wie an Dachziegeln, bilden sie so einen ebenso wirksamen Schutz wie gegen kleinere Feinde. Kommt beispielsweise eine Wespe in die Nähe des Stockes, so schnellen die Hinterleiber der Bienen in die Höhe und es entstehen sensationelle Wellenbewegungen, die den Angreifer verscheuchen und verwirren sollen. Größere Feinde greift Apis dorsata in Mengen an, sticht sofort zu und gilt daher – besonders bei den einheimischen Honigjägern – als aggressivste Biene überhaupt.

In einem dichten Vorhang hängt ein Großteil der Apis-dorsata-Arbeiterinnen über der Wabe, um sie nach außen zu schützen. Ammen- und Baubienen, die Königin und ihr Hofstaat verrichten ihr Tagewerk unter diesem Vorhang, Sammelbienen dagegen können ihn durchschreiten, um Pollen, Nektar und Wasser einzutragen. Ihre Kommunikationstänze aber führen die Riesenhonigbienen außen auf den vertikal hängenden Leibern ihrer Schwestern aus, wo sie andere Sammlerinnen über einträgliche Nahrungssquellen informieren. Dabei nutzen sie, wie die Westliche Honigbiene, die Schwerkraft sowie den Stand der Sonne, um die Lage der Futterquelle in Bezug zum Nest zu setzen und mithin die Lage anzugeben.
(K)ein Bienenfreund – der Blaubartspint
Eine ganze Familie tropischer Vögel, wie der Böhmspint, der Smaragd- und der Regenbogenspint, die sogenannten Bienenfresser (Meropidae), hat sich die Biene als Hauptnahrungsmittel ausgesucht. Zu ihnen gehört auch der Blaubartspint (Nyctyornis athertoni), der eine besondere Taktik entwickelt hat, die Riesenhonigbiene erst von ihrem Nest wegzulocken und sie dann zu vertilgen. Der hübsche grasgrüne Vogel mit hellblauer Kehle streift im Flug den Mantel aus Bienen, der das Nest schützt. Sogleich löst sich von diesem eine ganze Reihe an Bienen, verfolgt den Blaubartspint und versucht, ihn zu stechen. Doch der pickt die einzelnen Insekten aus seinem Gefieder, knipst mit seinem Schnabel den Giftstachel ab und verspeist die Biene anschließend.

Ihren Namen tragen die Riesenhonigbienen übrigens, weil sie im Vergleich zu anderen Bienenarten gigantisch sind: Bis zu 25 Millimeter, also so groß wie eine europäische Hornisse, können die Arbeiterinnen werden, die Königin und Drohnen sind nur unwesentlich größer. Ihre äußere Gestalt zeichnet sie durch einen dunklen Kopf mit dunklen Haaren, einen bernsteinfarbenen Leib und rauchig getönte Flügel aus.
DIE RIESENBERGBIENE, APIS LABORIOSA
Noch größer und an noch spektakulärerem Ort siedelnd als die Riesenhonigbiene, hat man die Riesenbergbiene, Apis laboriosa, lange Zeit für eine Unterart von Apis dorsata gehalten. Trotz aller Gemeinsamkeiten (beispielsweise in den Geschlechtsorganen) tendiert die Wissenschaft aber heute dazu, sie als eigene Art anzusehen und die beiden Arten stattdessen zur Untergattung Megapis, also den »Riesen-Honigbienen«, zusammenzufassen. Die Riesenbergbiene siedelt hauptsächlich in den Himalayaregionen von Nepal und Buthan, in Höhen zwischen 1500 Metern im Winter und bis zu 3500 Metern im Sommer. Sie ist um etwa zehn Prozent größer als Apis dorsata, mit einem schwarz gefärbten Körper, aber bernsteinfarbenen Haaren, die etwa 0,4 Millimeter lang und damit fast dreimal länger als die der Riesenhonigbiene sind. Ein wärmender Pelz also in dem rauen Gebirgsklima.
Die Nester gleichen denen der Riesenhonigbiene, hängen aber an Felswänden. Ansonsten ist ihre (sommerliche) Lebensweise recht ähnlich: Die Völker siedeln in Gruppen zusammen, aber ohne Austausch untereinander, die Waben sind etwas größer, aber genauso aufgebaut. Auch die Verteidigungsstrategie ist dieselbe wie bei Apis dorsata. Im Winter (Dezember und Januar) hingegen wandern die Riesenfelsenbienen ins bewaldete Tal hinab, sammeln sich dort – ohne eine Wabe zu bauen – zu Wintertrauben, die sie nicht beheizen, und verharren dort, bis sie ab Februar wieder zu ihren angestammten Felswänden zurückkehren.
Dass man sie heute als eigene Art bezeichnet, liegt einerseits an den körperlichen Unterschieden wie Farbe und Größe zu Apis dorsata, andererseits aber auch an genetischen Unterschieden und an Differenzen ihrer Verhaltensweisen. So unterscheiden sich die Kommunikationstänze von Apis dorsata und Apis laboriosa deutlich voneinander, die Alarmpheromone stimmen nicht überein (bzw. bei der Riesenbergbiene fehlt dies im Stachelapparat und wird durch ein Mandibulardrüsensekret ersetzt) und auch die Hochzeitsflüge der Königinnen finden zu anderen Uhrzeiten statt, sie begatten sich also zu unterschiedlichen Zeiten – eines der wesentlichen Kennzeichen für eine eigenständige Art.

Die Lebensbedingungen von Apis laboriosa sind extrem. In bis zu 3500 Metern Höhe fallen die Nachttemperaturen in der Regel unter den Gefrierpunkt. Auch die Nahrung im Gebirge ist recht einseitig, sind es doch vor allem die giftigen Blüten des Rhododendron, die den Insekten als Trachtquelle dienen. Stellt dieses Gift für die Bienen kein Problem dar, so erntet man in den Himalayaregionen den Honig nicht zuletzt wegen seiner halluzinogenen Wirkung.

Eine eiweiß- und kohlenhydratreiche Kost: Auf den Märkten Asiens werden die Nester der Zwerghonigbiene mitsamt Honig und Bienenbrut zum Verzehr angeboten.
DIE ZWERGHONIGBIENE, APIS FLOREA
Nicht größer als eine Stubenfliege, also etwa neun bis zehn Millimeter groß, ist die asiatische Zwerghonigbiene und auch ihre frei bebrütete Wabe erreicht kaum je einen Durchmesser von 30 Zentimetern. Die meist in dichtem Buschwerk an einem Ast »aufgehängte« Wabe, die auch häufig in Dörfern und Großstädten zu finden ist, besteht aus einem wulstigen Honigspeicher, dessen tiefe Zellen sich um den gesamten Ast herumbilden, und einer senkrecht in einem gleichförmigen Halboval hängenden Brutwabe. Im Unterschied zu allen anderen Honigbienenarten besitzt der Wulst des Honigraums keine Mittelwand, die Waben werden strahlenförmig um den Ast herumgebaut. Wie bei den Riesenhonigbienen umhüllt die Mehrheit der nur 15.000–20.000 Individuen eines Volkes die gesamte Wabe mit einem dichten Schutzmantel, ein kleinerer Teil fliegt zur Pollen- und Nektarsuche aus und betreibt Nest- und Brutpflege.

Zusammen mit den Zwergbuschbienen, Apis andreniformis, wird die Zwerghonigbiene, Apis florea, inzwischen der gemeinsamen Untergattung Micrapis, den Zwerg-Honigbienen, zugeordnet. Zusammen mit den beiden Riesen-Honigbienen, Apis dorsata und Apis laboriosa, zählen sie zu den frei brütenden Honigbienen.
Was die Biene an Größe entbehrt, macht sie an anderer Stelle wieder wett. Zum einen ist sie zu einer unglaublichen Anpassung an extreme Wetterbedingungen fähig. So findet man sie nicht nur in den südasiatischen Tieflandgebieten unterhalb von 500 Metern zwischen Nordindien und den indonesischen Inseln, sondern auch rund um den Persischen Golf und seit wenigen Jahrzehnten sogar im östlichen Afrika, wo sie sommerlichen Tagestemperaturen von teilweise 50 °C und winterlichen Nachttemperaturen um den Gefrierpunkt sowie extremer Trockenheit standhalten kann. Sie hat darüber hinaus ein sehr ansprechendes, auffälliges Äußeres: Ihr schwarzer Kopf und Thorax sind von einem leichten Silberpelz umgeben, was einen schönen Kontrast zum kräftig orange-schwarzen Hinterleib mit silberweißen Filzbinden bildet. Der kaum ein Millimeter lange Stachel ist nicht sehr wirksam gegen größere Feinde, auf die die Zwerghonigbiene zunächst auch kaum reagiert. So kann der Mensch ein Florea-Nest an seinem Ast herumtragen, ohne gestochen zu werden. Fühlt sich die Zwerghonigbiene bedroht, gibt sie ihr Nest lieber auf und siedelt an einem anderen Ort – was ihr den Namen Nomadenbiene eingebracht hat –, als es zu verteidigen. (Es mag aber auch daran liegen, dass man bei der Zwerghonigbiene bislang kein Alarmpheromon feststellen konnte. Ihre vermeintliche Sanftmut ist also vielleicht nur das Fehlen einer wirksamen Gefahrenkommunikation gegen einen übermächtigen Feind.) Da der Hauptfeind der Zwerghonigbiene in der Tat der Mensch ist, für den ihr Stich nicht einmal die Auswirkung eines Mückenstichs hat und der die kleinen Wachswaben inklusive Brut und Honig auf den Märkten Asiens zum Verzehr anbietet, muss sie recht oft ein neues Nest bauen.

Die Zwerghonigbiene wandert periodisch zwischen dem tropischen Flachland und nahen Mittelgebirgen, die Tiere verlassen dazu ihre Nester und errichten in beachtlicher Geschwindigkeit neue.
Gegen kleinere, nicht fliegende Feinde aber, wie Ameisen, hat die Zwerghonigbiene eine interessante Verteidigungsstrategie entwickelt: Den Ast, um den ihre Wabe gebaut wird, streicht sie rechts und links komplett mit Propolis ein und hält dieses stets weich. In dem weichen Kittharz bleiben die Angreifer kleben und können so weder zum Nest vordringen noch den Rückzug antreten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.