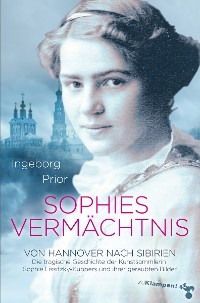Kitabı oku: «Sophies Vermächtnis», sayfa 2
2. Die Liebe und die Kunst
Sophie, Paul und die Kunst, es war von Anfang an eine leidenschaftliche Liebe zu dritt. Der Sohn eines Bergwerkbesitzers aus Essen und die Münchener Arzttochter lernten sich in der Universitäts-Bibliothek kennen, wo beide Literatur zu den Künstlern der Renaissance suchten. Einen Moment lang wurde die Kunst zur Nebensache, als sie sich neugierig über den Rand ihrer Bücher hinaus beobachteten, als es in ihren Augen blitzte und sie schließlich ins Gespräch kamen und feststellten, dass beide mehr über die Tafelbilder des Florentiner Malers Ghirlandaio erfahren wollten. Über ihn hat Paul Erich Küppers später promoviert.
Die Kunst beflügelte ihre Liebe, bot ständigen Diskussionsstoff, brachte sie mit vielen interessanten Menschen zusammen. Eine »Ménage à trois«, die bis zuletzt wunderbar harmonierte. Die beiden galten als besonders glückliches Paar.
Die streng erzogene Sophie taute in der Gegenwart ihres lebenslustigen Freundes nur langsam auf. Sie wagte es ja noch nicht einmal, ihrem Tagebuch intime Gedanken anzuvertrauen. So wie sie überhaupt ein Leben lang persönliche Gefühle hinter einer nur schwer durchdringbaren Mauer versteckte, die erst im Alter zu bröckeln begann. Haltung statt Emotionen – das hatte sie in ihrem Elternhaus gelernt. Kunst war der beste Ausweg, die flirrenden Empfindungen in ihrem Bauch und Herzen dennoch nicht zu unterdrücken. Sophie war eine kleine, höchst energische und temperamentvolle Frau. Ihre aufblühende üppige Weiblichkeit bildete einen reizvollen Kontrast zu ihrem kurz geschnittenen, glatt und streng nach hinten gekämmten Haar, das in der Farbe reifer Kastanien glänzte, und den dichten, düsteren Augenbrauen. Wenn sie diese unwillig zusammenzog – und das tat sie recht oft –, konnte jeder die Gedanken in ihrem Gesicht lesen. Den Eindruck der überlegenen Intellektuellen milderten nur ihre warmen freundlichen Augen. Auch viel später, in den Zeiten größter Trauer und Not, lag noch ein Hauch von Humor in ihnen.
Paul Erich Küppers war ein hübscher schlanker Bursche mit dunklem gewellten Haar und unternehmungslustig blitzenden Augen. Zwischen Nase und Oberlippe zierte ihn ein akkurat zum Dreieck gestutztes Bärtchen. Er war phantasievoll, geistreich, fröhlich und spontan, stürzte sich begeistert in alle neuen Strömungen der Kunst. Er liebte das Leben und riss seine etwas spröde Freundin mit.
Heimlich verlobten sich die beiden. Wieder einmal hatte es Sophie schwer, sich gegen den Widerstand der Mutter durchzusetzen. Nur im Beisein ihrer Schwester Tilly durfte sie sich mit dem Freund treffen, nachdem er von seinen Studien in Florenz zurück nach München gekommen war. Aber im Nymphenburger Park gab es glücklicherweise stille Seitenwege. Auch ihre Onkel setzten ihr zu, die Verlobung zu lösen. Sie sorgten sich um die materiellen Aussichten dieser Ehe, nachdem der Vater des Bräutigams Konkurs angemeldet hatte und sein Bergwerk schließen musste.
Auch dass Paul Erich Küppers während seines Studiums an Tuberkulose erkrankt war, erschien der Schneider-Sippe bedenklich, obwohl die Krankheit nach einem einjährigen Aufenthalt in einem Sanatorium im Schwarzwald als ausgeheilt galt.
In dieser schwierigen Zeit fand Sophie Unterstützung einzig bei ihrem nun an Gallenkrebs leidenden Vater. Doch auch er wollte die Hochzeit seiner geliebten Tochter zunächst nicht gestatten. Erst, nachdem auf seinen Wunsch hin ein Münchener Facharzt den jungen Kunsthistoriker untersucht und für gesund befunden hatte, gab er seinen väterlichen Segen. Sophie wusste, dass er mit dieser unwürdigen Gesundheitsinspektion nur seine Brüder beruhigen wollte, von deren Wohlwollen sein Leben und das seiner Familie schließlich abhing. Deshalb nahm sie es ihm auch nicht übel.
»Seine Worte – Du wirst doch einen kranken Menschen nicht im Stich lassen – haben sich mir für mein ganzes Leben ins Herz geprägt. Mein Vater, der im Mai 1915, nur 58 Jahre alt, während einer Operation starb, war mir ein Vorbild aufrichtiger Menschlichkeit. Seinen Hass auf alles Militärische und auf den Götzendienst an das Geld hat er mir unausrottbar vererbt. Meinem Vater verdanke ich es, dass ich erkannt habe, auf welcher Seite der Mensch zu stehen hat – es gibt keine Mitte!«
Am 14. September 1916 heirateten Sophie Schneider und Paul Erich Küppers in München. Ihr Brautbouquet aus weißen Nelken legte sie auf das Grab des Vaters. Sophie war froh, das Haus in München nun für immer verlassen zu können, in dem sie sich ohne ihren geliebten Vater einsam und fremd gefühlt hatte.
Drei Monate vor ihrer Hochzeit, mitten im Krieg und in einer Zeit künstlerischer Stagnation, war am 20. Juni 1916 in Hannover die Kestner-Gesellschaft gegründet worden. Paul Erich Küppers, der wegen seiner labilen Gesundheit als kriegsuntauglich eingestuft wurde und sich daraufhin verpflichtet hatte, ein Jahr unentgeltlich als wissenschaftlicher Assistent im Kestner-Museum zu arbeiten, wurde im Alter von nur 27 Jahren ihr künstlerischer Leiter.
Ausgerechnet in dieser »stocksteifen Provinzstadt«, wie Sophie die damals noch königliche Haupt- und Residenzstadt charakterisierte, bildete sich eine Plattform freier künstlerischer Entfaltung – im bewussten Gegensatz zur offiziellen Kunstpolitik der Stadt und ihres konservativen Kunstvereins.
Die Kestner-Gesellschaft war mit privaten Mitteln hannoverscher Bürger – Ärzte, Kaufleute, Bankiers, Rechtsanwälte, Fabrikanten, Architekten – ins Leben gerufen worden, unabhängig von städtischen oder staatlichen Beschränkungen. Zu ihren Gründungsmitgliedern gehörten die Familien Bahlsen, Beindorff und Sprengel, der Galerist von Garvens-Garvensburg, der Bankier Richard Oppenheimer, Professor Wilhelm von Debschitz, Sanitätsrat Dr. Catzenstein und weitere Stützen der Hannoveraner Gesellschaft. Benannt wurde sie nach dem Bürger August Kestner, der im 18. Jahrhundert in Hannover ein bekannter Sammler und Mäzen gewesen war. Man wollte sich nicht länger von dem mächtigen Stadtdirektor Heinrich Tramm, den manche den »Kaiser von Hannover« nannten, vorschreiben lassen, was Kunst sei und was nicht. Bei ihm jedenfalls hörte sie mit den großen deutschen Impressionisten Corinth, Slevogt und Liebermann auf. Die Kunstwende, die in der Luft lag, hatte für ihn etwas Bedrohliches. Die Fauves, die Kubisten, die Maler der »Brücke« und des »Blauen Reiter« beherrschten damals mit ihren starken Farben und abstrakten Formen schon die Wände der Berliner und Münchener Galerien. Doch Heinrich Tramm schloss seine ansonsten so spendable Kunstkasse ab. »Solange ich in Hannover etwas zu sagen habe, kommt kein Nolde und kein Rohlfs hierher«, soll er einmal geäußert haben.
Aber eben deshalb, um Nolde und Rohlfs und noch viele andere Künstler fördern zu können, hatte sich die Kestner-Gesellschaft gegründet. Wer hätte gedacht, dass unter den Dächern dieser konservativen Stadt kurze Zeit später die wildesten Dada-Abende stattfinden würden?
Und das allen widrigen Begleiterscheinungen des Krieges zum Trotz. Immer wieder kam es zu Tumulten und Unruhen zwischen Soldaten und der zivilen Bevölkerung. Bei einem Eisenbahnerstreik gab es Tote und Verwundete. Offizieren wurden die Degen entrissen. Die Menschen wollten diesen Krieg nicht, der sie in große Hungersnot stürzte.
Am 22. November 1916 gab die Stadtverwaltung bekannt, dass durch das eingetretene Winterwetter die Zufuhr von Kartoffeln vorläufig nicht mehr möglich sei und dass für jede Person nur noch ein halbes Pfund täglich ausgegeben werden könne. Die Mitteilung endete mit folgendem Ratschlag: »Um den durch diesen Ausfall betroffenen Haushaltungen Ersatz zu bieten, hält die Stadtverwaltung große Mengen von Steckrüben zur Verfügung.« Fleisch und Butter wurden ebenfalls streng rationiert.
Am 3. Februar 1917 veröffentlichte die Gerichtszeitung folgende Meldung: »Unter Anschuldigung des Landfriedensbruches sind über 30 Personen verhaftet worden … es handelt sich um das törichte Vorgehen von Frauen und jungen Leuten, die sich zu der Annahme verführen ließen, sie könnten markenfreies Brot in den Bäckerläden erlangen.«
Am 9. September 1917 wurde an alle Frauen die dringende Aufforderung gerichtet, in kriegswichtigen Betrieben tätig zu werden. »Eine unsühnbare Schuld nimmt derjenige auf sich, der in der Heimat feiert, anstatt zu arbeiten! Vor allem die gebildeten Frauen sollten zeigen, dass niemand zu gut ist für die Arbeit in den Munitionsfabriken!«

Das Hochzeitspaar Sophie Schneider und Paul Erich Küppers 1916 (Foto: privat)
War das nicht eine geradezu persönliche Aufforderung an Sophie Küppers und den weiblichen Teil ihres Kreises von Künstlern und Kunstintellektuellen? Sie wurde ignoriert.
Die Leiden der Bevölkerung und der Tod vieler junger Männer auf den Schlachtfeldern des Krieges bestärkten Paul Erich Küppers in seiner Absicht, die noch unbekannten Künstler und ihre zukunftsweisende Kunst zu fördern. »Nur die jungen Künstler«, schrieb er mit expressionistischem Pathos im Vorwort zum Katalog einer Erich-Heckel-Ausstellung im Februar 1919, »als die feinsten Seismographen der Zeit fühlten den Umschwung seit Jahren voraus. In ihren Werken wetterleuchtete schon das Kommende, in ihrer Seele brannte die Sehnsucht nach Umkehr und Einkehr.«
Die zahlreichen Künstler, die dank der Kestner-Gesellschaft nach Hannover kamen und hier gern verweilten, tanzten trotz des Hungerwinters ihren Tanz auf dem Vulkan.
Schnell wurden die Küppers Mittelpunkt einer wagemutigen Kunstszene und Gastgeber ausgelassener Geselligkeiten, bei denen ausgerechnet ein Sohn der Stadt, der als Bürgerschreck und Dada-Clown verschriene Kurt Schwitters, provozierte und polarisierte.
Schon 1917, als ganz Hannover noch missbilligend oder ratlos den Kopf über den »Lumpensammler« schüttelte, der aus den Abfällen des Alltags ein Spiegelbild der Welt komponierte, war Schwitters Stammgast des im klassizistischen Stil erbauten Hauses der Kestner-Gesellschaft in der Königstraße 8. Der Maler, Grafiker und Dichter, der Erfinder der Merz-Kunst, seiner persönlichen Variante der Dada-Bewegung, Schöpfer der aus Vokalen und Konsonanten bestehenden »Ursonate« und des originellen Liebesgedichts »An Anna Blume«, stellte in der Kestner-Gesellschaft aus und las aus seinen Märchen und Dichtungen. Sophie Küppers verfolgte amüsiert die künstlerischen Eskapaden und Eulenspiegeleien dieses heute weltberühmten Klassikers der Moderne. Später wurde er ihr ein vertrauter Freund.
»Kurt Schwitters, Hannovers ›Enfant terrible‹, war ein unermüdlicher Propagandist alles Neuen«, schrieb Sophie. »Den Expressionismus hatte er schnell hinter sich gebracht, klebte Collagen, von denen wir auch eine erworben hatten. Außerdem hatte Schwitters den Entwurf zu einer Schatulle gemacht, mit der ihn Küppers, der ihn scherzhaft den ›Hauptmann von Köpenick‹ in der Kunst nannte, beauftragt hatte. Dieser Entwurf wurde von dem alten Intarsienmeister Schulz in den verschiedensten kostbaren Hölzern sowie Elfenbein, Perlmutt und Silberstückchen ausgeführt.« Auch dieser 23 x 23 x 16 Zentimeter große Intarsienkasten mit der Signatur Schwitters und der Inschrift »S.K./P für Sophie und Paul Erich Küppers« sollte in Sophies Leben eine besondere Rolle spielen; nach einer abenteuerlichen Reise nach Sibirien steht er heute als rare Kostbarkeit hinter Glas im Kestner-Museum Hannover.
Zu den engsten Freunden der Küppers gehörte das jüdische Ehepaar Käte und Dr. Ernst Steinitz, beide gebürtige Oberschlesier. Man hatte den Facharzt für Nervenkrankheiten im letzten Kriegsjahr von der Front nach Hannover gerufen, wo er als Chefarzt die Lazarette um den Döhrener Turm leiten sollte. Später war er Leitender Arzt am jüdischen Krankenhaus Siloah und hatte eine eigene Praxis in der Georgstraße. Seine Frau Käte war Künstlerin und kam aus Berlin, wo sie Schülerin von Lovis Corinth gewesen war. Auch ihr Haus gehörte zu den Treffpunkten der munteren Hannoveraner Kunstszene in den zwanziger Jahren. Aus Nazi-Deutschland musste das Ehepaar später emigrieren, nach Aufenthalten in Holland und Israel fanden sie schließlich mit ihren drei Töchtern in den USA eine neue Heimat.
Ihr erster Erkundigungsgang durch das schmutzige, schmelzende Glatteis grauer Straßen führte Käte Steinitz an einem trüben Regentag im Januar vor ein vornehmes Haus in der Königstraße 8, wo ein Ausstellungsplakat sie magisch anzog. Dieses Haus mit seiner noblen Fassade stammte noch aus dem vorigen Jahrhundert und hatte eine hohe Einfahrt für die Pferdekutschen. Im Innenhof stand das Kutscherhäuschen, ein kleines Fachwerkhaus, das später verschiedenen Künstlern als Atelier diente.
»Ich fand mich in einem wohltuend geschwungenen Treppenhaus und, oben angelangt, in wohlproportionierten Ausstellungsräumen«, schrieb Käte Steinitz viele Jahre später in ihrer neuen Heimat Amerika, über die für sie unvergessene Kestner-Gesellschaft, »deren Name mit großen Buchstaben im Inhaltsverzeichnis meines Lebens steht.
Zum ersten Mal sah ich das Werk von Paula Modersohn-Becker, zum ersten Mal Bilder aus Worpswede, dem norddeutschen Künstlerdorf, die mir mehr bedeuteten als romantische Heimatsentimentalität.
In den Ausstellungsräumen ging ein lebhaftes junges Paar herum, als wenn es hier zu Hause wäre. Es war tatsächlich hier zu Hause, denn es handelte sich um Paul Erich Küppers, den künstlerischen Leiter der Kestner-Gesellschaft, und seine junge Frau Sophie. Wir wurden schnell miteinander bekannt. Ich folgte den beiden ins Büro und subskribierte sofort die Mitgliedschaft für Dr. Steinitz und mich selbst. Von nun an würde sogar bei trostlosem Wetter ein bunter Fleck in Hannover zu finden sein.
Ich kehrte vergnügt in die Pension zurück, in der Dr. Steinitz und ich mit unseren zwei kleinen Kindern provisorisch Station genommen hatten. Das heitere junge Paar aus der Kestner-Gesellschaft erschien, zu meiner Freude, am Fenster gegenüber. Tatsächlich hausten die jungen Küppers in dem Eckhaus gegenüber unserer Pension sehr bescheiden, denn offenbar hatten die beiden nicht die volle Zustimmung zu ihrer Heirat von Sophies reichen Verwandten, die alle zu dem Verlagshaus der Fliegenden Blätter, Braun & Schneider, in München gehörten. Die Wohnung und Kleidung der jungen Küppers waren damals noch bescheiden, aber sie kauften bereits Werke von Nolde, Klee, Kirchner und Kandinsky.«
Gut erinnern kann sie sich an Wassily Kandinskys großes abstraktes Ölbild »Improvisation Nr. 10«, das der russische Künstler am 27. Juni 1910 gemalt hatte. »Ich sehe diesen Kandinsky genau vor mir; eine der frühen Abstraktionen, in der man noch die Herkunft von weiten hellen Landschaften mit rollenden Hügeln fühlen kann.«
Sophie Küppers hatte Kandinskys frühes Meisterwerk, das die Geburtsstunde der abstrakten Malerei einläutete, am 15. Oktober 1919 in der Berliner Galerie »Der Sturm« für rund 3000 Mark erworben. So jedenfalls war die Improvisation im Katalog ausgezeichnet. Das war für damalige Verhältnisse eine große Investition, nicht umsonst sprach Sophie später stets von »unserem wichtigsten Bild«. Noch ahnte niemand, dass dieses und andere Werke Kandinskys einmal für zweistellige Millionen-Dollar-Beträge gehandelt würden.
Sophie Küppers, die selbst künstlerisches Talent besaß, verfügte neben ihrem Fachwissen auch über einen untrüglichen Instinkt für die künftige Bedeutung von Künstlerpersönlichkeiten und deren Werken. So für den in Paris noch in großer Armut lebenden holländischen Maler Piet Mondrian, dem sie eine Komposition abkaufte und für den sie einige Jahre später Ausstellungen in Dresden und München organisierte.
In jener kurzen Zeit, die das Glück ihnen gönnte, verbrachten die Küppers zusammen mit den Ehepaaren Steinitz, Schwitters und Gleichmann 1919 und 1920 ihre Sommerferien auf der damals noch einsamen Nordseeinsel Baltrum.
Otto Gleichmann, Studienrat und als expressionistischer Maler zugleich poetischer Träumer und wilder Phantast, hatte sich sofort der neu gegründeten Kestner-Gesellschaft angeschlossen. Auch im gastfreundlichen Haus von Otto Gleichmann und seiner Frau, der Malerin Lotte Gleichmann-Giese, auf dem »Montmartre von Hannover«, oben über der Ecke Oster- und Windmühlenstraße in der Altstadt, verkehrten damals in den zwanziger Jahren Künstler wie Paul Klee, Hans Arp, Wassily Kandinsky, Otto Dix, Tristan Tzara mit einer Gruppe Dadaisten und etwas später El Lissitzky und Amédée Ozenfant. Und natürlich die stadtbekannten Originale Kurt Schwitters und Theodor Däubler, der Lyriker. Die Leute blieben auf der Straße stehen, wenn die mächtige Gestalt des großen Verehrers der griechischen Antike über die Georgstraße schritt, um im Café Kreipe in der Bahnhofstraße für die kleine Gunda-Anna Gleichmann je nach Saison Schokoladen-Osterhasen, -Weihnachtsmänner oder andere Süßigkeiten zu kaufen. Mit seiner kolossalen Körperfülle, die noch durch einen langen Mantel mit Pelerine betont wurde, dem üppigen Vollbart, einem breitkrempigen italienischen Hut, zerknitterten Hosen, einem Knotenstock und derben schwarzen Wanderstiefeln mit stets offenen Schnürsenkeln wirkte er wie eine Naturerscheinung.
Es herrschte eine anregende und heitere Atmosphäre im verwinkelten Haus der Gleichmanns mit seinen schiefen Dielen und den blau, gelb und rot gestrichenen Wänden – man lebte schließlich im Zeitalter des Expressionismus. Selbst die Küche, die nur über das Treppenhaus zu erreichen war, und das Kinderzimmer des Töchterchens Gunda-Anna wurden in die Festlichkeiten mit einbezogen. Nur das winzige Atelier des scheuen Meisters, in dem gerade mal eine Staffelei und eine Leinwand Platz fanden, war für die Gäste tabu.
Die würdige Maske des Studienrats sei von Gleichmanns Gesicht gefallen, je munterer und alkoholischer es bei den Künstler-Abenden zuging, erinnerte sich Käte Steinitz. »Dann sah man, dass er im Himmel und in der Hölle zu Hause war. In solchen Nächten aber war er in beiden zugleich.«
Die gemeinsamen Sommerferien der vier Ehepaare auf der Insel Baltrum waren eine glückliche Zeit trotz großer Einschränkungen, zu denen die Folgen des Ersten Weltkriegs zwangen. Mit Kartoffeln, Steckrüben und, wenn’s hoch kam, Frikadellen, mussten sich die Gäste begnügen. Käte Steinitz hat gemeinsame Urlaubsszenen festgehalten: »Zum Mittagessen trafen wir uns in einer großen Glasveranda, vor uns das Meer, auf dem Tisch das typische Nachkriegs-Pensionsessen. Fast jeden Tag erklang vom Küppers-Tisch das Frikadellen-Lied:
›Sind im Meere große Wellen,
Gibt’s bei Meyers Frikadellen.
Sind im Meere kleine Wellen,
Gibt’s bei Meyers Frikadellen.‹«
Während der Ferien arbeitete Paul Küppers an seinem Buch über den Kubismus, dem ersten in Deutschland, das über diese Kunstströmung des »Würfels« und seiner Interpreten wie Braque, Cézanne, Picasso, Léger oder Gleizes erschienen ist. »Den kubistischen Malern erschien der Kosmos als riesiger Kristall«, schrieb Käte Steinitz. »In unseren Kunstgesprächen erschien das kosmische Erlebnis wieder und wieder. Der Ozean mit seiner großen Brandung spielte mit uns kleinen Menschenkindern. Die stürmende Nordsee und die Wolken erregten wirklich Weltgefühle in uns. Aber zum Glück blieben wir irdische Menschen. Wer kann auch im trivialen täglichen Leben von früh bis abends ›kosmisch‹ sein bei einer Diät von Frikadellen? Paul Küppers tauchte durchgeschüttelt aus der Brandung auf und rief: ›Kinder, jetzt ist’s genug mit der Unendlichkeit und dem Kosmos. Der Kosmos hängt mir zum Halse raus. Kann man auf dieser Insel nicht irgendwo einen guten Hummer bekommen und eine Pulle Wein dazu?‹«
Paul Küppers war wirklich kein Kind von Traurigkeit. Das bezeugt eine Postkarte, mit der er sich am 14. Oktober 1920 aus Heidelberg bei den Gleichmanns folgendermaßen ankündigte:
»Liebe Gleichgebeine!
Wehe! Ich bin im Anzuge! (Cutaway!)
Wehe! Ich komme! Wehe! Der Umtrunk beginnt!
Wehe! Gänzliche Untergiftsetzung der Organe!
Herzlichst Wehe!
Euer Knabe Paul E. Küppers«
Im Frühjahr 1919 starb in München Sophies reicher Onkel Julius Schneider. Er hatte sich an sein Versprechen gehalten, das er ihrem Vater gegeben hatte, und hinterließ Sophie eine größere Erbschaft. »Kinder, wir sind reich«, teilte Küppers seinen Freunden jubelnd durchs Telefon mit – und lud sie ein zu Hummer und Wein.
Sie zogen in eine Wohnung mit acht Zimmern um und richteten sie mit schweren, gediegenen Möbeln und Ledergarnituren ein, in denen sich ein junges Paar heute kaum wohl fühlen würde. Doch das großbürgerliche Ambiente gehörte damals selbst in den fortschrittlichsten künstlerischen Kreisen zum guten Ton. Beherrscht wurden die Räume von riesigen Blumensträußen und natürlich von moderner Kunst. Nach und nach erwarben die Küppers, meistens vom Künstler persönlich, Arbeiten von Kurt Schwitters aus allen seinen verschiedenen Phasen, von Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Paula Modersohn-Becker, Wassily Kandinsky, Karl Schmidt-Rottluff, Albert Gleizes, George Grosz, Marc Chagall, Oskar Kokoschka und immer wieder von dem von beiden so geliebten Paul Klee.
In ihrem geselligen Haus fühlten sich Künstler, Dichter, Journalisten, Sammler, Kunsttheoretiker und Freunde der modernen Strömungen wohl. Niemand konnte den selbstgebackenen schinkengefüllten Splitterhörnchen oder dem mit Schokolade glasierten Marmorkuchen widerstehen, die Sophie ihren Gästen anbot, die um den Tisch unter dem großen Kandinsky saßen. Sie war eine perfekte Gastgeberin. Diese Kunstfertigkeit hatte sie, dem nachdrücklichen Wunsch der Mutter folgend, noch kurz vor ihrer Heirat in einer Haushalts- und Kochschule in Kiel gelernt. Dort gab es keinerlei Dienstboten – die Schülerinnen mussten alles selber machen. Zu Sophies Aufgaben gehörte es, beim Schweineschlachten die Zutaten für die Blutwurst zu rühren. Sie tat es mit wütender Entschlossenheit und hätte um nichts in der Welt ihren Ekel gezeigt. Den hätte ihr der Vater schon ausgetrieben.
Die Einladungen zu Vorträgen, Klavierkonzerten und Dichterlesungen im Hause Küppers waren Stadtgespräch. Der junge Pianist Walter Gieseking wurde noch als Student des Berliner Konservatoriums von Paul Küppers entdeckt. Er debütierte mit Debussy und Ravel auf dem ersten Konzertabend der Kestner-Gesellschaft. Küppers hatte ihm die damals noch seltenen Noten aus Berlin beschafft. Seine Interpretationen der Bach’schen Fugen, für die er später Weltruhm erlangen sollte, erklangen hier zum ersten Mal.
Schauspieler wie Alexander Moissi, Ernst Deutsch und Fritz Kortner rezitierten und spielten auf der neu gegründeten Kestner-Bühne. Ensembles aus Hamburg, Berlin und Leipzig zeigten den Hannoveranern zeitgemäße Dramatik wie Ibsens »Gespenster« oder Strindbergs »Fräulein Julie«. Auch die Dichterlesungen mit Franz Werfel oder Else Lasker-Schüler wurden zu Sternstunden in Hannovers Kulturleben.
Im Anschluss an die Aufführungen folgten oft lange, alkoholgetränkte Sitzungen in der Küppers-Wohnung. Aber man war nie so wild, wie man nach außen hin tat. Selbst Lieder, wie dieses, zu später Stunde lautstark gesungen –
»Wir wollen uns mit Sekt berauschen,
wir wollen unsere Weiber tauschen,
wir wollen uns mit Dreck beschmieren,
und überhaupt ein freies Leben führen«
– waren, so Käte Steinitz, »absolute Angeberei. Alle drei Ehemänner, Küppers, Gleichmann und Steinitz, waren außerordentlich zufrieden mit ihren eigenen Gattinnen und auch von unserer weiblichen Seite kam ein Tausch überhaupt nicht in Frage. Wir drei Frauen saßen müde und bereit zum Nachhausegehen auf den Treppenstufen und warteten auf die Männer. Jede von uns erwartete legalen Familienzuwachs.
Die Küppers konnten sich für keinen Namen entscheiden. So hatte ich ihnen ein kleines Wörterbuch der deutschen Vornamen mitgebracht. Das Geschenk wurde mit Freuden angenommen, aber nachdem die mehr als tausend Vornamen sorgfältig durchgelesen waren, wurde der neue kleine Küppers einfach Hansi genannt.« Sein drei Jahre älterer Bruder Kurt war bereits 1917 zur Welt gekommen.
Damals, im Jahr 1920, hielt der Kunsthistoriker Karl With in der Kestner-Gesellschaft Vorträge über ostasiatische Kunst. Käte Steinitz erzählte dazu folgende Geschichte:
»Karl With suchte Küppers in seinem schönen Haus auf und fand ihn wunderbar echt. Großartig war sein Verständnis und sein Enthusiasmus für das Kunstgeschehen der Zeit. Welche Entdeckerfreuden! Welches Glück, dass die Wogen der Zeit ihn nach Hannover geschwemmt hatten. Hier war dasselbe Suchen und Finden. Hier war stimulierendes Leben, nicht von außen angekurbelt, sondern von innen heraus. Am Nachmittag vor Karls erster Lesung saß er in ernster Vorbereitung an Küppers’ Schreibtisch. Da kamen Walter Gieseking und ein paar andere Freunde. Es wurden Geschichten erzählt und Witze gemacht. In irgendeinem Zusammenhang fiel das Wort ›sexuelle Stubenreinheit‹. Der sonst so schweigsame Gieseking sagte lachend zu Karl With, wenn er den Ausdruck in den ersten zehn Minuten seines Vortrages in den Text einfüge, werde er eine Kiste Sekt spendieren.

Sophie, Tilly (Sophies Schwester), Lulu (Tochter von Tilly), Mathilde Schneider (Sophies Mutter), Julius, Hermann Schneider (Sophies Brüder), München 1928 (Foto: privat)

Der Salon von Sophie und Paul Erich Küppers’ Wohnung in Hannover, zwanziger Jahre; an der Wand Kandinskys »Improvisation Nr. 10« (Foto: privat)
Ich saß während des Vortrages neben Gieseking, der keine Miene verzog. Als aber die ›sexuelle Stubenreinheit‹ schon genau sieben Minuten nach Anfang des Vortrages mit leichter Zunge wie selbstverständlich ausgesprochen wurde, schüttelte mich ein Lachanfall so sehr, dass ich mich schnell aus dem Vortragssaal in die frische Luft retten musste.
Hinterher wurde der Sekt getrunken, und dann zog die angeheiterte Gesellschaft zu der Galerie von Garvens weiter. Ringelnatz war dabei, Hanns Krenz (ab 1924 Geschäftsführer der Kestner-Gesellschaft) und Max Burchartz (der expressionistische Maler war der Taufpate von Hans Küppers), es wurde eine wunderbare ein bisschen besoffene Feier, die bis in den frühen Morgen dauerte …«
Es kam die Nacht der Jahreswende von 1921 zu 1922. Auch das Ehepaar Steinitz wurde zur Silvestergesellschaft bei den Küppers erwartet, konnte die Einladung aber nicht annehmen, weil ihre Kinder erkrankt waren und sie deswegen zu Hause bleiben mussten.
»Außerdem«, so Käte Steinitz, »hatten wir Erwachsenen eine leichte Grippe, die man damals Influenza nannte. Küppers rief durchs Telefon: ›Kinder, macht es so wie ich, gurgelt mit Kognak.‹
Entweder hat er zu viel oder zu wenig gegurgelt, wahrscheinlich zu viel. Am Neujahrstag zitterten die Telefondrähte voller Angst.« Seine Gesundheit war nach der ausgeheilten Tuberkulose stets labil geblieben. Diese Infektionskrankheit, die hauptsächlich die Lunge befällt, erlangte damals als »spanische Grippe« traurigen Weltruhm: 700 Millionen Menschen erkrankten an der Epidemie, 22 Millionen fielen ihr zum Opfer – mehr als doppelt so viele, wie der Erste Weltkrieg an allen Fronten gekostet hatte. Eine Woche lang kämpfte der junge Küppers gegen eine schwere Lungenentzündung. Es gab noch kein rettendes Penizillin, das erst sechs Jahre später von Alexander Fleming entdeckt werden sollte.
Am 7. Januar 1922 war das kurze Leben von Paul Erich Küppers zu Ende.
Gunda-Anna Gleichmann-Kingeling, die Tochter des Malerehepaars Gleichmann, die heute hochbetagt in Hannover lebt, schildert die folgenschwere Silvesterfeier, wie die Eltern es ihr erzählt hatten:
»An einer langen opulenten Tafel, nur bei Kerzen, die in hohen Leuchtern glänzten, saßen die Gäste, zunächst fast in Schweigen gehüllt. Sie waren zum Teil in Frack und Zylinder gekommen. Plötzlich stand Küppers auf, schlug mit seinem Zylinder auf den Tisch und donnerte laut: ›Was ist denn hier eigentlich heute los? Warum ist denn alles so stumm? Das ist ja wie bei einem Leichenbegängnis!‹ Von dieser Sekunde an schlug die Stimmung hohe Wellen. Es wurde ein wildes Fest. In fortgeschrittener Nacht setzte sich Walter Gieseking an den Flügel und spielte, wie man es damals nannte, Negermusik. Er haute mit irrsinnigen Dissonanzen in die Tasten, bearbeitete sie vom tiefsten Bass bis zu den höchsten Tönen, stieß den Klavierhocker zur Seite, kletterte auf den Flügel und spielte bäuchlings von oben weiter. Am Schluss setzte er sich mit dem Hinterteil auf die Tasten. Es wurde getanzt und getanzt, wie auf einem Vulkan. Gegen Morgen brachte Küppers meine Eltern als letzte zur Haustür, trat noch ein paar Schritte mit ihnen hinaus in die frisch beschneite Nacht, fasste sich an die Brust und sagte: ›Gleichmann, ich weiss nicht, was das ist, meine Rippchen tun mir so weh …‹ Meine Eltern fuhren am selben Morgen in den Harz. Als sie nach acht Tagen in froher Stimmung erholt zurückkamen, fiel ihnen beim Öffnen der Wohnungstür aus dem Briefkasten ein schwarz umrandetes Kuvert entgegen. Es war die Anzeige vom Tode Paul Erich Küppers’.«
Sophie fiel aus ihrem pastellfarbenen Traum von Liebe, Glück und Kunst in das harte Licht der Wirklichkeit. Obwohl sie einen schweren Zusammenbruch erlitten hatte und lange das Bett hüten musste, schrieb sie ihren Schmerz in nur wenigen dürren Worten nieder: »Jubelnd gingen wir mit unseren Freunden in der Neujahrsnacht in das Jahr 1922 hinüber. Walter Gieseking spielte uns auf. Da war das Glück zu Ende! Am 7. Januar 1922 starb Paul Küppers, gerade 32jährig, an der spanischen Grippe, die damals Deutschland heimsuchte. Ich aber musste weiterleben für meine beiden kleinen Söhne Kurt und Hans, die man mir Schwerkranken ans Bett brachte. Es war entsetzlich, sich wieder allein im Leben zurechtfinden zu müssen.«