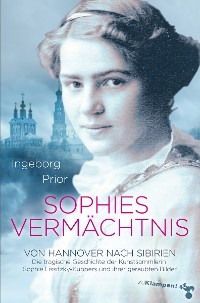Kitabı oku: «Sophies Vermächtnis», sayfa 4
Sophie Küppers fuhr damals von Hannover öfter nach Berlin, um Künstler in die Kestner-Gesellschaft einzuladen. Sie erlebte die Metropole mit wachem Verstand und kritischer Distanz. Und notierte voller Empörung:
»Wie sahen denn jene goldenen zwanziger Jahre aus? Nach dem verlorenen Krieg, nach der verspielten Revolution, nach dem politischen Bankrott der sozialistischen Parteien brachten die ersten vier Jahre des Jahrzehnts den berühmten Regierungsschwindel, die deutsche Inflation, durch die eine kleine Machtgruppe den größten Teil des deutschen Volkes wirtschaftlich, politisch und moralisch ruinierte, bis ein Laib Brot eine Milliarde, ein deutsches Mädchen eine Zigarette, und das deutsche Gewissen gar nichts kostete … Die goldenen zwanziger Jahre waren nur Dublee.«
Bei einem ihrer Besuche traf sich Sophie mit El Lissitzky. Gemeinsam schauten sie sich Charlie Chaplins ersten Kinofilm »The Kid« an. Die anrührende Geschichte einer Freundschaft zwischen dem armen Vagabunden und dem Findelkind bewegte nach Amerika auch hier die Gemüter und füllte die Kassen. Sophie war gerührt von der Darstellungskunst dieses volkstümlichen und zugleich philosophischen Narren, von der Ausdruckskraft seiner Augen und Hände und von seinem »todernsten Humor«.
Lissitzky nahm sie mit in seinen Berliner Künstlerkreis. Mit Werner Graeff, Hans Richter, Raoul Hausmann, Hanna Höch und weiteren Künstlern traf man sich im gastlichen Atelier von László Moholy-Nagy und seiner Frau Lucia. Lebhaft wurde über die neue Sachlichkeit, Gegenständlichkeit und Zweckmäßigkeit diskutiert – über die Grundsätze des Weimarer Bauhauses, dessen Gründer und Leiter Walter Gropius eine Schar begabter junger Künstler um sich versammelt hatte. Lissitzky erzählte seinen deutschen Freunden von den großen Aufgaben, die für Künstler und Architekten in Russland durch die Revolution entstanden waren. Die technische Rückständigkeit war seiner Meinung nach das größte Hemmnis für die Entwicklung einer neuen sozialen Gemeinschaft.
Bei ihrer ersten Begegnung in Hannover hatte Sophie El Lissitzky als bescheiden und zurückhaltend erlebt. Hier erkannte sie ihn kaum wieder: »Scharf und schonungslos konnte er gegen die abstrakte Seele losfahren, die die verängstigten Expressionisten jeder auf seine Weise zu verteidigen suchten.« Wenn die Unterhaltung mit seinen Landsleuten besonders heftig wurde, fiel er ins Russische zurück. Sie liebte sein Temperament.
Es wimmelte nur so von Russen in diesem Berlin! Über 100 000 lebten hier um 1920. Und es wurden immer mehr. 1923 sollen es nach Schätzungen von Hilfsorganisationen über 360 000 gewesen sei. Zu der starken Kolonie zählten sowohl Emigranten, die nach der Oktoberrevolution geflohen waren, als auch zahlreiche Intellektuelle, wie El Lissitzky oder Ilja Ehrenburg, die Berlin zu ihrem strategischen Zentrum für die Verbreitung sowjetischer Politik und Kultur gemacht hatten.
Die Berliner tauften die Gegend zwischen Charlottenburg und Zoo scherzhaft »Charlottengrad«. Die Russen nannten diesen Teil Berlins »Petersburg« und fuhren mit der »Russenschaukel«, dem Kurfürstendamm-Bus, Richtung Halensee. Und wer weiß, vielleicht wäre der Kurfürstendamm eines Tages ja in Kurfürsten-Prospekt umbenannt worden.
Im vornehmen Kaufhaus des Westens am Wittenbergplatz sah man vor allem modehungrige Damen und Herren aus Russland und anderen östlichen Ländern. Die deutschen Kunden zogen dem KaDe We die billigeren Kaufhäuser um den Alexanderplatz vor.
Im Restaurant »Zum Bären« servierten ehemalige Offiziere aus russischen Adelsfamilien. Im »Café Petersburg« am Wittenbergplatz war der Kellner früher mal russischer Diplomat gewesen. Und im Kino riss abends eine einstige Hofdame der Zarenfamilie die Eintrittskarten ab. Es gab sogar einen russischen Berlin-Führer. Der listete 1923 über 30 Berufsverbände, Parteigruppierungen, Hilfswerke auf, sechs russische Banken, 87 russische Verlage und 20 russische Buchläden, dazu Schulen, wissenschaftliche Institute und jede Menge Restaurants, Cafés, Cabarets und Nachtclubs.
Sehr beliebt bei Einheimischen und Zugereisten war das ursprünglich in Moskau gegründete Cabaret »Der blaue Vogel«, in dem russische Künstler sangen, tanzten und Theater spielten. Hier triumphierte die Balalaika über das Jazz-Saxophon.
Auch Alexander Tairow mit seinem Moskauer Kammertheater gab mehrere umjubelte Gastspiele in Berlin. Er wollte das Theater von seinen erstarrten Formen befreien und fand in Lissitzky einen kongenialen Illustrator seiner Ideen. 1923 erschienen Tairows »Aufzeichnungen eines Regisseurs« unter dem Titel »Das entfesselte Theater« mit der Einbandgestaltung von El Lissitzky.
Mit seinen Landsleuten traf sich Lissitzky häufig im Romanischen Café, in der Prager Diele oder im Café Leon am Nollendorfplatz. Bei Tee und Tabak redete man sich oft nächtelang die Köpfe heiß. »Selbst hier befasste er sich fortwährend mit Erfinden«, schrieb Ilja Ehrenburg über den Freund. Auch er war einer der Stammgäste, wie Aleksej Tolstoi, bekannt als »der rote Graf«, Boris Pasternak, Wladimir Majakowskj und Naum Gabo. Als eines Tages der junge Lyriker Sergej Jessenin, geliebt für seine leidenschaftlichen Verse, aber auch berüchtigt für seine alkoholischen Exzesse, mit seiner ihm gerade angetrauten Ehefrau Isadora Duncan das Café betrat, erhoben sich die Anwesenden und sangen spontan die Internationale – zu Ehren der amerikanischen Ausdruckstänzerin, die als begeisterte Anhängerin der Revolution auf der Theaterbühne zu den Klängen der Internationale zu tanzen pflegte.
Gemeinsam mit Ehrenburg gab Lissitzky Anfang 1922 die erste pro-sowjetische Zeitschrift »Der Gegenstand« heraus, um – dieses Ziel hatte sie beide nach Berlin geführt – den in Russland lebenden Künstlern mit diesem dreisprachigen Journal ein Fenster zum Westen zu öffnen und den westlichen Lesern einen Blick auf die vielfältigen kulturellen Aktivitäten in der Sowjetunion zu ermöglichen. In die Liste prominenter Autoren reihten sich Charlie Chaplin, Le Corbusier, Fernand Léger, Kasimir Malewitsch, Boris Pasternak und viele andere ein. Lissitzky selbst konnte in den wenigen Ausgaben bis zu seiner Abreise aus Berlin seine typografischen, der Architektur und der Fotografie nahen Ideen verwirklichen. Die hoch entwickelte deutsche Technik gab dem russischen Künstler nicht nur die Möglichkeit zu kühnen Träumen, sondern auch zu deren praktischer Umsetzung.
Ilja Ehrenburg schrieb in seinen Memoiren über die zwei Gesichter des Weggefährten:
»Lissitzky glaubte steif und fest an den Konstruktivismus. Im Leben war er weich, ausgesprochen gütig, zuweilen naiv. Seine Gesundheit war anfällig. Er verliebte sich, wie man sich im vorigen Jahrhundert zu verlieben pflegte: blind und selbstlos.
Aber in der Kunst glich er einem unbeugsamen Mathematiker, inspirierte sich an der Präzision, machte die Nüchternheit zur Wahnidee. Er war ungemein einfallsreich. Er konnte einen Ausstellungsgegenstand so gestalten, dass die Dürftigkeit der ausgestellten Dinge den Anschein der Überfülle erweckte. Er verstand es, ein Buch in einer ganz neuartigen Weise aufzugliedern. In seinen Zeichnungen spürt man den Farbensinn genauso stark wie die Meisterschaft der Komposition.«
5. Sophies Wahl
Die Inflation überschlug sich. Bilder gab es nur noch gegen ausländische Valuta zu kaufen. Sophie Küppers’ Ausstellungsbetrieb verschlang alle Reserven aus dem Erbe ihres Onkels. Aber sie dachte nicht daran, aufzugeben. Am 6. März 1923 hielt der wieder einmal aus Berlin angereiste Lissitzky in der Kestner-Gesellschaft einen Vortrag über die »Neue Russische Kunst«. Sophie hatte zuvor mit ihm den Text mehrfach geprobt – seine harte Aussprache und seine Probleme mit den deutschen Artikeln machten ihn manchmal schwer verständlich und erregten Heiterkeit im Auditorium. Sie notierte über den Abend:
»Das gutbürgerliche Publikum, dem vieles, was Lissitzky vortrug, vollständiges Neuland war, folgte aber wie gebannt seinen geistvollen Ausführungen. Man wurde aufgerüttelt von dem Neuen, das dieser russische Künstler aus dem Land der Revolution mitbrachte. Als Sohn der Oktoberrevolution zeichnete Lissitzky eine begeisternde neue Welt. Das waren keine gefärbten Zeitungsberichte, sondern Tatsachen, Perspektiven für die Zukunft, über die einer berichtete, der um die Verständigung zwischen dem fast isolierten Russland und dem Westen bemüht war, der dabei war in den ›10 Tagen, die die Welt erschütterten‹.«
Durch die Vermittlung seines Freundes Kurt Schwitters wohnte er zunächst in der pompösen Villa des Galeristen Herbert von Garvens. Obwohl Lissitzky die Annehmlichkeiten eines prächtigen und vor allem funktionierenden Bades zu schätzen wusste, kam er sich in den riesigen Räumen doch recht verloren vor. Immer häufiger besuchte er Sophie, freundete sich mit ihren Söhnen Kurt und Hans an.

El Lissitzky, »Neuer«, Lithographie, 53 x 45,4 cm, Blatt 10 der »Figurinenmappe. Die plastische Gestaltung der elektromechanischen Schau ›Sieg über die Sonne‹«, in 75 Exemplaren erschienen, R. Leunis u. Chapman, Hannover 1923. (Foto: Verlag der Kunst, Dresden)
Seine erste Kestner-Mappe mit Lithographien seiner Proun-Bilder wurde von den Auftraggebern mit Begeisterung aufgenommen. Man riss sich geradezu um diese imaginären Welten aus Linien, Quadraten und Rechtecken, die scheinbar dreidimensional im Raum schwebten. Sie schmückten manches Hannoversche Heim, und natürlich auch das von Sophie Küppers.
Für seine zweite Mappe farbiger Lithografien wählte Lissitzky den Stoff der russischen futuristischen Oper »Sieg über die Sonne«, womit er wieder zu seinen Anfängen zurückkehrte – sein Lehrer und Gefährte Malewitsch hatte die ursprünglichen Bühnenbilder und Kostüme für die Oper entworfen. Die mechanischen Puppen gleichenden Figurinen nannte Lissitzky »Ansager«, »Wachtposten«, »Globetrotter »Sportsmann«, »Zankstifter«. Und natürlich war auch ein »Erneuerer« unter ihnen – als Künstler kannte Lissitzky kein Gestern, für ihn zählte nur das Heute als Wendepunkt zum Morgen. »Der Erneuerer« oder auch »Der Neue« wurde einer seiner berühmtesten Prounen. Lissitzky hatte die Lithografie zunächst als Ölbild gemalt, das Dr. Alexander Dorner, der spätere künstlerische Leiter der Kestner-Gesellschaft, erworben hatte. Es hing mehrere Jahre in seinem privaten Arbeitszimmer. Dorner, als Pionier der modernen Kunst weit über Deutschlands Grenzen hinaus hoch geschätzt, war den Nazis genau aus diesem Grund verhasst. Nachdem er im Januar 1937 entlassen wurde und sogar um sein Leben fürchten musste, flüchtete er mit seiner Frau Lydia über Paris nach Amerika. Die Gestapo, die ihn abholen wollte, kam zu spät. Sie stand vor den verschlossenen Türen eines menschenleeren Hauses. Den großen Lissitzky-Proun hatte Dorner zuvor in einen Teppich gerollt und diesen über den Großen Teich geschickt. Der Teppich kam zwar an, aber ohne das Bild. So jedenfalls schilderte es später seine Witwe. »Der Neue« ist bis heute verschollen.
Die Freundschaft mit Sophie und ihren kleinen Söhnen veränderte das Leben des einsamen Künstlers Lissitzky grundlegend, das bisher hauptsächlich von künstlerischen Emotionen geprägt war. Da es ihm schwer fiel, in der lebhaften Villa von Garvens’ ungestört an seinen Entwürfen zu arbeiten, bat Sophie den Vorstand der Kestner-Gesellschaft, ihm den ehemaligen Gesellschaftsraum im dritten Stock des Hauses in der Königstraße als Atelier zu überlassen.
»Ich bin nicht gewohnt, dass sich jemand um mich kümmert. Ihr Vorschlag über das Wohnen in der Kestner-Stube ist viel, viel mehr als lieb«, schrieb er ihr von einem kurzen Aufenthalt aus Weimar. Manchmal saß Sophie stundenlang schweigend in einer Ecke seines Ateliers und beobachtete ihn bei der Arbeit. Sie sah zu, wie er seine mechanischen Figuren mit sicherem Strich direkt auf den Stein zeichnete. Er liebte ihre stille Gegenwart. Die Probedrucke, in deren Ecken ein winziges aus »El« und »S« verschlungenes Monogramm versteckt war, schenkte er Sophie. Sie verrieten ihr, was er noch nicht auszudrücken wagte.
El Lissitzky und Kurt Schwitters waren trotz der Gegensätzlichkeit ihrer Kunstauffassungen Freunde geworden, verbrachten viel Zeit miteinander. Sophie bestaunte die erste »Merzsäule« des Dadaisten: »Sie war noch aus dem Material der Abfallkisten aus Kriegszeiten konstruiert, hatte geheime, unbeschreibliche Einbauten. Für mich war oftmals die Grenze zwischen Originalität und Wahnsinn der Schwitters’schen Schöpfungen, seien sie nun plastisch oder literarisch, nicht klar erkennbar«, notierte sie, bewundernd und verwundert.

Sophie Lissitzky-Küppers, Fotocollage von El Lissitzky, 1928 (Foto: privat)

»Die Brüder«, Fotocollage von El Lissitzky, 1929; links Kurt, rechts Hans Küppers (Foto: privat)
Sophie organisierte weiter Ausstellungen, obwohl der Wert des Geldes inzwischen ins Bodenlose gesunken war. Zusammen mit El Lissitzky – die beiden galten inzwischen in der Gesellschaft Hannovers als Paar, obwohl sie sich immer noch respektvoll siezten – plante sie eine Reise nach Hamburg, um dort für Hannover eine »Negerkunst-Ausstellung«, wie damals Volkskunst aus Afrika und Ozeanien genannt wurde, vorzubereiten. Durch Paul Küppers hatte sie Verbindungen mit dem dortigen Völkerkunde-Museum und seinem Chefeinkäufer. Doch schließlich musste sie allein fahren, Lissitzky hustete, war erkältet und fühlte sich schlecht, drängte aber darauf, dass sie ohne ihn reiste. Sophie ließ den Kranken nur ungern allein in seiner Kestner-Stube. Als sie nach wenigen Tage zurückkehrte, fand sie den Freund mit hohem Fieber. Ihr Hausarzt stellte eine Lungenentzündung fest und verordnete strenge Bettruhe. Doch kaum war das Fieber etwas gesunken, arbeitete er schon wieder wie ein Besessener, obwohl er sich nach wie vor schlecht fühlte. Im jüdischen Krankenhaus, das ihr Freund Dr. Steinitz leitete, wurde bei einer Röntgenaufnahme eine große Kaverne in der Lunge entdeckt. Er wollte seine schwere Krankheit nicht wahrhaben. Ohne Sophie an seiner Seite hätte er sein Leben damals wohl weggeworfen.
»Mein Freund war verzweifelt, hatte Selbstmordgedanken. Ich versuchte, ihn zu überzeugen, dass er nicht das Recht habe, sein Leben auszulöschen, dass er verpflichtet sei, seine außerordentliche Begabung durch neue große Arbeiten zu beweisen. Ich bot ihm an, ihm dabei zu helfen. Er wollte keine Opfer – aber konnte dann verstehen, dass es keine Opfer gibt, wenn man wirklich liebt. Mich hatte zuerst sein Werk zutiefst berührt, dann erwies sich der Mensch Lissitzky als außerordentlicher Freund. In unserer tiefsten Not kamen wir einander ganz nah. Ich konnte den geliebten Menschen nicht im Stich lassen.«
Wieder erinnerte sie sich an die Worte ihres Vaters.
Sophie bat die Freunde um Hilfe, Lissitzky brauchte dringend ein anderes Klima. Dr. Steinitz empfahl ein Sanatorium in der Südschweiz, Richard Oppenheimer und Kurt Schwitters halfen mit Geld aus. Und Fritz Beindorff, im Vorstand der Kestner-Gesellschaft und Geschäftsführer der Pelikan-Werke, sorgte dafür, dass Lissitzky von der Firma Günther Wagner Reklameaufträge für Pelikan bekam, die ihm, nachdem im Oktober 1923 zur Überwindung der Inflation eine neue Währung eingeführt worden war, ein monatliches Einkommen von 300 Rentenmark garantierte. Diese Sicherheit verlangte die Schweizer Passkontrolle, denn zahlreiche Abenteurer und Spekulanten flohen damals mit leeren Taschen aus dem inflationären Deutschland, um ihr Glück in der soliden Schweiz zu suchen.
Das Weihnachtsfest 1923 feierte Lissitzky noch mit Sophie und ihren Söhnen in Hannover. Er mochte diese warme deutsche Gemütlichkeit, die so ganz anders war als das karge »revolutionäre« Leben, das er führte. Kurt und Hans bekamen von ihrem Freund »Lissi« ein selbst gezeichnetes und aquarelliertes Bilderbuch geschenkt, »Das neugierige Elefantlein«. Zu den Bildern erfand er die komischsten Geschichten. Die Jungen waren begeistert. Lissitzky hatte ein großes Herz für Kinder, und das nahm Sophie besonders für ihn ein.
Anfang Januar mussten die Liebenden Abschied nehmen. Über Berlin, wo Lissitzky noch eine eigene Ausstellung im Graphischen Kabinett I.B. Neumann organisieren konnte, reiste er schließlich mit der Eisenbahn in die Schweiz. Der Erfolg der Ausstellung gab ihm zwar neue Kraft, aber sein Zustand war Besorgnis erregend.
Über ein Jahr lebte Lissitzky im Tessin. Es wurde ein aufreibendes und zugleich kreatives Jahr, schwankend zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Phasen fiebriger Schaffenskraft wechselten mit lähmendem Nichtstun, zu dem ihn die Krankheit zwang. Ohne Sophie wäre El Lissitzky verloren gewesen. In dieser Zeit entwickelte sich zwischen den Liebenden ein lebhafter Briefwechsel, unterbrochen von zwei Besuchen Sophies. Nur Lissitzkys Briefe sind erhalten geblieben. Doch wer zwischen den Zeilen zu lesen vermag, wird dort auch etwas von den Gedanken, Wünschen, Sehnsüchten und Ängsten Sophies finden. Die »mère des bolcheviks« entpuppte sich nun als wahre »Mutter Courage«. Er redete sie in seinen Briefen mit »Mutti, Muttilein, Mamascha, Towarischtsch-Geliebte, Du meine Alte« und auch schon mal mit »Genossin« an, und unterschrieb als »Dein blöder, Dein dummer, Dein Trottel Lis«. Sie war seine Geliebte, Mutter, Muse, Trösterin, Ratgeberin, die Organisatorin und Vermittlerin seiner vielfältigen Aktivitäten. In ihren starken Armen, an ihren weichen Brüsten ließ es sich gut leben – und zur Not auch sterben.
In diesem Jahr, das trotz seiner Krankheit zu seiner schöpferischsten Phase wurde, tüftelte Lissitzky mit Kurt Schwitters, den er freundschaftlich Kurtchen nannte, an der Herausgabe seines Merz-Heftes »Nasci«, er entwarf Reklame für Pelikan-Tinte, -Kohlepapier und -Siegellack. Immer mehr experimentierte er mit der Fotografie, nachdem ihm Sophie die alte Kamera ihres Vaters geschenkt hatte, ein wahres Ungetüm mit Holzkassetten. Hier entstand sein berühmtes Selbstporträt »Der Konstrukteur«, das in die Geschichte der modernen Fotografie einging – in den Kopf montierte er seine Hand mit einem Zirkel. Er übersetzte Malewitschs Traktat über Lenin, den er verehrte, und ein Buch von Malewitsch über den Suprematismus ins Deutsche. Mit Mies van der Rohe bereitete er die Zeitschrift »G« vor. Er entwarf sein kühnes Projekt »Wolkenbügel«, ein Hochhaus auf drei »Beinen«, geplant als Bürobau in Moskau – und er schickte lustige Briefzeichnungen an Kurt und Hans. So skizzierte er sich selbst, flach im Bett liegend, mit einem Riesen-Samowar samt Gesicht, das den Betrachter anlacht, auf dem Bauch. Dazu schrieb er: »So, lieber Hani, sieht der Lissi mit dem Samowari aus.«

El Lissitzky, »Pelikan-Tinte«, Fotogramm, Russisches Staatsarchiv für Literatur und Kunst, Moskau
Sein holländischer Architekten-Kollege Mart Stam, der den Kranken im Tessin besuchte, schrieb über ihn: »Lissitzky war ein Mensch voller Begeisterung, übersprudelnd von Ideen. Es ging ihm in allem darum, mit zu helfen, zum Wohle einer kommenden Generation eine inhaltsreichere Umwelt zu schaffen.«
Lissitzkys Briefe an Sophie wechselten zwischen Larmoyanz, Begeisterung für ein neues Projekt, Verzweiflung, Sehnsucht und Ungeduld. Dann wieder entschuldigte er sich dafür, dass er sie so quäle mit seinen Wünschen, Bitten und Aufträgen. Ein selbstlos Liebender war er gewiss nicht, das Ich des Künstlers stand immer im Vordergrund. Doch in Sophie hatte er seine Ergänzung gefunden: voller Bewunderung für das Genie, voller Enthusiasmus für seine Pläne, voller Mitleid mit dem Kranken, voller Liebe für den Gefährten war sie dennoch stark genug, ihre eigenen Interessen zu verfolgen, weiter im Gespräch mit Künstlern zu bleiben und mit ihnen Ausstellungen zu organisieren.
In Orselina, einem kleinen Tessiner Bergdorf hoch über Locarno und dem Lago Maggiore, hatte Lissitzky in der Villa della Planta ein billiges Pensionszimmer und freundliche Wirtsleute gefunden, die sich um ihn kümmerten. »Das ist eine einfache Pension«, schrieb er an Sophie, »jetzt sind hier nur Schweizer. Sehr gemütlich und liebe Wirtsleute. Ich habe ein schönes Zimmer mit Balkon nach Süden. Und dann ist noch ein Häuschen im Garten, das man mir als Atelier zur Verfügung stellt.«
Zum Nichtstun verurteilt, verbrachte er oft Stunden auf dem Balkon in der frischen Luft. Die Strahlen der Märzsonne wärmten bereits. Und während die blühenden Magnolien ihren Duft zu ihm herüberwehten, blickte er auf das sonnenglitzernde weiße Alpenpanorama über dem See. Doch die Schönheiten der Natur nahm dieser unruhige Geist kaum wahr. Er registrierte lediglich, dass der Lago Maggiore nicht so blau war wie auf den Postkarten. Und beklagte sich darüber, dass die Post so lange dauerte. Auf die Briefbogen malte er lustige Zeichnungen für Kurt und Hans und zwei ineinander verschlungene Hände, die eines Mannes und einer Frau, für Sophie.
Wenn Sophie dem Kranken vorsichtig ihre finanzielle Notlage und den allgemeinen Niedergang des Kunsthandels schilderte, versuchte er sie zu trösten: »Der Frühling und Sommer sind in Sicht, und alle brauchen ihr Geld für Italien. Was mich anbelangt, sei ruhig, ich mache mir keine Geldsorgen. Ich habe immer nur dann über Geld nachgedacht, wenn in der Tasche nur Wind geblieben ist«, schrieb er ihr.
Mit solchem »Trost« konnte die bodenständige Sophie nur wenig anfangen. Doch trotz ihrer Sorgen musste sie über die kindliche Naivität ihres Gefährten lächeln.
Die Nachrichten über den Verlauf seiner Krankheit beunruhigten Sophie. Eine neue Fieberattacke quälte Lissitzky. Er schrieb an die Geliebte: »Alle Gelenke zerbrochen, Kopf brennt, Lunge sticht, Fieber um 39°. Der Arzt kam. Es hatte sich Wasser gebildet, aber er meinte, dass das häufig so sei bei einem Pneumothorax. Er will mich unbedingt in ein Sanatorium einweisen.«
Sophie bemühte sich um ein Visum für die Schweiz, was ohne die Hinterlegung einer größeren Bürgschaft völlig ausgeschlossen war. Wieder halfen die Freunde mit Geld – und Sanitätsrat Catzenstein stellte ihr eine Bescheinigung aus, dass sie der einzige nahe stehende Mensch sei, der ihn jetzt, da Lebensgefahr bestand, unterstützen könne.
Sie fand ihren Lissi, in Wolldecken gehüllt, auf dem Balkon seiner Pension liegend. Er war sehr geschwächt und hatte noch immer Fieber. Ein rosa Azaleenbäumchen hob sich frühlingshaft vom grünlich schimmernden See und den weißen Bergen dahinter ab. Es duftete nach Mimosen. Die Blätter der hohen Palmen, die hier in diesem südlichen Klima gedeihen, raschelten wie Papier im Wind. Die Glocken der kleinen Dorfkirche schickten melodische Töne herüber. Es hätte ein Paradies sein können – wenn dieser arme Mensch nicht so krank gewesen wäre. Doch Sophies Liebe und Fürsorge wirkten Wunder. Nach einer Woche konnte Lissitzky wieder aufstehen. Seine alte Energie kehrte zurück, er freute sich, dass sie mit den Kindern den ganzen Sommer über kommen wollte. Nachbarn boten ihnen ein Häuschen in dem Nordtessiner Bergdorf Ambri-Sotto an, das sie in den Sommermonaten gegen eine geringe Miete bewohnen konnten. Beglückt registrierte Sophie die Fortschritte, die der Kranke machte: »Sein Schritt bekam wieder die alte Elastizität, er trat mit den Hacken zuerst auf, entschieden, bestimmt, schnell und leicht. Nur das Wasser, das sich in seiner Brust angesammelt hatte, gluckerte bei jedem Schritt.« Einigermaßen beruhigt ließ sie ihren kranken Freund in zuversichtlicher Stimmung und mit neuen Kräften zurück.
Harmonische Sommerwochen in Ambri-Sotto, die in einen leuchtenden Herbst übergingen. Sophie kam mit ihren Jungen, ihrer treuen Hausgehilfin Emma und einem Berg von Koffern angereist. Sie machten es sich in dem einfachen, aus Granitsteinen erbauten Bauernhaus gemütlich, das so recht nach dem Geschmack Lissitzkys war, und das er »unser Schloss« nannte. Mit einer großen Feuerstelle in der Küche erinnerte es ihn ein wenig an die Datschen seiner russischen Heimat. Im Keller hatte er ein Fässchen mit Tessiner Rotwein gelagert. Es sollte ihnen gut gehen.
Das Künstler-Ehepaar Hans Arp und Sophie Taeuber-Arp kam zu Besuch. Arp und Lissitzky arbeiteten an einer gemeinsamen Publikation: Das Buch, »Die Kunstismen« genannt, sollte eine Art Führer durch die Strömungen, die »Ismen« der Moderne, von der Malerei bis zum Film, werden. Die beiden Männer diskutierten heftig und kontrovers. Trotz dieser Spannungen wurde das Buch später sehr erfolgreich.
Um die Gemüter zu beruhigen und für Ablenkung zu sorgen, wanderte Sophie mit den Arps über die Berge ins romantische Valle Maggia. Mühsam ging es hoch über gewundene Wege, über Stufen aus unbehauenen Granitsteinen, vorbei an Gebirgsbächen, die sich eilig ins Tal hinunterstürzten. Nach einer Rast in einem der weinumrankten Tessiner Grotti, wo sie zum ersten Mal die in einem riesigen Kupferkessel über dem offenen Feuer gerührte Polenta aßen, mussten die müden Wanderer wohl oder übel den steilen Abstieg zwischen uralten Kastanienbäumen in Kauf nehmen. Eidechsen huschten durch das braune Laub des Vorjahrs, so dass es überall geheimnisvoll raschelte. Die winzigen Quarzkristalle in den Steinen funkelten wie Gold in der Sonne. Manchmal traten sie auf die stacheligen Hüllen der Kastanien. Sie platzten und gaben ihre glänzenden Früchte frei, die dann später in ihrem Ferienhäuschen, über dem Feuer geröstet, allen köstlich schmeckten. Natürlich stand auch ein Besuch in der Künstlerkolonie auf dem Monte Verità über Ascona auf ihrem Programm, wo sie, wie Sophie notierte, die »absonderlichen Heiligen« beobachteten. Danach kehrten sie wieder in die kühlere Luft des Gotthards und zu dem kranken Lissitzky zurück.
Auch Mart Stam kam mit seiner Frau Leni in die Sommerfrische. »Eines Tages, als die Arps gerade abgereist waren, erschien ein baumlanger junger Mann, auf dessen Schultern ein winziges Frauchen saß. Das war Mart Stam mit seiner Gattin«, amüsierte sich Sophie über das ungleiche, aber glückliche Paar. Lissitzky hatte den jungen progressiven Architekten in Holland kennen gelernt. Die beiden freundeten sich an. Ein komischer Kontrast – Stam war fast doppelt so groß wie Lissitzky. 1926 waren Sophie und El Lissitzky bei dem Ehepaar in Rotterdam zu Gast, 1930 fuhr Mart Stam in die Sowjetunion, um zusammen mit einer Gruppe deutscher Architekten am Aufbau des neuen sozialistischen Staates mitzuarbeiten.
Auch Kurt Schwitters kam eines Tages zu einem kurzen Besuch in die Südschweizer Berge geschneit und widmete später dem kranken Freund eine seiner schnurrigen Geschichten:
»Zu jener Zeit arbeitete im Ambri-Sotto, am Südabhang des heiligen St. Gotthard, ein Mann namens Lissitzky aus Witebsk bei Moskau. Schon als Kind hatte er in seinem Wesen viel Transzendentales gehabt, indem er nur die andere Seite der Welt liebte, die metaphysische oder merfüsische. Dieser Lissitzky arbeitete an der Erfindung des Proun, das heißt, er wollte ein Fahrzeug bauen zur Überwindung des unendlichen Raumes, um neue, vorher nicht geahnte Natur zu entdecken.
Und bei Lissitzky arbeitete ein Elsässer aus jener Gegend, wo sich Deutsche und Franzosen seit Jahrhunderten Gute Nacht sagen, genannt Hans Arp, ein Wissbegehrer und leidenschaftlicher Verehrer von allem Transzendentalen, und daher auch von Lissitzkys Prounen. Dieser Hans Arp konnte nicht nur im Kaffeesatz der Sterne lesen, er las sogar im Sande und las überall und las in den Prounen von Lissitzky, dass ein Bergrutsch von außergewöhnlicher Größe sich am 26. Juli 1926 bei Ambri-Sotto ereignen würde. 24 Stunden vorher hatte Arp an alle Journalisten der Welt telegraphiert und sie von dem Bergrutsch unterrichtet, der in 24 Stunden stattzufinden die hohe Ehre haben würde. Und tatsächlich hatte er die hohe Ehre. Und zwar genau nach 24 Stunden und zwar genau an der von Arp vorher bezeichneten Stelle und war von außergewöhnlicher Größe. Der Eindruck in der Welt war ganz ungeheuer. Man wusste nicht, ob man mehr über die Proune staunen sollte, in denen so etwas zu lesen stand, oder über den begabten Wissbegehrer, der es lesen konnte …«
Die ganze absurde Geschichte, die Sophie und Lissitzky sehr amüsierte, ist in Schwitters’ Buch »Anna Blume« nachzulesen.
Im Herbst 1924 kehrte Sophie mit ihren Jungen nach Hannover zurück, Lissitzky fuhr wieder nach Locarno, um unter der Aufsicht seines Arztes die Kur fortzusetzen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.