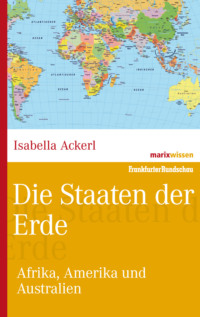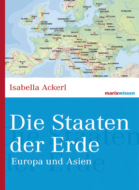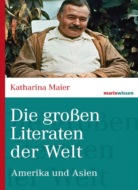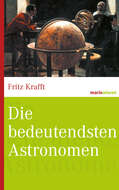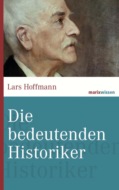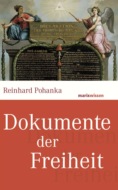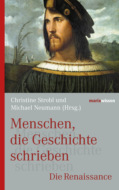Kitabı oku: «Die Staaten der Erde», sayfa 4
BARBADOS (BDS)

Fläche
430 km2
Hauptstadt
Bridgetown (10.000 Einw.)
Währung
1 Barbados-Dollar
Staatsform
Parlamentarische Monarchie
Parlament
Senat mit 21 vom Generalgouverneur ernannten und House of Assembly mit 27 für fünf Jahre gewählten Abgeordneten
Religion
Protestanten 67%, Katholiken 4%, sonstige 29%
Einwohner
270.000
Sprachen
Englisch, Bajan
Gliederung
11 Bezirke
Staatsoberhaupt
König/Königin von England
Nationalfeiertag
30. November
Nationalitäten/Ethnien
Schwarze 80%, Mulatten 16%, Weiße 4%
Internet www.barbados.gov.bb
Geschichte
Der östlichste Karibikstaat wurde ursprünglich von Arawak und Kariben bewohnt, die in drei Einwanderungswellen um etwa 350 n. Chr., um 800 und 1300 die Insel besiedelten. 1536 wurde Barbados von dem in spanischen Diensten stehenden Portugiesen Pedro Campos entdeckt. Als die Briten 1625 die Insel in Besitz nahmen, war sie entvölkert. Sie entwickelte sich aber rasch zu einer Drehscheibe für den mittelamerikanischen Sklavenhandel. Als 1834 im britischen Empire der Sklavenhandel verboten wurde, forcierten die Briten auf Barbados den Anbau von Zuckerrohr. Bemerkenswert ist Barbados, weil es bereits 1639 mit dem House of Burgesses über ein Parlament verfügte. 1652 wurden die Rechte dieses Parlaments in der »Charta of Barbados, or Articles of Agreement« niedergelegt. In dieser Verfassungsurkunde wurden Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit und parlamentarische Rechte garantiert. Zwischen 1958 und 1962 war Barbados Teil der Westindischen Föderation. 1966 wurde Barbados in die Unabhängigkeit entlassen und blieb Mitglied des britischen Commonwealth.
Politisches System
Die aus dem Jahr 1966 stammende nunmehr gültige Verfassung sieht ein Zweikammerparlament vor, ein Abgeordnetenhaus und einen Senat. Ein traditionelles Zweiparteiensystem garantiert dem Land eine hohe politische Stabilität.
Die Hauptstadt Bridgetown, 1626 von den Briten gegründet, präsentiert sich im klassischen englischen Kolonialstil. Es gibt sogar einen Trafalgar-Square mit einem Nelson-Denkmal.
Die Bevölkerung besteht zum größten Teil aus Schwarzen und Mulatten, Weiße und Inder stellen eine Minderheit dar. Fast alle Bewohner sind Christen, wobei die Anglikaner die größte Gruppe bilden. Auf Barbados spricht man Englisch und Bajan, einen Dialekt, der aus der Verschmelzung von Englisch und alten afrikanischen Sprachen entstand. Barbados gehört zu den am dichtest besiedelten Staaten der Welt. Medizinische Versorgung und ein dichtes soziales Netzwerk tragen zur hohen Lebenserwartung der Bevölkerung bei.
Wirtschaft
Barbados´ Wirtschaft ruht auf zwei Standbeinen, einerseits auf dem Tourismus, andererseits auf dem traditionellen Zuckerrohr und seinen Produkten, wie Melasse und Rum. Für den Tourismus geradezu ideal ist das Klima, das ganzjährig Badewetter an natürlichen langen Sandstränden offeriert. Jährlich kommt etwa eine Million Touristen ins Land, mit ihnen wird etwa 50% des BIP erwirtschaftet. Natürlichen Regenwald gibt es auf Barbados keinen mehr, er wurde schon vor Jahrhunderten zur Anlage der Plantagen gerodet.
Mit einem BIP von mehr als 10.000 US-Dollar weist Barbados einen relativ hohen Lebensstandard auf. Niedrige Steuersätze und ein peinlich gewahrtes Bankgeheimnis sollen zusätzlich Finanzdienstleister anlocken.
Landwirtschaftliche Produkte gedeihen in Barbados nur beschränkt, es werden Mangos, Avocados und Zitrusfrüchte geerntet, kleine Bestände von Edelhölzern wie Mahagoni gehen in den Export. Das Vorkommen an Erdöl und Erdgas ist bescheiden und reicht nicht für den Eigenbedarf. Die alte Plantagenwirtschaft, die nunmehr neben Zuckerrohr auch Baumwolle kultiviert, steht einerseits im Eigentum von Großgrundbesitzern, andererseits von Genossenschaften.
Ein Zehntel zum BIP trägt eine kleine Leichtindustrie bei, die Pharmazeutika, Glas, Keramik, Textilien und elektronische Bauteile herstellt.
BELIZE (BH)

Fläche
22.696 km2
Hauptstadt
Belmopan (8.100 Einw.)
Währung
1 Belize-Dollar = 100 Cents
Staatsform
Parlamentarische Monarchie
Parlament
Senat mit 9 ernannten und Repräsentantenhaus mit 29 für 5 Jahre gewählten Abgeordneten
Religion
Katholiken 62%, Protestanten 30%, sonstige 8%
Einwohner
270.000
Sprachen
Englisch, Kreolisch, Spanisch
Gliederung
6 Distrikte
Staatsoberhaupt
König/Königin von England
Nationalfeiertag
10. und 21. September
Nationalitäten/Ethnien
Mestizen 44%, Kreolen 31%, Maya 9%, Garifuna 6%, sonstige 10%
Internet www.belize.gov.bz
Geschichte
Das ehemalige Britisch-Honduras, an der Ostküste Yucatans gelegen, war zwischen 300 und 900 n. Chr. eine Hochburg der Maya-Kultur. 1938 fand man im tropischen Urwald die Stadt Caracol. Im 16. Jh. kamen die Spanier, die sich nur für Tropenhölzer interessierten, in die Region. Die Mayas zogen sich ins Landesinnere zurück, bisweilen leisteten sie den vordringenden Spaniern ausdauernden Widerstand. An den Küsten fanden britische Piraten Schlupflöcher, die Jagd auf spanische Schiffe machten. 1670 unterzeichneten Spanien und England einen Vertrag, der diese üble Praxis unterbinden sollte. Die Baymen, so der Name der Piraten, verlegten sich daher auf den Holzhandel, für den sie Mitte des 18. Jh. sogar eine vertragliche Konzession erhielten. Immer mehr britische Siedler kamen ins Land, sie alle lebten vom Holz. Ende des 18. Jh. soll der Anteil der Sklaven an der Bevölkerung etwa 75% ausgemacht haben. 1862 wurde Britisch-Honduras Kronkolonie. Im 20. Jh. begann es in Britisch-Honduras unter der einheimischen Bevölkerung zu gären, vor allem nachdem Mayas im Ersten Weltkrieg in der britischen Armee gedient, aber nicht als vollwertig akzeptiert worden waren. Als nach dem Zweiten Weltkrieg Indien unabhängig wurde, verstärkten sich die Bestrebungen, dies ebenfalls zu werden. Noch unter britischer Herrschaft wurde die Verwaltung selbstständig wahrgenommen, politische Parteien entstanden. 1973 wurde der Staatsname in Belize geändert. 1981 wurde das Ziel schließlich erreicht. Nur zu Guatemala blieb das Verhältnis gespannt, da dieses Ansprüche auf Belize erhob. Die Anwesenheit britischer Truppen im Land verhinderte einen Krieg. 1992 unterzeichnete Guatemala einen Vertrag, der die Unabhängigkeit Belizes anerkannte. Danach verließen 1994 die britischen Truppen das Land.
Politisches System
Schon 1765 besaßen die Siedler in Britisch-Honduras eine Art Grundgesetz, das sich »Barnaby´s Code« nannte. 1981 wurde die heute gültige Verfassung beschlossen, Staatsoberhaupt ist die britische Königin, die sich durch einen Generalgouverneur vertreten wird. Die heutige Hauptstadt Belmopan ist eine Neugründung der 1960er Jahre. Da 1961 ein Hurrikan die alte Hauptstadt Belize schwer verwüstet hatte, wurde ein Regierungssitz weiter im Landesinneren geplant, der vor Hurrikans sicher wäre.
Wirtschaft
Belizes Wirtschaft wächst zwar in den letzten Jahren recht ordentlich, doch die Staatsverschuldung macht 85% des BIP aus und schränkt jegliche wirtschaftliche Initiative ein. Ein Drittel der Bevölkerung lebt unter der Armutsgrenze. Exportschlager sind Edelhölzer, wie Mahagoni, aber auch Nutzholz.
Die Landwirtschaft produziert in kleinen Einheiten für den Eigenbedarf; auf größeren Plantagen, die oft in ausländischem Besitz stehen, werden Zuckerrohr, Zitrusfrüchte, Bananen, Kakao und Kokosnüsse gepflanzt.
Von Bedeutung ist die Fischerei, deren Produkte größtenteils in den Export gehen. Die industrielle Produktion liefert nur Textilien sowie Holzprodukte und verarbeitet Nahrungsmittel für den Export. Der Tourismus ist ein aufstrebender Wirtschaftszweig, Taucher sind vom Riff begeistert, Kulturinteressierte besuchen die Maya-Ruinen und Ökotouristen erforschen den Regenwald. 41% der Staatsfläche sind Nationalparks und Naturschutzgebiete. Nennenswerte Bodenschätze hat Belize nicht aufzuweisen, in den 1980er Jahren wurde im Norden Erdöl entdeckt.
BENIN (BJ)

Fläche
112.622 km2
Hauptstadt
Porto Novo (220.000 Einw.)
Währung
CFA-Franc
Staatsform
Präsidiale Republik
Parlament
Nationalversammlung mit 83 für vier Jahre gewählten Abgeordneten
Religion
Naturreligionen 70%, Muslime 15%, Christen 15%
Einwohner
8,4 Mio.
Sprachen
Französisch, ca. 60 Stammessprachen
Gliederung
12 Départements
Staatsoberhaupt
Präsident
Nationalfeiertag
1. August
Nationalitäten/Ethnien
Fon 39,8%, Yoruba 12,2%, Adja 11,1%, Bariba 8,7%, Alzo Pédah 8,7%, sonstige 19,5%
Internet www.gouv.bj
Geschichte
Benin, das bis 1975 Dahomey oder Dahomé hieß, war im 17. Jh. das Sklavenhandelszentrum Westafrikas. 1892 erfolgte die Eroberung durch Frankreich, 1894 war das Land mit seiner Hauptstadt Cotonou Teil von Französisch-Westafrika. 1957 erhielt das Land beschränkte innere Autonomie, 1958 war es innerhalb der Französischen Gemeinschaft Mitglied mit völliger innerer Autonomie. Nach heftigen Unruhen erklärte Dahomey 1960 seine Unabhängigkeit und trat aus der Französischen Gemeinschaft aus. Die nächsten Jahre waren eine Aufeinanderfolge von Militärputschen und Staatsstreichen, 1964 gab sich das Land nach einer Volksabstimmung eine Verfassung mit einem Einkammerparlament. Hatte Dahomey in der Anfangsphase seiner Unabhängigkeit noch auf gute Kontakte zu Frankreich und den frankophonen Nachbarn gesetzt, erfolgte 1964 eine Annäherung an kommunistische Staaten, auch an China. 1965 wurde die Verfassung sistiert, das Parlament aufgelöst und alle Parteien verboten. Aber auch die Freundschaft mit China hatte keinen langen Bestand, 1966 wurden die Beziehungen wieder abgebrochen. 1974 erklärte sich Dahomey als kommunistischer Staat. Verstaatlichung war angesagt. 1975 erfolgte die Änderung des Staatsnamens in Benin, in Erinnerung an das einst sehr mächtige Reich Benin. Da für die kommunistische Staatsführung die wirtschaftlichen Erfolge ausblieben (die Staatsschulden erreichten eine Milliarde US-Dollar), kam es 1989/1990 zu Unruhen in der Bevölkerung, die schließlich eine Trendumkehr erzwangen. Eine Nationalkonferenz (Conférence Nationale de Forces Vives de la République) unter der Leitung des katholischen Erzbischofs von Cotonou stellte die Weichen für einen demokratischen Neuanfang, man holte den ehemaligen Exekutivdirektor der Weltbank Nicéphore Soglo und machte ihn zum Premier. Der Übergang erfolgte unblutig: Demokratie, Menschenrechte, Zulassung von politischen Parteien, Meinungsfreiheit und freie Marktwirtschaft wurden die neuen Grundwerte des Staates.
Politisches System
Heute ist Benin eine funktionierende Demokratie, die sich 1990 eine neue Verfassung – ein Mittelding zwischen französischer und amerikanischer Verfassung – gegeben hatte. Es gibt ein Einkammerparlament, das alle vier Jahre gewählt wird. Die Wahl des Staatspräsidenten, der zugleich Regierungschef ist, erfolgt alle fünf Jahre. Es gibt ein Mehrparteiensystem, tatsächlich wird die Politik jedoch von territorialen und ethnischen Bindungen dominiert. Das Verhältnis zu Frankreich ist sehr gut und orientiert sich an dessen Außenpolitik, inzwischen zeigen Großmächte wie die USA und China Interesse an dem kleinen Land.
Die Bevölkerung umfasst mehr als 40 ethnische Gruppen, dominierend sind die Fon und die Ewa. Offiziell geben nicht einmal 20% der Bevölkerung an, einer Naturreligion anzugehören, tatsächlich dürften 70% der Voodoo-Religion anhängen, die rituelle Tänze, Ahnenkult, Tieropfer und Geisterglauben vertritt. Mehr als 20% der Bevölkerung sind katholisch.
Wirtschaft
Bis 1990 herrschte in Benin Planwirtschaft, seitdem wird auf Marktwirtschaft umgestellt. Dank seiner intensiven Bemühungen in der Armutsbekämpfung kam Benin 2003 in den Genuss einer Entschuldungsinitiative der Weltbank.
Drei Viertel des Exporterlöses werden mit Baumwolle erzielt, außerdem gehen noch Ananas und andere exotische Früchte in den Export. Der Rest der landwirtschaftlichen Produktpalette sorgt für den Eigenbedarf, Hauptanbauprodukte sind Mais, Hirse, Jams und Maniok. Noch sind 60% der Bevölkerung in der Landwirtschaft tätig.
BOLIVIEN (BOL)

Fläche
1,1 Mio. km2
Hauptstadt
Sucre (220.000 Einw.)
Währung
1 Boliviano = 100 Centavo
Staatsform
Präsidiale Republik
Parlament
Abgeordnetenhaus mit 130 und Senat mit 27 für vier Jahre gewählten Mitgliedern
Religion
Katholiken 95%, Protestanten und sonstige 5%
Einwohner
9,2 Mio.
Sprachen
Spanisch, Aymará, Ketschua
Gliederung
9 Departementos
Staatsoberhaupt
Präsident
Nationalfeiertag
6. August
Nationalitäten/Ethnien
Mestizen 30%, Ketschua 30%, Aymará 25%, weiße 15%
Internet www.comunica.gov.bo
Geschichte
Die wichtigste vorkolumbianische einheimische Kultur war die von Tiahuanaco, die bis an die Küste des Pazifik reichte. Zwischen 1438 und 1471 wurde dieses Staatswesen vom Inkareich erobert. 1538 eroberten die Spanier das Land und machten Bolivien zu einem Teil des Vizekönigtums Peru, später des Vizekönigreiches Rio de la Plata. Spanien war an Bolivien wegen seiner reichen Silbervorkommen interessiert. Unter dem Eindruck der Französischen Revolution in Europa und den damit einhergehenden nationalen Bestrebungen erwachte auch in Bolivien der Wunsch, von Spanien unabhängig zu sein. Der Kampf um dieses nationale Gut begann 1809, als das Mutterland Spanien von napoleonischen Truppen besetzt war. 1825 gelang es dem Freiheitskämpfer Simón Bolívar, den Spaniern eine entscheidende Niederlage zuzufügen. Bolivien und Peru wurden unabhängig, sehr bald trennten sich auch die Wege der beiden Länder. Bolivien nahm den Namen seines Befreiers an. Die folgenden Jahrzehnte waren von Bürgerkrieg und Anarchie gekennzeichnet. In den späten dreißiger Jahren des 19. Jh. war Bolivien in den Konföderationskrieg gegen Chile verwickelt, im Salpeterkrieg (1879–1883) verlor Bolivien endgültig Territorien an Chile und damit den Zugang zum Meer. Noch einmal führte Bolivien nach dem Ersten Weltkrieg eine Auseinandersetzung mit Paraguay um einen Zugang zum Meer, im Chaco-Krieg (1932–1935) verlor es im Süden große Teile an Paraguay. Die Geschichte des 20. Jh. war außerdem von zahlreichen Umstürzen, Revolutionen und Putschen gekennzeichnet. In den 1980er Jahren kam es zum Sturz einer Militärjunta und danach zur Etablierung eines demokratischen Regimes. 2003 mobilisierten die Gewerkschaften das Volk gegen den Ausverkauf des Devisen bringenden Erdgases an US-amerikanische Konzerne. Der Protest richtete sich auch gegen extreme Einsparungen im Staatshaushalt, die vom Internationalen Währungsfonds zur Reduzierung der Staatsschulden gefordert worden waren. Der damalige Präsident Gonzalo Sánchez de Lozada musste zurücktreten und ging in die USA ins Exil. 2005 war die Stimmung wieder am Überkochen, diesmal hatten die hohen Benzinpreise massive Proteste ausgelöst und die Forderung nach Verstaatlichung der Gasindustrie wurde laut. Wieder trat ein Präsident zurück, doch weitere Proteste verhinderten, dass der verfassungsmäßig vorgesehene Präsident des Senats, ein ausgewiesener Konservativer, das Amt übernahm. Schließlich einigte man sich auf einen Übergangspräsidenten zur Durchführung von Wahlen. Im Dezember 2005 wurde mit dem Anführer der Kokabauern Evo Morales erstmals ein Vertreter der indigenen Bevölkerung mit 45% der Stimmen in das Präsidentenamt gewählt. Im Januar 2006 wurde Morales vereidigt, bereits im Mai verstaatlichte er die Erdgasindustrie, was international zu Protesten führte. Angeblich trat er sogar in den Hungerstreik, um die Verstaatlichung im Parlament durchzusetzen. Inzwischen wurden neue Verträge mit den ausländischen Konzernen geschlossen, diese führen 80% der Erträge aus dem Erdgasverkauf an die Regierung ab. Im Februar 2007 folgte die Verstaatlichung des Schweizer Schmelzhüttenkonzerns Glencore; diese Causa wurde bei unabhängigen Gerichten eingeklagt.
Politisches System
Seit 1967 ist Bolivien eine präsidiale Republik, der Präsident wird für vier Jahre gewählt, eine unmittelbare Wiederwahl ist derzeit verfassungsmäßig nicht zulässig. Ursprünglich kündigte Morales an, nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Inzwischen dürfte er seine Meinung geändert haben, verfügt aber nicht über die zur Durchsetzung seines Vorhabens nötige Zweidrittelmehrheit im Parlament. Das Parlament besteht aus zwei Kammern, dem Abgeordnetenhaus mit 130 gewählten Mitgliedern und dem Senat mit 27 Senatoren. Seit Juli 2006 berät eine konstituierende Versammlung über die Kodifizierung einer neuen Verfassung. Wichtige politische Kräfte im Land sind die Armee und die Bergarbeitergewerkschaft.
Seit 1969 gehört Bolivien zur Andengemeinschaft, die seit 1995 eine Freihandelszone unter den Mitgliedern aufgebaut hat. Mit Chile schwelt noch immer der Konflikt um einen Zugang zum Meer.
Die Errichtung der Hauptstadt Sucre geht auf einen Befehl Francisco Pizzaros zurück, der eine Stadt mit dem Namen Villa de la Plata (= Silberstadt) wollte. Um 1770 hatte die Stadt – sie liegt 2800 Meter über dem Meer – etwa 45.000 Einwohner. Die Namensänderung in Sucre erfolgte in Erinnerung an General Antonio de Sucre, einen der Mitstreiter Simón Bolívars, und um den Ort, wo die Unabhängigkeit des Staates ausgerufen wurde, zu ehren. Heute ist Sucre eine der schönsten Kolonialstädte Lateinamerikas und beherbergt die älteste Universität Südamerikas. Sie gehört seit 1990 zum Weltkulturerbe. Nominelle Hauptstadt war sie seit 1839. Doch die Regierung und das Parlament sind 1898 nach La Paz abgewandert. Im Juli 2007 demonstrierten zwei Mio. Menschen gegen die Verlegung des Regierungssitzes in die historische Hauptstadt Sucre. Sie wenden sich gegen eine weitere Aufwertung des ohnedies schon reichen Südwesten des Landes, wo sich eben deshalb Abspaltungstendenzen bemerkbar machen.
55% der bolivianischen Bevölkerung sind Indianer, damit ist Bolivien das Land mit dem höchsten Anteil an indigener Bevölkerung. Sie teilt sich in zwei Hauptgruppen, die Ketschua und die Aymará. Eine indigene Minderheit stellen die Guaraní dar. In den letzten Jahren konnten die mittelgroßen indigenen Bevölkerungsgruppen einen Zuwachs verzeichnen, damit einher geht ein wachsendes Bewusstsein für die eignen Wurzeln und die kulturelle Identität. Der Rest der Bevölkerung sind Schwarze, Weiße und Mestizen. Ein großer Teil der Weißen sind Nachkommen der Spanier, sie bilden im Land die soziale Oberschicht. Etwa die Hälfte der Bevölkerung spricht Spanisch, die Indios sprechen Ketschua oder Aymará. Beide Indiosprachen sind als Amtssprachen anerkannt. Bolivien ist ein dünn besiedeltes Land, 65% der Bevölkerung leben in Städten. 90% der Bevölkerung geben an, katholisch zu sein, ein kleiner Teil bekennt sich zu indianischen Religionen. Die katholische Religion ist Staatsreligion, aber Religionsfreiheit ist verfassungsmäßig garantiert. Außerdem gibt es noch eine kleine Minderheit von etwa 12.000 Mennoniten, die in den 1970er Jahren aus Mexiko und den USA einwanderten. Eine kleine jüdische Gemeinde und eine kleine Gruppe der Bahai runden das religiöse Spektrum ab.
Wirtschaft
Obwohl Bolivien über reiche Bodenschätze verfügt, ist es noch immer ein Entwicklungsland, in dem das Bruttonationaleinkommen unter 900 US-Dollar liegt und in dem die Arbeitslosigkeit hoch ist. Gründe dafür sind in den schlechten Verkehrsverhältnissen und in der nicht ausreichenden Energieversorgung zu suchen. Die einseitige Abhängigkeit vom Bergbau macht Bolivien für die Preisentwicklung am Weltmarkt für diese Bodenschätze besonders anfällig. Zudem sind in manchen Bereichen die Minen entweder erschöpft oder die Förderung ist durch Preisverfall rückläufig. An Bodenschätzen verfügt Bolivien über Zinn, Zink, Blei, Kupfer, Wolfram, Antimon und Wismut. Silber wurde schon in vorkolumbianischer Zeit abgebaut, die Spanier entdeckten es Mitte des 16. Jh. in der Gegend von Potosi und sorgten für einen systematischen Abbau. Inzwischen ist der Silberbergbau ausgebeutet und zum Erliegen gekommen, an seine Statt trat der viel wichtigere Abbau von Zinn, wobei Silber nur ein Nebenprodukt des Abbaus ist.
Wesentlicher für den wirtschaftlichen Erfolg des Landes wurde die Entdeckung von Erdöl und Erdgas in der Umgebung von Santa Cruz de la Sierra im Südosten des Landes. Der Export von Erdgas macht 10% des Exportvolumens aus. Zur besseren Ausbeutung der reichen Ölvorkommen schloss Bolivien eine Allianz mit Venezuela und seinem Staatspräsidenten Hugo Chávez; Venezuela stellt dem Neuankömmling auf dem Ölmarkt Know-how zur Verfügung.
50% der Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft beschäftigt, diese kann kaum den Eigenbedarf decken. Angebaut werden Kartoffeln, Getreide, Bohnen, Soja, Zuckerrohr und Reis. Kaffee und Mais sind Exportprodukte. Im Tiefland wird Schaf- und Rinderzucht betrieben. Ein wesentlicher Faktor der Landwirtschaft ist der Kokaanbau auf etwa 25.000 ha. An die 100.000 Bauernfamilien leben vom Kokaanbau, Bolivien ist weltweit der drittgrößte Produzent für Koka. Der größte Teil davon wird für die Herstellung von Kokain verwendet. Eine effektive Bekämpfung des Kokaanbaus wäre für diese Bauern eine wirtschaftliche Katastrophe. Daher tritt Präsident Morales, selbst Vertreter dieser Kokabauern, für die Fortsetzung des Anbaus ein.
30% des BIP macht die Industrie aus, die vor allem Verbrauchsgüter herstellt. Sie diversifiziert sich in Metallindustrie, Erdölraffinerien und chemische Industrie.