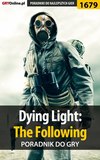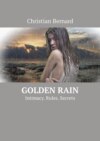Kitabı oku: «Die Schlucht», sayfa 18
Viertes Kapitel
Raiski ging um die ganze Stadt herum und kletterte am entgegengesetzten Ende der Schlucht, ganz weit entfernt von seinem Gute, wieder den Abhang hinauf. Von der Höhe aus schritt er dann wieder abwärts, nach der Vorstadt zu. Die ganze Stadt lag wie auf der flachen Hand vor ihm ausgebreitet.
Ein seltsames Gefühl ergriff ihn, als er so, von alten, fast bis in die Kindheit zurückreichenden Erinnerungen bestürmt, auf diesen kunterbunten Haufen von Häusern, Häuschen und Hütten niederschaute, die bald in dichten Gruppen zusammengedrängt waren, bald auf den Höhen oder in den Niederungen zerstreut lagen, hier am Rande des Abhangs hinliefen, dort sich nach der Tiefe der Schlucht hinzogen, die einen mit Balkons, Markisen, Belvederen, die anderen mit Anbauten und Überbauten, mit venetianischen Fensterchen oder kaum bemerkbaren Spalten an Stelle der Fenster, mit Taubenschlägen, Starhäuschen und öden, grasbewachsenen Höfen. Er sah hinab auf die endlos langen, zwischen Zäunen hinlaufenden krummen Gassen, auf die menschenleeren, noch unausgebauten Straßen, die mit hochtönenden Aufschriften, wie »Moskauer Straße«, »Astrachaner Straße«, »Saratower Straße« paradierten und über Basare hinliefen, auf denen Haufen von Bast, von gesalzenen und gedörrten Fischen, Fässer mit Birkenteer und Tische mit großen Kuchen umherstanden; er sah auf die weitgeöffneten Torwege der Einkehrhäuser, aus denen ein penetranter Düngergeruch hervorströmte, und auf die durch die Straßen holpernden Droschken.
Die Mittagstunde war längst vorüber. Über der Stadt lag eine starre Ruhe, ähnlich der Windstille auf dem Ozean – die Stille des trägen, breiten, vegetierenden Lebens dieser russischen Steppennester, die einem Friedhof weit mehr gleichen als einer von lebendigen Menschen bewohnten Stadt.
Sie schien gestorben zu sein, oder zu schlafen, oder in dumpfen Träumen befangen. Die offenen Fenster erinnerten an ein starres Gähnen, an einen Mund, der geöffnet ist, aber nicht spricht; kein Atem, kein Pulsschlag war zu spüren. Wohin ist das Leben geflohen? Wo sind die Augen, wo der Mund dieses regungslos daliegenden Körpers? Alles ringsum ist grün, mit bunten Sprenkeln dazwischen, und alles schweigt.
Raiski schritt durch die Straßen und Gäßchen dahin – nicht ein Windhauch regte sich darin. Der Staub liegt auf den Straßen, schon seit vielen Tagen unberührt; man sieht deutlich die Radspuren der Wagen, die darüber hingefahren sind. Im Schatten des Zaunes ruht da und dort eine Ziege aus, und die Hühner haben sich Höhlen in den Staub gescharrt und sitzen darin ganz still beieinander; nur der Hahn sucht, bald mit dem einen, bald mit dem anderen Fuße kratzend, in der hohen, dicken Staubschicht nach Nahrung. In den Höfen liegen die Hunde in buntscheckigen Gruppen zu drei und vier nebeneinander, und nur aus Gewohnheit bellen sie von Zeit zu Zeit den einen oder andern der wenigen Passanten an, der sie im übrigen gar nichts angeht.
Alles erscheint so weit, so öde – wie in der Wüste. Hier und da zeigt sich ein Kopf mit grauem Barte an einem der Fenster, ein rotes Hemd wird sichtbar, träg schauen die Augen nach links und rechts, ein Gähnen folgt, ein Ausspucken, und der Kopf verschwindet wieder.
Wirft man einen Blick durchs Fenster gegenüber, auf der anderen Seite der Straße, so erblickt man einen schnarchenden Mann im Schlafrock, auf dem Ledersofa ausgestreckt, und neben ihm auf einem Tischchen den »Stadtanzeiger«, die Brille und eine Karaffe mit Kwas.
Dort hockt einer stundenlang im Torweg, die Mütze auf dem Kopfe, und schaut träg und gleichgültig nach dem mit Brennesseln bewachsenen Graben und dem Zaun auf der anderen Straßenseite. Eine ganze Weile schon hält er das Taschentuch in den Händen und kann vor lauter Trägheit sich nicht dazu entschließen, seine Nase zu putzen.
Hier sitzt jemand untätig am Fenster, mit der Pfeife im Munde, und wer auch immer vorübergeht, jeder sieht ihn da sitzen, mit zufriedenem, wunschlosem Gesichte, ohne Spur von Langerweile. An einem anderen Fenster sah Raiski eine ältliche Frau, das Pendant zu dem Manne mit der Pfeife: jahraus, jahrein saß sie da seit langer Zeit in ihrem verlorenen Gäßchen, ohne sich zu rühren, ohne sich aufzuregen, ohne irgendeinen Verkehr mit ihresgleichen zu suchen, ohne etwas zu ahnen von der Unruhe und dem regen Treiben der Großstadt, die die Menschen nur so durcheinanderwirbelt.
Da und dort sah Raiski, wie er so von Gasse zu Gasse ging, die Leute noch bei Tische, doch stand stellenweise auch schon der Samowar bereit.
In der menschenleeren Gasse hört man es auf eine Werst hin ganz deutlich, wenn zwei oder drei zusammen sprechen, und was sie sprechen. Hell tönen die Stimmen durch die Gasse, und die Schritte hallen auf dem hölzernen Bürgersteig wider.
Irgendwo in einem Schuppen wird Holz zerkleinert, ein Ferkel quiekt auf dem Misthaufen; an einem kleinen Fensterchen, fast zu ebener Erde, weht ein Kattunvorhang im Zugwind hin und her und streift die Balsaminen, Maßliebchen und Reseden in den Töpfen auf dem Fensterbrett.
Hier sitzt, das hübsche, frische Gesicht über eine Näharbeit gebeugt, ein junges Mädchen und ist trotz der einschläfernden Schwüle fleißig am Werke. Sie ist die einzige, die im Hause zu wachen scheint – vielleicht wartet sie, bis draußen auf der Straße ein bekannter Schritt sich vernehmen läßt . . .
Aus den offenen Fenstern eines Hauses tönt wohl ein ganzes Hundert jugendlich heller, buchstabierender Stimmen: es bedurfte nicht erst der Aufschrift über der Tür des Hauses, um dem Wanderer anzuzeigen, daß er eine Schule vor sich habe.
Weiter kam Raiski an einen Neubau: Balken, Sparren und Späne lagen in Haufen umher, und um eine riesige hölzerne Schüssel waren die Zimmerleute gelagert. Ein großer Brotlaib, kleingeschnittener Lauch in der mit Kwas gefüllten Schüssel und ein Stück Salzfisch – das war ihr ganzes Mittagessen.
Ruhig und schweigsam saßen die Männer um die Schüssel, tauchten der Reihe nach ihre Löffel in den Kwas und legten sie wieder hin, kauten langsam das Brot, lachten und sprachen nicht, sondern verrichteten ernsthaft, fast mit Andacht, die schwere Arbeit des Essens.
Raiski wollte sie zeichnen, diese Gruppe von müden, ernsten, gelbbraunen Männern, die an Polynesier erinnerten, diese vertrockneten, sonnverbrannten Hände mit den steifen Fingern und den fest eingewachsenen, gleichsam eisernen Nägeln, diese Gesichter mit den sich im Gleichmaß weit öffnenden, langsam kauenden Kiefern, diesen Hunger, der sich an Brot und Lauch und Grütze satt aß.
Ja, das war der Hunger, nicht der Appetit: der Bauer kennt keinen Appetit. Der Appetit ist ein Ergebnis des Faulenzens, des Wohllebens, der »Motion«, der Hunger dagegen ein Produkt der Zeit und der schweren Arbeit.
»Welch ein breites Bild der Stille und des Schlafes!« dachte Raiski, während er seinen Blick in die Runde schweifen ließ. »Wie ein Grab! Ein weiter Rahmen für einen Roman – fragt sich nur, was ich in diesen Rahmen hineinstellen soll!«
Er zeichnete gleichsam in Gedanken all die Häuschen ab, prägte sich die Physiognomien der Passanten ein, gruppierte bereits die Tante und ihre Umgebung in dem ihm vorschwebenden Rahmen.
Als Hauptgestalt des Ganzen erschien ihm vorerst nur Marsinka – sie bildete den Mittelpunkt des Gemäldes. Die Gestalt der Bjelowodowa war in den Hintergrund getreten und stand dort ganz einsam und verlassen.
Mechanisch und langsam ging er durch die Straßen und verarbeitete sein neues Material. Alle Gestalten standen im Kopfe fertig vor ihm, er sah sie dort alle so, wie sie lebten.
»Wie, wenn auf diesem schläfrigen, unbeweglichen Hintergrunde sich ein großes Gemälde der Leidenschaft abspielte?« dachte er. Welches Leben würde sich plötzlich in diesem Rahmen entwickeln! Welche Farbenfülle! . . . Aber woher die Farben nehmen, und woher die Leidenschaft? . . .
»Die Leidenschaft!« wiederholte er still für sich, fast in heftiger Wallung. »Ach, wenn doch ihre sengende Glut mich selbst ergreifen und durchlodern wollte, wenn sie den Künstler in mir ganz aufzehrte, daß ich blind in ihr versänke und dieses innere Doppelleben, dieses quälende zweite Gesicht aus meinem Wesen herausmerzte! Nicht mit den schauenden Sinnen, als Beobachter anderer, will ich ihre Glut durchleben, sondern mit dem eigenen Ich, mit Nerven und Mark, mit Galle und Blut – und dann will ich es malen, dieses Gehenna des menschlichen Lebens! Die Leidenschaft Sophies . . . nein, nein!« dachte er kalt. »Sie steht über dieser Welt, über der Leidenschaft . . . und die Leidenschaft Marsinkas . . .« – er mußte unwillkürlich lächeln.
Beide Bilder verblaßten, und er senkte nachdenklich den Kopf und blickte gleichgültig zur Seite.
»Ja, sie werden beide ihren Roman haben,« dachte er; »einen Roman, gewiß – aber es wird ein welker, kleinlicher Roman sein, bei der einen mit allerhand aristokratischem, bei der anderen mit kleinbürgerlichem Beiwerk. Dort das breite Gemälde eines kühlen Halbschlummers in marmornen Sarkophagen, mit Samtdecken, auf denen goldene Wappen gestickt sind; hier das Bild eines lauen Sommerschlafs auf grünen Matten, inmitten von Blumen, unter freiem Himmel – ganz traut und gemütlich, aber doch immer ein Schlaf, und zwar ein Schlaf, aus dem es kein Erwachen gibt.«
Er ging jetzt rascher – er hatte sich erinnert, daß seine Wanderung ein Ziel hatte, und er sah sich um, ob er nicht jemanden sähe, den er nach der Wohnung des Gymnasiallehrers Leontij Koslow fragen könnte. Kein Mensch war auf der Straße, kein Lebenszeichen rings zu schauen. Endlich entschloß er sich, in eins der kleinen Holzhäuser einzutreten.
Auf dem Hausflur schlug ihm ein abscheulicher Dunst entgegen, daß er sich die Nase zuhalten mußte und sein Blick hastig über die drei vom Flur nach dem Innern des Hauses gehenden Türen glitt: welche sollte er öffnen? Hinter der einen Tür ließ sich ein Geräusch vernehmen, und er betrat das kleine Vorzimmer.
»Wer ist da?« fragte ganz verdutzt eine alte Frau, die ihm, mit beiden Händen einen schweren Samowar tragend, entgegentrat.
»Können Sie mir nicht sagen, wo hier der Lehrer Leontij Koslow wohnt?« fragte Raiski.
Sie sah ihn noch immer wortlos, mit weit aufgerissenen, erschrockenen Augen an.
»Wer ist da?« ließ sich aus dem anstoßenden Zimmer eine männliche Stimme vernehmen, während gleichzeitig ein Schlurren von Pantoffeln näher kam und der Kopf eines etwa fünfzigjährigen Mannes in der Tür erschien. Er trug einen buntscheckigen Schlafrock und hielt ein blaues Tuch in der Hand.
»Nach irgendeinem Lehrer fragt er!« sagte die erschrockene Alte.
Der Mann im Schlafrock sah Raiski gleichfalls ganz bestürzt an.
»Was für ein Lehrer? Hier wohnt kein Lehrer . . .« sagte er und fuhr fort, den unerwarteten Besucher mit erstauntem Blick zu betrachten.
»Entschuldigen Sie, ich bin hier nicht bekannt, bin erst heute früh hier angekommen. Zufällig bin ich hier in diese Straße geraten und wollte nur fragen . . .«
»Wollen Sie nicht näher treten?« lud ihn der Hausherr freundlich ein.
Raiski folgte ihm in ein kleines Empfangszimmer, in dem einfache Lederstühle und ein ebensolches Kanapee an der Wand standen. Auch ein Spiegel war vorhanden, und unter dem Spiegel stand ein Spieltisch.
»Ich bitte, Platz zu nehmen!« bat der Hausherr. »Nach welchem Lehrer beliebten Sie zu fragen?« fuhr er fort, als sie sich beide gesetzt hatten.
»Nach Leontij Koslow.«
»Es gibt hier einen Kaufmann Koslow, der hat einen Laden auf dem Basar . . .«, sagte der Hausherr nachdenklich.
»Nein, der Koslow, den ich meine, ist Lehrer der klassischen Sprachen,« wiederholte Raiski.
»Der klassischen Sprachen . . . nein, den kenne ich nicht . . . Erkundigen Sie sich einmal im Gymnasium – dort oben, auf der Anhöhe . . .«
»So klug bin ich selber,« dachte Raiski. Und laut fügte er hinzu: »Ich glaubte, daß ihn hier jedermann kennt, weil er schon so lange in der Stadt ist.«
»Erlauben Sie mal . . . ist er nicht Hauslehrer beim Adelsmarschall? Dann wohnt er dort auch – er sieht so brav aus . . .«
»Nein, nein, der ist gar nicht brav!« sagte Raiski lächelnd und empfahl sich.
Auf der Straße hielt er den ersten Passanten an und fragte ihn wiederum nach dem Lehrer Leontij Koslow. Der Gefragte dachte ein Weilchen nach, musterte Raiski vom Scheitel bis zur Sohle, wandte sich dann zur Seite, um sich mit den Fingern zu schneuzen, und sagte, nach der Richtung zeigend, aus der Raiski kam:
»Der muß dort am Ende der Stadt wohnen, hinter der Brücke: dort wohnt irgendein Lehrer.«
Zum Glück kam jetzt ein Kantonschreiber vorüber, der Raiskis Frage vernahm.
»Was redest du da!« bemerkte er. »Das ist doch der Gärtner Koslow!«
»Ich weiß, daß er Gärtner ist, aber er ist doch zugleich Lehrer,« versetzte der andere. »Man schickt doch Kinder zu ihm in die Lehre . . .«
»Der ist es aber nicht, den der Herr sucht,« sagte der Schreiber mit einem Blick auf Raiski. »Bitte, folgen Sie mir!« fügte er hinzu und ging rasch voran.
Raiski folgte ihm von Gasse zu Gasse, und sein Führer brachte ihn endlich vor das Haus, aus dessen Fenstern das Buchstabieren der Abcschützen klang.
»Hier ist die Schule, und da sitzt auch der Lehrer selbst!« sagte er und zeigte nach dem Fenster des Hauses, durch das man den Lehrer sehen konnte.
»Aber der ist’s doch nicht, den ich suche!« rief Raiski ärgerlich. Er war wütend über sich selbst, weil er vergessen hatte, sich zu Hause nach Koslows Adresse zu erkundigen.
»Ja, dann hätten wir noch das Gymnasium oben auf der Anhöhe . . .« sagte der Schreiber.
»Schon gut, ich danke Ihnen, ich werde ihn schon finden,« sagte Raiski und trat in das Schulhaus ein, in der Annahme, daß der Lehrer doch sicher wissen würde, wo Leontij wohnte.
Seine Annahme erwies sich als richtig: der Lehrer legte den Finger auf die Stelle im Buche, die er gerade vorhatte, und ging, das Buch in der Hand, mit Raiski auf die Straße hinaus. Hier zeigte er ihm, wie er zunächst die Straße hinuntergehen, dann rechts und dann wieder links einbiegen müsse.
»Dort kommen Sie an einen Garten,« fügte er hinzu – »und da wohnt Koslow.«
»Hier sind Kultur und Fortschritt noch etwas weit zurück,« dachte Raiski, während er auf die hinter ihm herschallenden Kinderstimmen lauschte und zum fünften Male durch dieselben Gassen schritt, ohne auch diesmal einer lebendigen Seele zu begegnen. »Was für Menschen, was für Sitten, was für Erscheinungen! Alles, alles zu brauchen für einen Roman: das gibt Striche und Schatten, interessante Details, Milieu – lauter Perlen für den, der sie sehen und darstellen kann. Wie mag nur Leontij jetzt aussehen? Ob er sich sehr verändert hat? Ob er noch immer der alte Büchergelehrte mit dem ahnungslosen Kinderherzen ist? Auch er ist – ein dankbarer Fund für den Künstler.«
Und er trat in das Haus ein.
Fünftes Kapitel
Leontij gehörte zur Sorte jener ewig in den Büchern vergrabenen, nichts außer ihnen kennenden Gelehrten, die in der Welt der Vergangenheit, oder der Ideale, oder der Ziffern, Zahlen, Hypothesen, Theorien und Systeme ganz aufgehen und von dem rings um sie pulsierenden Leben nichts merken.
Dieser interessante Menschenschlag scheint jetzt im Aussterben begriffen oder gar schon ausgestorben. Die Göttin Isis hat den Schleier von ihrem Antlitz genommen, und ihre Priester schämen sich jetzt der alten Perücken, Mäntel und Schoßröcke, haben sie gegen Frack und Paletot vertauscht und sind unter die Menschen gegangen.
Selten einmal trifft man noch irgendwo solch einen unrasierten und ungekämmten Gelehrten, mit dem unbeweglichen, ewig sinnenden Blick, der immer nur sich um die Wissenschaft drehenden Konversation, dem einseitigen, tief in ihre Geheimnisse eingedrungenen Verstande. Sie sind selten geworden, diese schwerfälligen, leicht verlegenen, den Frauen ausweichenden, gedankentiefen Männer mit der komischen Zerstreutheit und der rührend kindlichen Naivität – diese Märtyrer, Ritter und Opfer der exakten Forschung. Sie sind heute ein Anachronismus, diese Pedanten der Wissenschaft – ihre Weisheit würde kaum noch jemanden in Erstaunen setzen.
Leontij war noch einer der wenigen, die dieser Art von Gelehrten angehörten, wenn auch die Zeit, in der er lebte, so manche Schroffheit des Typus in ihm gemildert hatte. Er war ein Landsmann von Raiski und hatte mit ihm zusammen die Schule und die Universität besucht. Verfolgte man sein Leben von seinen Kindheitsjahren an, so kam man zu dem Schlusse, daß auch der Gelehrte dieses Schlages, gleich dem Dichter, »geboren werden muß«. Von klein auf sah man ihn nur immer mit zerzaustem Haar und abwesendem Blick, ewig zwischen Büchern und Heften wühlend, als ob er keine Kindheit hätte, keine Nerven, die auch einmal in mutwilligem Spiel und munteren Streichen sich austoben wollen.
Menschen dieser Art werden schon von ihren Schulkameraden zur Zielscheibe von allerhand Scherzen erwählt. Da hat irgendein Schelm dem armen Leontij das Gesicht ganz mit Ruß beschmiert, und er geht nun zur Belustigung der anderen den ganzen Tag so umher, ohne das geringste zu merken, und bekommt dann obendrein noch vom Inspektor einen Rüffel, weil er so schmutzig herumläuft.
Versetzt ihm jemand einen Puff, zwickt oder zwackt ihn jemand, dann runzelt er nur die Stirn, und statt aufzuspringen und hinter dem kecken Störenfried herzurennen, dreht er sich nur gelegentlich langsam um, guckt zerstreut nach allen Seiten, reibt, während der andere längst über alle Berge ist, sich höchstens die schmerzende Stelle und versinkt wieder in sein Grübeln, bis ein neuer Puff, ein neuer Nasenstüber oder das Läuten der Glocke, die ihn zu Tisch ruft, ihn aus seinem Traumlande lockt.
Nimmt ihm jemand sein Frühstück oder Mittagessen weg, um es selbst zu verzehren, so macht er keinen Lärm, stellt nicht erst eine Untersuchung an, sondern nimmt sich irgendein recht schwieriges Buch vor, um über der geistigen Arbeit seinen Appetit zu vergessen, oder er geht hungrig, wie er ist, zu Bett und schläft ein.
Sich irgendwie, mit List, Gewalt oder durch Bitten ein Mittagessen als Ersatz für das ihm weggenommene zu verschaffen, lag ebensowenig in seiner Art, wie die Verfolgung der frechen Räuber, die es ihm wegnahmen. Nur wenn der Zufall ihn auf etwas Eßbares stieß, verzehrte er es, ohne lange zu fragen, ob es ihm selbst oder sonst jemandem gehörte.
Aber so sehr sich die Kameraden auch über seine Nachdenklichkeit und Zerstreutheit lustig machten – sein warmes Herz, seine einfache, schlichte Güte, sein einheitlicher, reiner und edler Charakter hatten selbst bei den kleinen Bürschchen der unteren Schulklassen ihren Eindruck nicht verfehlt und ihm die unbedingte Sympathie des jungen Volkes gesichert. Er hatte wohl Ursache, so manchem von ihnen feind zu sein – ihm selbst war nie jemand feind.
Als sie dann alle mit der Zeit heranwuchsen und die Flegeljahre hinter sich hatten, begriffen sie ihn allmählich und wandten ihm ihre Achtung und Teilnahme zu, um so mehr, als er nicht nur als Charakter, sondern auch als Autorität auf wissenschaftlichem Gebiete ihnen imponierte. Er hatte ganz das Wesen eines deutschen Gelehrten, kannte die alten und neuen Sprachen, wenn er auch in keiner von den letzteren praktische Übung hatte, wußte in allen Literaturen Bescheid und war ein leidenschaftlicher Bibliophile.
Sein positives Wissen war sehr umfangreich, es war kein »stehender Sumpf«, kein toter Friedhof, wie das Wissen so manches verpaukten Seminaristen, der in seinem Gedächtnis Daten an Daten reiht, wie ein Totendenkmal zum anderen, leblos, äußerlich, ohne Zusammenhang, nur durch die darüber gewachsene Grasdecke und das tote Schweigen zu einem Ganzen verbunden.
Leontijs Wissen war im Gegenteil voll Leben, wenn es auch selbst der Vergangenheit angehörte. Er blickte mit offenen Augen in jene fernen Zeiten, die seinen Geist beschäftigten. Er verstand in seinen Büchern zwischen den Zeilen zu lesen. Zu einem antiken Becher fügte er im Geiste ein antikes Gastmahl, bei dem es lustig herging, zu der Münze dachte er sich die Tasche hinzu und den Mann, dem die Münze gehörte.
So manches Mal hatten sie sich mit Raiski in diese Welt vertieft – Raiski als der Dilettant, der für seine lebhafte Phantasie vorübergehend neue Nahrung suchte, Koslow dagegen als der begeisterte Forscher, der mit seinem ganzen Leben in der Sache aufging. In solchen Momenten hatte Raiski bei ihm denselben Gesichtsausdruck gesehen wie bei Wassjukow, wenn der seine Geige spielte, und er hatte seinen begeisterten, lebendigen Schilderungen der alten Welt gelauscht oder ihn selbst im Spiel der Phantasie mit fortgerissen – und so hatte jeder in dem anderen diesen lebendigen Nerv liebgewonnen, der sie beide, jeden auf seine Art, mit der Wissenschaft von jenen fernen Zeiten verband.
Leontij erschien zuweilen einseitig mit seiner leidenschaftlichen Begeisterung für die griechische und lateinische Grammatik, er war dann trocken und pedantisch, doch lag in seiner Pedanterie nichts Prahlerisches, weil er seinen Gegenstand aufrichtig liebte, weil diese trockene Grammatik für ihn der Schlüssel war für das antike Leben, das er so sehr liebte, in dem er aufging, und das ihm als der Quell und das Vorbild der modernen Kultur, des modernen Lebens erschien.
Er liebte ihn, diesen Urquell unseres Wissens, unserer Entwickelung – aber seine Liebe war gar zu leidenschaftlich und heiß, er gab sich ihr ganz und gar hin und verlor den Blick und das Verständnis für das Leben der Gegenwart. Er war wie ein Fremdling in diesem Gegenwartsleben, erschien unbeholfen, lächerlich, so gar nicht heimisch darin. Er achtete und ehrte bedingungslos alles, was nach den klassischen Mustern geschaffen war oder ihnen irgendwie entsprach. Er schätzte Corneille und hatte sogar eine Schwäche für Racine, wenn er auch spöttisch lächelnd zu sagen pflegte, daß sie für ihre Marquis lediglich die Togen und Chitone bei den Alten entliehen hätten, wie für eine Maskerade – immerhin jedoch versöhnte es ihn, daß aus den Schöpfungen dieser Dichter ihm die Namen der alten Heroen und der alten Stätten entgegenklangen.
In den neueren Literaturen ließ er, soweit sie sich nicht der antiken Form bedienten, nur die hohe Poesie gelten, während er allem Trivialen und Alltäglichen abgeneigt war; er liebte Dante und Milton und versuchte auch Klopstock zu lesen, kam jedoch nicht weit darin. Für Shakespeare hegte er zwar Bewunderung, liebte ihn jedoch nicht; Goethe dagegen liebte er, doch nicht den Romantiker, sondern nur den Klassiker Goethe; die römischen Elegien und die »Italienischen Reisen« entzückten ihn weit mehr als der »Faust«; »Wilhelm Meister« kam für ihn nicht in Betracht, dafür konnte er den »Prometheus« und den »Tasso« auswendig.
Er verehrte die Gemälde Raffaels, dagegen schätzte er die Meister der vlämischen Schule nicht sehr hoch und lächelte unwillkürlich, wenn er ein Bild von Teniers sah.
Er war so arm, daß kaum noch eine Steigerung seiner Armut zu denken war. Er hatte als Schüler in einem Verschlage gewohnt, zwischen dem Ofen und den Brennholzstapeln, die zum Heizen des Ofens bestimmt waren. Er arbeitete beim Lichte einer elenden Fettlampe, und hätten die Freunde ihm nicht hilfreich beigestanden, er hätte nicht gewußt, woher er sich Bücher beschaffen, wie er zu Wäsche und Kleidern kommen sollte.
Geschenke nahm er nicht an, weil er keine Gegengeschenke machen konnte. Sie verschafften ihm Stunden, sie ließen sich Dissertationen von ihm anfertigen und schenkten ihm dafür Wäsche, Kleider, nur selten einmal Geld, am häufigsten jedoch Bücher, von denen sich mit der Zeit eine Menge bei ihm ansammelte.
Alle seine Jugendgenossen waren voll Leben und Unternehmungslust und trugen sich mit großen Zukunftsplänen: nur er allein plante nichts, träumte nicht davon, einmal ein großer Heerführer oder Dichter zu werden. Er sagte nur: ich will als Lehrer in die Provinz gehen – und hielt dieses bescheidene Ziel für die Bestimmung seines Lebens. Die Kameraden, unter ihnen auch Raiski, suchten seinen Ehrgeiz zu stacheln, sprachen ihm von produktiver, schöpferischer Tätigkeit und von einem akademischen Lehrstuhl. Gewiß war dies das höchste Ziel seiner Wünsche, der Marschallstab, den er im Tornister trug. Aber er antwortete nur mit einem tiefen Seufzer, wenn sie ihm davon vorzuschwärmen begannen.
»Gewiß, sehr schön,« sagte er, während er sich in die Rolle eines Professors hineinzudenken suchte. »So auf ganze Generationen mit dem lebendigen Wort zu wirken, und alles, was man weiß, was man liebt und verehrt, einer wißbegierigen Jugend zu übermitteln – gewiß, das wäre herrlich! Wieviel Arbeit gäbe das, wieviel wissenschaftliche Hilfsquellen, welches Material: die Bibliotheken, der lebendige Verkehr mit den Kollegen, dann vielleicht auch eine Reise ins Ausland, nach Deutschland, nach Cambridge, nach Edinburgh . . .« fügte er begeistert hinzu – »das gäbe Bekanntschaften und Korrespondenzen . . . doch nein, wie kann ich daran denken!« fuhr er, aus seinem Rausche erwachen, fort. »Solch ein Professor hat auch noch andere Pflichten, er sitzt in den Kommissionen, muß Prüfungen abhalten, muß bei feierlichen Akten öffentliche Reden halten . . . das würde mich nur verwirren, das ist nichts für mich! Laßt mich ruhig als Lehrer in die Provinz gehen!« sagte er, alle noch so verführerischen Träume mit Entschiedenheit ablehnend, und steckte die Nase in seine Bücher und Hefte.
Alle anderen hatten nach und nach ihre Illusionen aufgegeben. Wer sich schon als Feldherr gesehen und von der Ausrottung des Menschengeschlechts geträumt hatte, war vom Leben schließlich auf sein väterliches Stammgut verschlagen worden und begnügte sich dort damit, seine Art fortzupflanzen, Karten zu spielen, Gastereien mitzumachen und über die Höhe der Gerichtssporteln zu räsonnieren.
Ein anderer, der eine hohe dienstliche Stellung angestrebt hatte, die ihm Gelegenheit zur Entfaltung einer vielseitigen und segensreichen Tätigkeit geben sollte, wurde schließlich Mitglied irgendeines Klubs, dem er seine ganze Muße weihte.
Und auch Raiski hatte einst geträumt – von einer glänzenden Künstlerkarriere, und noch immer trug er das »heilige Feuer« in der Brust und zeichnete Skizzen, Motive, Studien, entwarf große Pläne, die er nicht ausführte, und ein Name war noch immer unbekannt, seine Meisterwerke noch ungeboren.
Nur Leontij hatte das Ziel erreicht, das er sich gesetzt hatte, er war – Lehrer in der Provinz geworden.
Die Zeit der Trennung war gekommen, die Kameraden verließen einer nach dem anderen die Universität. Leontij blickte unruhig um sich, er sah, wie leer es rings um ihn geworden war, und als durch und durch unpraktischer Mensch wußte er nicht, was er anfangen sollte.
»Auch du!« sagte er traurig, wenn wieder jemand kam, um von ihm Abschied zu nehmen.
Kaum einer schied ohne Tränen von ihm, und auch ihm flossen die Augen über, und er dachte weder an die Rippenstöße und Nasenstüber, noch an die Spottreden, die er heruntergeschluckt, noch an die Frühstücksschüsseln und Mittagessen, die er nicht heruntergeschluckt hatte.
Schließlich kam die Zeit, da auch er sich um ein Stück Brot bemühen mußte. Doch wohin sollte er sich wenden? Raiski brachte alles auf die Beine, auch die Professoren legten sich für ihn ins Zeug und schrieben seinetwegen nach Petersburg, und endlich bekam er in seiner Heimatstadt die ersehnte Stelle.
Dort, in der Heimat, richtete ihm Raiski mit Hilfe der Großmutter und einiger Bekannten eine Wohnung ein, und kaum waren alle diese Äußerlichkeiten erledigt, als Leontij sogleich mit Eifer und Geduld an sein Werk ging und sich von neuem in jene fremde, längst entschwundene Welt vertiefte, die er zu der seinigen gemacht hatte.
Tatjana Markowna hatte sich der reichhaltigen Bibliothek, die Raiski geerbt hatte, nicht so recht annehmen können, die zum Teil sehr wertvollen Bücher lagen wenig beachtet drüben im Staub und Moder des alten Hauses. Marsinka hatte ab und zu einen Band herübergeholt, ohne Wahl, heute den Gulliver oder »Paul und Virginie«, morgen Chateaubriand oder Racine, dann wieder einen Roman der Madame Genlis, und sie hütete die Bücher mit derselben Sorgfalt wie ihre Blumen und Vögel. Die übrigen Bücher drüben im alten Hause nahm eine Zeitlang Wjera in ihre Obhut, das heißt, sie nahm davon, was ihr gefiel, las darin oder las nicht und stellte sie wieder in ihr Fach zurück. Immerhin war doch eine menschliche Hand mit ihnen in Berührung gekommen, und sie waren in halbwegs gutem Zustande erhalten geblieben, bis auf einige der älteren und »fettigeren«, an die sich die Mäuse herangemacht hatten. Wjera hatte die Großtante gebeten, darüber an Raiski zu schreiben, und dieser hatte bestimmt, daß die Bücher Leontij zur Aufbewahrung übergeben werden sollten. Dieser stand ganz starr vor Entzücken da, als er den dreitausend Bände umfassenden Schatz erblickte. Die alte verstaubten, verschimmelten Folianten erwachten zu neuem Leben, wurden wieder gelesen und gebraucht – bis irgendein Mark, wie Koslow an Raiski geschrieben hatte, sich darangemacht hatte, das Werk der Mäuse zu vollenden.