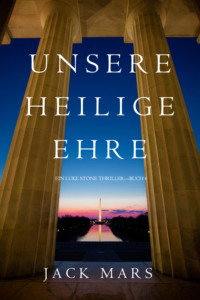Kitabı oku: «Unsere Heilige Ehre», sayfa 2
KAPITEL DREI
23:16 Uhr israelischer Zeit (16:16 Uhr Eastern Standard Time)
Die Blaue Linie, die israelisch-libanesische Grenze
„So gehorche nicht den Ungläubigen“, flüsterte der siebzehnjährige Junge.
Er atmete tief ein.
„Eifere mit dem Koran in großem Eifer gegen sie. Bekämpfe sie; so wird Allah sie durch deine Hand bestrafen und demütigen und dir gegen sie helfen.“
Der Junge war so kampferfahren, wie man nur sein konnte. Mit fünfzehn Jahren hatte er seine Heimat und seine Familie verlassen, um der Armee Gottes beizutreten. Er war nach Syrien gereist und hatte zwei Jahre damit verbracht, in den Straßen, Angesicht zu Angesicht gegen die Apostaten von Daesh zu kämpfen, die die Leute aus dem Westen als den Islamischen Staat bezeichneten.
Die Anhänger von Daesh hatten keine Angst vor dem Tod – im Gegenteil, sie hießen ihn sogar willkommen. Viele von ihnen waren Tschetschenen oder Iraker und nur schwer zu töten. Die Anfangszeit war ein besonders schlimmer Alptraum gewesen, aber der Junge hatte überlebt. In diesen zwei Jahren hatte er zahlreiche Schlachten überstanden und noch mehr Menschen getötet. Und er hatte einiges über den Krieg gelernt.
Jetzt stand er in der Dunkelheit auf einem Hügel im Norden Israels. Er hatte einen Raketenwerfer zur Panzerabwehr auf seiner rechten Schulter. Noch vor wenigen Jahren wäre dieses schwere Geschütz unerträglich gewesen und seine Knochen hätten angefangen zu schmerzen. Aber jetzt war er stärker. Das Gewicht machte ihm nicht mehr viel aus.
Er war von spärlichem Baumbewuchs umgeben. In seiner Nähe war ein Trupp Soldaten, die die Straße unterhalb beobachteten.
„Lasst also für Allahs Sache diejenigen kämpfen, die das irdische Leben um den Preis des jenseitigen Lebens verkaufen“, sagte er leise, fast unhörbar. „Und wer für Allahs Sache kämpft, alsdann getötet wird oder siegt, dem werden Wir einen gewaltigen Lohn geben.“
„Abu!“, flüsterte jemand nachdringlich.
„Ja.“ Seine Stimme war gelassen.
„Sei ruhig!“
Abu atmete tief ein und stieß den Atem langsam und kontrolliert aus.
Er war ein Experte im Umgang mit dem Raketenwerfer. Er hatte so viele Male aus ihnen gefeuert, dass seine Genauigkeit inzwischen sehr wertvoll war. Das war eine Sache, die er über den Krieg gelernt hatte. Je länger man am Leben blieb, je mehr Fähigkeiten man sich erarbeitete, desto besser wurde man. Je besser man wurde, desto wertvoller war man und desto wahrscheinlicher war es, dass man einen weiteren Tag überlebte. Er hatte viele gekannt, die es nicht lange geschafft hatten – eine Woche, zehn Tage. Einmal hatte er sogar jemanden kennengelernt, der gleich am ersten Tag getötet worden war. Wenn man aber einmal den ersten Monat hinter sich hatte, dann –
„Abu!“, zischte die Stimme erneut.
Er nickte. „Ja.“
„Bist du bereit? Sie kommen.“
„Okay.“
Er führte die Handgriffe routiniert durch, ganz entspannt, fast, als würde er nur üben. Er hievte den Raketenwerfer hoch und faltete den Ständer aus. Er legte seine linke Hand auf das Rohr und richtete das Visier aus, nur ganz leicht, bis das Ziel in seinem Blickfeld war. Zu schnell zu fest zuzupacken war keine gute Idee. Der Zeigefinger seiner rechten Hand umspielte den Abzug. Er näherte sich mit dem Kopf an das Visier an, blickte aber noch nicht hindurch. Er bevorzugte es, bis zum letzten Moment ein freies Blickfeld zu haben, sodass er die gesamte Situation überblicken konnte. Seine Knie waren leicht gebeugt.
Jetzt konnte er die Scheinwerfer des Konvois sehen, die hinter dem Hügel zu seiner Rechten auftauchten. Sie arbeiteten sich langsam die Straße hinauf. Die Lichter schienen gen Himmel und warfen wirre Schatten. Ein paar Sekunden später konnte er das Rumpeln der Motoren hören.
Er atmete erneut tief ein.
„Ruhig …“, sagte eine strenge Stimme. „Ganz ruhig.“
„Allmächtiger Allah“, sagte Abu und sprach jetzt schneller und lauter als zuvor. „Führe meine Hände und meine Augen. Bring Tod über deine Feinde, in deinem Namen und im Namen deines Propheten Mohammed und aller großen Propheten.“
Der erste Jeep kam um die Kurve. Seine runden Scheinwerfer waren jetzt deutlich zu sehen, wie sie durch den nächtlichen Nebel schnitten.
Der junge Abu spürte das Gewicht des schweren Raketenwerfers jetzt stärker. Er blickte mit dem rechten Auge durch das Visier. Die Fahrzeuge wurden schlagartig größer und erschienen so nah, als könnte er sie anfassen. Sein Finger schloss sich um den Abzug. Er hielt den Atem an. Er war nicht länger nur ein Junge mit einem Raketenwerfer – er und die Waffe verschmolzen zu einem Wesen, zu einer Todesmaschine.
Um ihn herum bewegten sich die Männer wie Schlangen und krochen auf die Straße zu.
„Ruhig“, sagte die Stimme erneut. „Das zweite Fahrzeug, hörst du?“
„Ja.“
In seinem Visier war der zweite Jeep jetzt genau in der Mitte. Er konnte die Silhouetten seiner Insassen sehen.
„Einfach“, flüsterte er. „So einfach … ganz ruhig …“
Zwei Sekunden vergingen, in denen Abu den Fahrzeugen mit dem Lauf des Raketenwerfers folgte, langsam von rechts nach links, ohne zu zittern.
„FEUER!“
* * *
Jetzt kam der Teil ihrer Patrouille, den Avraham Gold am meisten hasste.
Hassen war vielleicht der falsche Ausdruck. Er hatte Angst. Jeden Moment wäre es so weit.
Er redete immer zu viel. Die Worte sprudelten einfach so aus ihm hervor, nur weil er endlich hier wegwollte. Er nahm einen langen Zug von seiner Zigarette – eigentlich war es gegen die Vorschriften, auf Patrouille zu rauchen, aber das war das Einzige, was ihn beruhigte.
„Israel verlassen?“, sagte er. „Niemals! Israel ist meine Heimat, jetzt und für immer. Natürlich würde ich gerne mal ins Ausland, aber auswandern? Wie könnte ich? Gott hat uns gerufen, hier zu leben. Dies ist das Heilige Land. Das Land, das uns versprochen wurde.“
Avraham war zwanzig Jahre alt, ein Unteroffizier der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte, der IDF. Seine Großeltern waren Deutsche, die den Holocaust überlebt hatten. Er glaubte an jedes Wort, das er gerade gesagt hatte. Aber seine Ausrede klang trotzdem hohl, wie ein kitschiger Werbefilm im Fernsehen.
Er saß am Steuer eines Jeeps, der Dritte in einer Kolonne. Er blickte das Mädchen an, das neben ihm saß. Daria. Mein Gott, ist sie hübsch!
Selbst mit ihrem kurz geschorenen Haar, selbst in der nicht gerade vorteilhaften Uniform. Es war ihr Lächeln. Ihr Lächeln erhellte den Himmel. Und ihre langen Wimpern – wie die einer Katze.
Sie war fehl am Platze hier, in diesem … Niemandsland. Besonders mit ihren Ansichten. Sie war eine Liberale. Es sollte keine Liberalen bei der IDF geben, dachte Avraham. Sie waren nutzlos. Und Daria war noch schlimmer. Sie war …
„Ich glaube nicht an euren Gott“, sagte sie nur. „Das weißt du.“
Jetzt lächelte Avraham. „Ich weiß, und wenn du nicht mehr bei der Armee bist, wirst du –“
Sie beendete den Satz für ihn. „Nach Brooklyn ziehen, genau. Mein Cousin hat dort eine Umzugsfirma.“
Er lachte fast laut auf, trotz seiner Nervosität. „Bist du nicht ein bisschen zu dürr dafür, Sofas und Klaviere die Treppen hoch und runter zu tragen?“
„Ich bin stärker als du vielleicht –“
In dem Moment knackte das Radio. „Abel-Patrouille. Bitte melden, Abel-Patrouille.“
Er nahm den Receiver ab. „Abel.“
„Wo steckt ihr?“, fragte die blecherne Stimme.
„Wir kommen gerade in Sektor Neun an.“
„Gerade rechtzeitig. Okay. Haltet die Augen auf.“
„Ja, Sir“, sagte Avraham. Er legte den Receiver auf und blickte Daria an.
Sie schüttelte ihren Kopf. „Wenn die Sache so schlimm ist, warum unternehmen sie dann nichts dagegen?“
Er zuckte mit den Achseln. „So ist das Militär. Sie unternehmen erst etwas, nachdem irgendwas Schreckliches passiert ist.“
Ihr Problem war nur ein wenig weiter. Der Konvoi bewegte sich von Osten nach Westen entlang der engen Straße. Rechts von ihnen befand sich ein dichter Wald – er begann ungefähr fünfzig Meter von der Straße entfernt. Die IDF hatte das Gebiet bis zur Grenze hin gerodet. Wo die ersten Bäume wuchsen, begann der Libanon.
Links von ihnen waren drei steile, grün bewachsene Hügel. Nicht wirklich Berge, aber auch nicht gerade klein. Der Anstieg war abrupt und steil. Die Straße führte um sie herum und für nur einen Moment wäre der Radioempfang gestört und der Konvoi war ungeschützt.
Das IDF-Kommando hatte schon seit einem Jahr über diese Hügel diskutiert. Es musste hier sein. Sie würden den Wald niemals einnehmen können, da er sich im Libanon befand – das würde einen internationalen Konflikt auslösen. Also hatten sie geplant, die Hügel mit Dynamit zu füllen. Danach hatten sie einen Wachturm bauen wollen. Doch beide Pläne waren wieder verworfen worden. Wenn sie die Hügel in die Luft jagen würden, müsste die Straße von der Grenze weg umgeleitet werden. Und ein Wachturm wäre konstant durch mögliche Angriffe bedroht.
Nein, es war das Beste, die Hügel einfach Tag und Nacht zu patrouillieren und zu beten.
„Halt den Wald im Blick“, sagte Avraham. „Halt die Augen auf.“
Ihm wurde klar, dass er die Worte seines Kommandanten wiederholt hatte. Wie dumm von ihm! Er blickte wieder zu Daria. Ihr schweres Gewehr lag neben ihrer geradezu mageren Gestalt. Sie kicherte und schüttelte ihren Kopf, während ihre Wangen rot wurden.
In der Dunkelheit vor ihnen durchbrach plötzlich ein Blitzlicht die Nacht.
Es flog auf den mittleren Jeep zu, der nur zwanzig Meter vor ihnen war. Der Wagen explodierte, wurde auf die Seite geschleudert und rollte davon. Er brannte und seine Insassen standen bereits in Flammen.
Avraham trat mit aller Kraft auf die Bremsen, aber es war zu spät. Er prallte auf das brennende Fahrzeug auf.
Neben ihm schrie Daria.
Sie hatten sie von der falschen Seite aus angegriffen – von den Hügeln aus. Aber dort gab es doch gar keine Deckung. Es war auf der israelischen Seite.
Er hatte keine Zeit, etwas zu sagen, keine Zeit, Daria einen Befehl zuzurufen.
Jetzt kamen aus beiden Richtungen Schüsse. Maschinengewehrkugeln prallten auf ihre Türen auf. TAK-TAK-TAK-TAK-TAK-TAK. Die Fenster zersplitterten und Scherben prasselten ins Wageninnere. Mindestens eine der Kugeln hatte die Panzerung durchbrochen. Er wurde getroffen. Er blickte an sich herunter – Dunkelheit machte sich in seinem Blickfeld breit. Er blutete. Er konnte es kaum spüren – es fühlte sich wie ein Bienenstich an.
Er grunzte auf. Männer rannten draußen in der Dunkelheit umher.
Bevor er wusste, was er tat, hatte er seine Waffe in der Hand. Er zielte aus dem kaputten Fenster.
PENG!
Das Geräusch war ohrenbetäubend.
Er hatte jemanden getroffen. Er hatte wirklich jemanden getroffen. Der Mann stürzte zu Boden.
Er visierte noch einen von ihnen an.
Ganz ruhig …
Plötzlich passierte etwas. Sein gesamter Körper zuckte in seinem Sitz auf. Er ließ seine Waffe fallen. Ein Schuss, etwas Schweres, hatte ihn geradewegs durchbohrt. Es war von hinten gekommen und in das Armaturenbrett eingeschlagen. Eine Kugel, oder vielleicht eine kleine Rakete. Vorsichtig, taub vor Schock, tastete er seine Brust ab und berührte den Bereich unterhalb seines Rachens.
Da war … nichts.
Ein riesiges Loch klaffte in seiner Brust. Wie war es überhaupt möglich, dass er noch lebte?
Eine Antwort bildete sich in seinem Kopf: Es ist bald vorbei.
Er spürte es nicht einmal. Wärme breitete sich in seinem Körper aus. Er blickte wieder zu Daria. Es war so schade. Er hatte sie überzeugen wollen. Wovon? Das wusste er nicht mehr.
Sie starrte ihn an. Ihre Augen waren kreisrund, wie riesige Teller. Ihr Mund war zu einem stummen Schrei aufgerissen. Er wollte sie trösten, selbst in diesem Moment noch.
„Es ist in Ordnung“, wollte er ihr sagen. „Es tut gar nicht weh.“
Aber er konnte nicht sprechen.
Plötzlich tauchten hinter ihr im Fenster Gestalten auf. Sie schlugen die restlichen Glasscherben des Fensters mit den Läufen ihrer Waffen ein. Hände langten ins Wageninnere und versuchten sie herauszuziehen, aber sie wehrte sich.
Die Tür wurde geöffnet. Drei Männer zerrten jetzt an ihr.
Und dann war sie verschwunden und er war alleine.
Avraham starrte auf das brennende Fahrzeug in der Dunkelheit vor ihm. Ihm fiel auf, dass er keine Ahnung hatte, was mit dem ersten Wagen passiert war. Aber das war ihm im Moment egal.
Er dachte kurz an seine Eltern und seine Schwester. Er liebte sie alle und er verspürte kein Bedauern beim Gedanken an sie.
Er dachte an seine Großeltern, die vielleicht schon auf ihn warteten.
Er konnte das brennende Fahrzeug nicht mehr erkennen. Alles, was er noch wahrnehmen konnte, war ein helles Rot, Gelb und Orange, das vor einem schwarzen Hintergrund flackerte. Er beobachtete die Farben, wie sie langsam kleiner wurden und verblassten und die Dunkelheit, wie sie sich langsam ausbreitete. Das Inferno des explodierten Jeeps erschien ihm jetzt nur noch wie der Docht einer Kerze, der kurz vor dem Ausbrennen war.
Er beobachtete ihn, bis auch das letzte bisschen Farbe verschwunden war.
KAPITEL VIER
16:35 Uhr Eastern Standard Time
Hauptquartier des Special Response Team
McLean, Virginia
„Nun, ich schätze, damit ist die alte Bande offiziell wiedervereinigt“, sagte Susan Hopkins.
Luke lächelte.
Es war der erste Tag des Special Response Teams in ihrer neuen Unterkunft. Ihr neues Hauptquartier stand auf dem gleichen Gelände wie früher, aber alles war frisch renoviert worden. Das weitläufige, dreistöckige Glasgebäude befand sich in dem reichen Vorort McLean, nur wenige Kilometer von der CIA entfernt. Es war mit einem eigenen Hubschrauberlandeplatz ausgestattet, auf dem ein brandneuer schwarzer Bell 430 bereitstand. Das SRT-Logo blitzte strahlend weiß auf seiner Seite auf.
Vier schwarze Geländewagen standen auf dem Parkplatz. Die Büros befanden sich im Erdgeschoss und im ersten Stock, so wie der hochmoderne Konferenzraum, der dem Lagezentrum im Weißen Haus fast schon Konkurrenz machte. Er war mit jedem technologischen Wunder ausgestattet, das Mark Swann sich erträumt hatte. Der Fitnessraum (mit kompletter Kardioausstattung, Gewichten und einem gut gepolstertem Trainingsring) und die Cafeteria befanden sich im zweiten Stock. Der schalldichte Schießstand war im Keller.
Die neu errichtete Agentur hatte zwanzig Mitarbeiter, die perfekte Größe, um schnell auf brisante Ereignisse reagieren zu können. Sie waren nicht länger Teil des FBI, sondern eine Unterabteilung des Geheimdienstes, wodurch Luke sich nicht mehr mit der staatlichen Bürokratie abgeben musste. Er berichtete nun direkt an die Präsidentin der Vereinigten Staaten.
Das kleine Gelände war umgeben von einem Sicherheitszaun und Stacheldraht. Doch im Moment standen die Tore weit offen. Heute war Tag der offenen Tür. Und Luke freute sich, endlich hier zu sein.
Er schritt stolz mit Susan an seiner Seite durch die Gänge und zeigte der Präsidentin all das, was sie bereits gesehen hatte. Er fühlte sich wie ein Fünfjähriger. Ab und zu blickte er zu ihr herüber, genoss ihre Anwesenheit, passte aber auf, nicht zu sehr zu starren. Er kämpfte gegen den Drang an, ihre Hand zu halten. Sie scheinbar auch, denn ihre Hand strich fast ständig über seinen Arm oder seine Schulter.
All diese Berührungen würden sie sich für später aufsparen.
Luke widmete seine Aufmerksamkeit dem Gebäude. Es war genau so, wie er sich vorgestellt hatte. Seine alten Kollegen hatten alle zugesagt. Das war nicht selbstverständlich gewesen – bei all dem, was sie hatten durchstehen müssen und nachdem Luke sie quasi im Stich gelassen hatte, war es wie ein Geschenk für ihn, dass sie ihm wieder vertrauten.
Er und Susan betraten die Cafeteria und arbeiteten sich durch die Menge, flankiert von zwei Geheimdienstagenten. Mehr als zehn Leute standen am Büffet an. Am Fenster erblickte Luke die Person, nach der er gesucht hatte. Er stand zwischen Ed Newsam und Mark Swann und wirkte noch kleiner als sonst neben den riesigen Muskeln von Ed und Swann der Bohnenstange. Es war sein Sohn, Gunner.
„Komm, Susan, da vorne ist jemand, den ich dir vorstellen möchte.“
Sie sah plötzlich alarmiert aus. „Warte, Luke! Das ist nicht die richtige …“
Er schüttelte seinen Kopf und packte sie am Handgelenk. „Ist schon in Ordnung. Sag einfach, du bist meine Chefin. Lüg ihn an.“
Sie schritten durch die Menschenmenge und tauchten neben Gunner, Ed und Swann auf. Swann trug sein Haar in einem Pferdeschwanz und hatte seine gewölbte Brille auf. Er hatte ein schwarzes RAMONES T-Shirt an, verblichene blaue Jeans und gelb-schwarz karierte Chuck Taylor Sneakers.
Ed sah in seinem schwarzen Rollkragenpullover, der beigen Anzughose und den schwarzen Lederschuhen riesig aus. An seinem Handgelenk befand sich eine goldene Rolex. Seine Haare und sein Bart waren pechschwarz und fein säuberlich gestutzt.
Swann war für Informationssysteme zuständig – einer der besten Hacker, mit denen Luke je zusammengearbeitet hatte. Ed war Experte in Sachen Waffen und Taktik – er war wie Luke bei der Delta Force gewesen und absolut tödlich. Ed hatte ein Glas Wein in der Hand – im Vergleich zu ihm sah es fast schon lächerlich winzig aus. Swann hatte eine Dose Bier mit einem Piratenlogo in der einen Hand und einen Teller mit mehreren großen Sandwichscheiben in der anderen.
„Hey Leute, ihr kennt doch sicherlich Susan Hopkins?“, sagte Luke.
Ed und Swann schüttelten ihr nacheinander die Hand.
„Madam President“, sagte Ed. Er musterte sie und lächelte. „Schön, Sie wiederzusehen.“
Luke lachte fast laut auf, als Ed sie von oben bis unten betrachtete. Er raufte Gunners Haar, auch wenn das Gunner gar nicht gefiel – er war inzwischen doch viel zu alt dafür.
„Madam President, das hier ist mein Sohn, Gunner.“
Sie schüttelte seine Hand und setzte einen Blick auf, der sagte: Ich bin die Präsidentin und lerne gerade nur irgendein kleines Kind kennen. „Gunner, schön, dich kennenzulernen. Wie gefällt dir die Party?“
„Ist ganz okay“, sagte er. Seine Wangen wurden knallrot und er blickte sie kaum an. Er war immer noch schüchtern.
„Sind deine Kleinen auch hier?“, fragte Luke Ed und wechselte das Thema.
Ed zuckte mit den Achseln und lächelte. „Oh ja, sie laufen hier irgendwo rum.“
Eine Frau tauchte plötzlich neben ihnen auf. Sie war groß, blond und sehr einnehmend. Sie trug einen roten Anzug und hochhackige Schuhe. Erstaunlicher noch als ihr Outfit war, dass sie sich direkt an Luke wandte und die Präsidentin der Vereinigten Staaten vollkommen ignorierte.
Sie hielt ein Smartphone in seine Richtung, als wäre es ein Mikrofon.
„Agent Stone, mein Name ist Tera Wright und ich arbeite für WFNK, den Nummer Eins Radiosender in D.C.“
Luke lachte bei ihrer Vorstellung fast auf. „Hi, Tera“, sagte er. Er erwartete, dass sie ihn nach der Neueröffnung des Special Response Teams fragen würde und ihrer Aufgabe, den Terrorismus sowohl im In- als auch im Ausland zu bekämpfen. Natürlich würde er ihr nur zu gerne davon erzählen.
„Wie kann ich Ihnen helfen?“
„Nun“, fing Tera an, „wie ich sehe, ist die Präsidentin hier bei der großartigen Eröffnung Ihrer Agentur.“
Luke nickte. „Natürlich ist sie das. Ich denke, dass die Präsidentin weiß, wie wich–“
Die Frau fiel ihm ins Wort. „Könnten Sie mir wohl eine Frage beantworten?“
„Natürlich.“
„Stimmen die Gerüchte?“
„Ähm, mir ist nicht ganz klar, welche –“
„Sie sind schon seit einigen Wochen im Umlauf“, informierte ihn Tera Wright.
„Gerüchte worüber?“, fragte Luke. Er blickte sich um, wie jemand, der am Ertrinken war und panisch nach einem Seil suchte.
Tera Wright hob die Hände, als wollte sie sagen „Schluss mit Lustig.“ „Lassen Sie es mich anders ausdrücken“, sagte sie stattdessen. „Wie würden Sie Ihre Beziehung zu Präsidentin Hopkins beschreiben?“
Luke blickte Susan an. Sie ließ sich allerdings nichts anmerken. Sie war ein alter Hase in diesem Geschäft. Sie wurde weder rot, noch sah sie besonders schuldig aus. Sie hob nur eine Augenbraue und starrte die Reporterin verwirrt an, als hätte sie keine Ahnung, wovon sie da redete.
Luke atmete durch. „Nun ja, ich würde sagen, dass Präsidentin Hopkins meine Chefin ist.“
„Mehr nicht?“, bohrte die Reporterin nach.
„Mehr nicht“, sagte Luke. „Sie ist meine Oberbefehlshaberin.“
Er blickte erneut zu Susan und erwartete, dass sie nun etwas sagen würde, um das Gespräch in eine andere Richtung zu lenken. Stattdessen war Susans Stabschefin jetzt hier, Kat Lopez. Sie hatte einen körperbetonten blauen Nadelstreifenanzug an. Kat war immer noch dünn, auch wenn ihr Gesicht längst nicht mehr so jugendhaft war, wie noch vor einigen Jahren, als sie den Job angenommen hatte. Drei Jahre Stress hatten ihre Wirkung deutlich gezeigt.
Sie flüsterte leise in Susans Ohr.
Susans Gesicht verdüsterte sich, während sie ihr zuhörte. Schließlich nickte sie. Was auch immer sie erfahren hatte, es waren keine guten Neuigkeiten.
Sie blickte sich um.
„Gentlemen“, sagte sie. „Ich muss mich leider entschuldigen.“