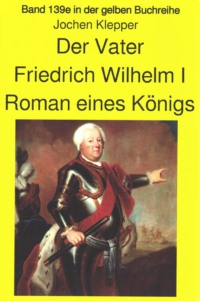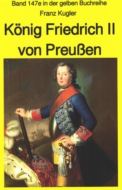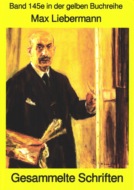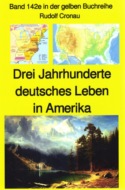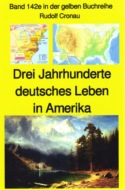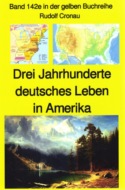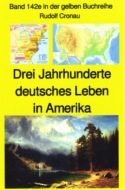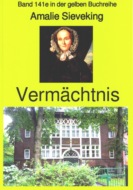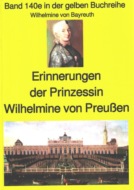Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 5
Von all den neuen Ragomontaden, Turlipinaden und Windbeuteleien, wie der König es nannte, erholte er sich hernach in rechter Männerunterhaltung mit dem neuen Freunde Seckendorff. Der kaiserliche General hielt sich vom Odium der Diplomatie unverändert frei. Kein Aufenthalt in Potsdam, der dem Wiener Grafen nicht rasch eine Einladung am Hofe brachte. Keine Übersiedlung Seiner Majestät nach Berlin, die nicht Seckendorff beinahe als dem ersten mitgeteilt wurde. So große Hochschätzung, so lebhafte Sympathien hegte der König für ihn. Es schien ihm noch unfasslich, dass abseits von aller Politik einer aus Wien kam, um von seinem Regiment zu lernen. Der kaiserliche General weilte geradezu als der Gast des königlichen Leibregimentes am preußischen Hofe und trug sogar schon dessen Uniform. Tapfer wie ein Degen sprach der gewiegteste aller kaiserlichen Geheimdiplomaten, der mit Bibel und Gesangbuch seinen Einzug in den Königsstädten Preußens gehalten hatte: ein General mit bürgerlicher Biedermannsmiene und dem Stiernacken und der Redeweise eines braven Pächters. Aber der Biedere war gerieben wie ein Pferdehändler und wusste, wie es anzufangen sei, die Weisung auszuführen, die vom Prinzen Eugen, Habsburgs großem Wächter, an ihn ergangen war, „den Unwillen des Königs gegen den englischen Hof auf eine geschickte Weise immer zu vergrößern“.
Die Königin, soweit der Schmerz über den Verlust des vergötterten Vaters es gestattete, war empört, dass der Gatte den bäurischen General all den neu erschienenen Gesandten so offensichtlich vorzog. Ihr Ältester sah sie in den Gewändern ihrer tiefen Trauer nur lächelnd, nur kühn, nur beschwingt; und unendlich liebevoll und zärtlich. Hundertmal schon hatte sie ihm gesagt: „Nun bist du die aufgehende Sonne. Um deinetwillen geschieht der Wechsel auf allen an deiner Heirat interessierten Gesandtschaften. Spürst du, dass eine neue Zeit der Geltung unseres Landes sich ankündigt? Und dein Vater nimmt es nicht wahr, geht stumpf daran vorbei. Du aber und ich –.“
* * *
Der König ritt durch seine Stadt, hundert Rufe und Fragen im Blick. Es war in der Stunde nach Tisch, in der er beim Ausreiten Bittschriften entgegennahm, welche dann abends in der Tabagie besprochen wurden.
So unablässig Sand- und Ziegelkarren durch die Straßen rollten, so unaufhörlich auch Gerüste abgebrochen und errichtet wurden, lag dennoch ein Schimmer von Festlichkeit über der Königsstadt! Denn immer wieder trug ein Dachfirst von weißem, jedoch manchmal gar zu jungem Holz den Laub- und Bänderschmuck der Richtfestkrone.
Ein neuer Stadtteil war um des Königs erst kürzlich eingeweihte Garnison-Kirche entstanden. Wieder war er selbst der erste Bauherr am Platze, auf Nacheiferung hoffend. Die Hiller und Brand waren fähige Männer; denen konnte man schon einmal ein etwas prächtigeres Haus zum Präsent machen und zugleich damit der Gattin eine kleine Freude im ihr gar so fremden Potsdam bereiten. Nun stand der reiche Bau vollendet, getreu dem Königsschloss Whitehall in England nachgebildet, neben dem vornehmen Gasthof zum „König von England“, dessen Name ebenfalls eine Huldigung an Frau Sophie Dorothea darstellte. Der Daum mit seiner Lütticher Gewehrfabrik, der war ein Unternehmer ganz nach König Friedrich Wilhelms Sinn. Für ein Bataillon Flinten die Woche, das brachten die Lütticher Büchsenmacher zu Potsdam nun schon zustande; und daher hatten auch sie allein die Genehmigung, noch Branntwein zu trinken.

Garnisonskirche in Potsdam
Die Bauten Potsdams waren schon zum Vorbild für die ganze Monarchie geworden. Häuser für Brauer, Bäcker, Handwerker jeglicher Innung wurden nach besonderem Muster gebaut, als solle jeder von ihnen die vollkommenste Werkstatt seines Gewerbes erhalten. Die Stadt war von sauberen Wassern durchströmt. Der König hatte nach Kanälen und Bassins Durchstiche für das Havelwasser machen lassen. Er führte die große sächsische Poststraße durch Potsdam. Er dotierte die Stadtkämmerei mit Rittergütern. Von Kirchen und von Regimentern zog er Baukollekten ein; aber größer waren immer noch die Bauzuschüsse, die er selber gab.
Der Herr, vorüberreitend, schaute in die Armenhäuser, Hospitäler, Arbeitshäuser, ob alles fest und hell und nützlich sei und selbst die Strafe noch der Besserung und der allgemeinen Wohlfahrt diene. Keinesfalls sollten die rechtschaffenen Untertanen zur Erhaltung der Verbrecher Steuerbeträge zahlen, daher mussten die Gefangenen arbeiten und mit ihrer Arbeit so viel verdienen, dass die Zucht- und Arbeitshäuser keinerlei Staatszuschuss erforderten, ja, der Staat durch sie noch Gewinn für allerlei Wohltätigkeit erzielte. Der Schuldige sollte als Helfer des Unglücklichen büßen.
Potsdam war Manufakturstadt geworden, die Manufakturstadt aber Soldatenquartier. Am mächtigsten waren die Soldatenhäuser emporgeschossen, erst neuerdings hundert und abermals hundert. Denn seinen verheirateten Grenadieren gab der König, kündeten sie ihm den ersten Sprössling an, ein eigenes Haus. So wohnten sie behütet und geordnet, indes in den Garnisonen der anderen Fürsten des Reiches und Europas Soldatenfrauen und Soldatenkinder verfemt, verspottet und gemieden, ja gefürchtet waren. Der Leib des Mannes war an den Landesherrn verkauft; sonst war und blieb der Soldat „gottlos, frech, faul und unbändig“ gescholten und war nicht wert, dass einer Mühe an ihn wandte. So dachten sie alle; so hielt es jeglicher Fürst, nur nicht der Oberst von Potsdam. Die Zeiten für den Tod gekaufter Söldner, die Zeiten der vertriebenen Soldatenweiber und des verwahrlosten Kindertrosses – in Preußen waren sie, allein auf dieser weiten, argen Welt, vergessen; und die Huren gingen scharenweise außer Landes. Andere Regenten hatten verkommene Feldlager, wo der Herr in Preußen eine Stadt der ewigen Hochzeit unablässig wachsen ließ.
Vorüber war, dass, wer die neuen Straßen seiner Stadt durchstreifte, wohl meinen musste, Potsdam sei ein kriegerischer Staat der Männer, ein heldischer Orden, ein Kloster in Waffen. Nun machten die größten, die stärksten, die schönsten Männer Europas Potsdam zur Fülle der Völker, zur Stadt der neuen Geschlechter, zum fruchtbaren Reich, das immer weitere Grenzen verlangte. Die Mädchen aus den Dörfern rings wurden als Bräute umworben. Und der König lächelte, wenn Gundling ihn an den Doppelsinn des Wortes Werbung gemahnte. Helden warb er für sein menschenarmes Land. Frauen warb der König für die Helden. Das Leben, nicht der Tod, ward hier zwischen Waffenarsenalen bereitet; und immer wieder waren Bauholzwagen, Pflüge und Kanonen hochzeitlich umkränzt. Mitten in Exerzitium und Arbeit brach immer wieder die Feier an. Was er den Soldaten gewährte, verweigerte der Herr auch den jungen Handwerksgesellen nicht, die er werben musste wie jene. Er versprach ihnen ihr Handwerksgerät, Vorschuss an Material und ein „hiesiges Mädchen zur Frau: Dadurch kommt der Geselle sofort zu Brot, etablieret eine Familie und wird sein eigener Herr. Da denn nicht zu glauben, dass es große Mühe kosten werde, dergleichen Leute nach Unseren Landen zu ziehen“.
Er warb noch um die Waisen der Grenadiere, obwohl noch keiner gefallen war für den König von Preußen. Er forschte unablässig nach Soldatenwaisen, die den fremden Potentaten von allem das lästigste Gesindel bedeuteten. Tausend Kinder barg er schon im großen neuen Haus; und überreich hatte er es mit Ländereien, Steuereinkünften und Leihhauserträgen beschenkt.
Mit losem Zügel, langsam, ritt der Herr am Waisenhaus vorbei. Er wollte unbemerkt die Kinder belauschen. Brav, brav: Da saßen auf Bänken rings im Hof die Knaben und strickten Strümpfe für die Regimenter; die Soldatenfrauen aber mussten ihnen monatlich jede vier Pfund Wolle dafür spinnen.
Im Nachbarhofe waren mit sauberen Schürzen und frischgewaschenen Händen die Mädchen um den großen Rahmen der Handarbeitslehrerin geschart, die er sich eigens aus Brüssel verschrieb, damit sie die Soldatentöchter die hohe, reichbezahlte Kunst des Spitzenknüpfens lehre, wie allenthalben in seinem Reiche „gute Spinnerinnen auf dem flachen Land umherreisen mussten“, die Frauen zu Hilfs- und Heimarbeiterinnen für die königlichen Manufakturen auszubilden.
Wen in der Welt, der ein Handwerk besonders gut verstand, hätte König Friedrich Wilhelm nicht in Potsdam anzusiedeln gesucht?! Er hatte solchen Meistern, sie mit ihrem tiefsten Herzen hier zu halten, ihre alte Heimat auf der neuen Erde neu gegründet. Und es war ein Ritt durch ganze Länder, wenn der Bettelkönig seine Stadt durchstreifte. Da war ein Obersachsen und ein Niedersachsen, ein Schwaben und Franken, ein Rheinland und Holland, Schweden und Polen und die Schweiz; da waren friedlich alle Feindesvölker der vergangenen, schweren Kriege beieinander: Russen, Franzosen, Österreicher, Spanier, Italiener, Engländer, Dänen und Böhmen – Krieger, Bauern, Schmiede, Gerber jeglicher mit seiner besten Kunst. Ein unablässig geschäftiges und friedlich wetteiferndes Völkergemisch, eine blühende und eine bunte Welt in der Öde, Kargheit und Strenge der Mark Brandenburg war in ihrer Hundertfältigkeit von der Hand des Königs, der sie erschuf, zum Ebenmaß geordnet und zum Gleichnis gesetzt.
Aus den Russenhäusern von dunklem Holze mit ihrer versonnenen Schnitzerei tönten die Lieder der Steppe; in den Meiereien sangen die Schweizer Soldaten mit den Melkern ihrer Heimat den Kuhreigen; vor den blanken, fensterreichen, roten Backsteinhäusern am Kanal mit seinen reinen Wassern und jungen Bäumen rauchten Bas und Glas ihre tönerne Pfeife. Und durch die Straßen der Völker und Stämme schritten dröhnend, Bilder der Einheit, Schönheit, Stärke und Ordnung, die Grenadiere Seiner Majestät im Rocke des König-Obristen: einander und ihm selber völlig gleich, als trügen sie ein Ordenskleid, indes da draußen in der Welt die Uniformen all der Regimenter die wildeste und bunteste Sache waren, wie sie die Laune eines großen Herrn erdachte, der sich eine Truppe für ein Abenteuer werben durfte. Der Preußenkönig hatte jenem Worte „Uniform“ den tiefen Sinn des einen Kleides gegeben. Sie alle trugen seinen Rock. Sie alle leisteten den einen Dienst mit ihm und taten ihn schweigend, nur von dem Wirbel der Trommeln gelenkt.
Der Oberst Friedrich Wilhelm von Hohenzollern ritt durch die Völker des Erdballs zu seinen Feldern hinaus, eine Pause seines Dienstes recht zu nützen.
Der Tag aber war glühend, König Friedrich Wilhelm kehrte noch nicht bald an seinen Schreibtisch heim. Er ritt noch lange am Rande der Felder entlang, weithin zu den Ufern des Heiligen Sees. Über dem See, den Kiefern und Birken seiner Buchten, standen steile, weiße Wolkenwände; vielleicht, dass ein Gewitter aufzog und starker Regen für die Ackerleute und Gärtner herabkam, ihr Werk zu erleichtern. Könige und Bauern lernen nach den Wolken blicken. Noch war kein Wind. Die tiefen Äste einer Birke hingen unbewegt über dem See, die Binsen und die Schilfe waren ohne Zittern, und über dem Wasser ruhte ein Dunst, in dem Libellen schwirrend stillestanden.
In einer Lichtung des Schilfes, ganz dicht vor König Friedrich Wilhelms Pferd, blitzte ein hoher Silberhelm seines Leibregimentes, auf die Erde geworfen, leuchtete eine der neuen roten Westen, wie sie nun erstmalig mit der Montur dieses Jahres ausgeteilt worden waren. Die Flinte stand an einen Baum gelehnt, und über dem kräftigsten der unteren Zweige hing die gelbe Hose und der blaue Rode. Sehr fern, erst jenseits des Gebüsches, ragte das kleine Dächlein des ersten Schilderhauses vor der Stadt empor.
Am Ufer rauschte es auf; in riesigen Stößen kam es zum Ufer – beinahe verfing sich der Grenadier in den Wurzeln; in höchster Eile griff er die Flinte auf. Nun stand der Schwimmer dicht am Weg, ein Riese, schön und gebräunt. Das blonde Haar, von Wasserbächen rinnend, lag in breiten Strähnen auf der kühnen Stirn. Über die mächtigen Schultern, den gewaltigen Leib strömten die Tropfen des sommerlichen Waldsees. Die Augen, tiefer als der Himmel dieses lichten Tages, waren groß zu dem König auf seinem Schimmel erhoben; und, noch so fliegenden Atems, dass die Brust sich hob und senkte, als sauge sie zum ersten Mal die Luft der Erde ein, erstarrte der Leib schon in der feierlichen Geste der Ehrenbezeigung. Ein junger Titan, dem Göttergeschlecht eines neuen Äons entsprossen, war den Fluten entstiegen; und kaum dass er die Erde betrat, noch ganz umrauscht von Klarheit und Kühle, war er bereit zu Wehr und Dienst. Der König hielt an. Er fragte sehr streng:
„Was hat der Soldat auf Wache zu tun, wenn der König vorüberkommt?“
„Das Gewehr zu präsentieren, Eure Majestät.“
Und das tat der Grenadier am See.
König Friedrich Wilhelm lächelte und verzieh.
Aber im Weiterreiten war das Lächeln längst dem Augenblick enthoben; und aus der Begegnung, durch die es erweckt war, erwuchs dem König die Fülle der Bilder.
Alle dunklen Sümpfe der Mark spiegelten und schimmerten ihm in der Sonne des hohen Sommers als klare, kühne, weite Seen. Und aus den Seen seines Landes stieg ihm das neue Geschlecht empor, machtvollen Leibes und fruchtbar, nahm vom Waldgrund helle Waffen auf und hielt sie, in dem heißen Lichte einem feurigen Schwerte gleichend, dem Herrn des Landes dienstbar und wehrhaft entgegen: lächelnde, junge Krieger und Zeuger, Erhalter des Lebens, herrliche Söhne, Brüder und Väter in einem.
Aus dem Lächeln und dem Bilde wuchs der neue Entschluss: die Söhne seines Landes schon als Knaben für sein Heer zu erwählen. Die Stunde der Söldnermilizen hatte geschlagen.
In unermesslicher Fülle stiegen die Söhne dem Vater aus den Seen seiner Wälder entgegen, griffen die Waffe und grüßten ihn und waren von den Sommerfluten überströmt, als sei eine Taufe geschehen.
* * *
An diesem Abend war Johannisnacht, und es war ein Abend von ungewöhnlicher Helligkeit, grünlichblau war der Himmel, zart und ohne Gewölk, obwohl in den späten Stunden des Tages ein heißer, heftiger Sturm dahingefegt war. Noch nach der Abendtafel schien die Sonne auf den Schreibtisch des Königs. Die Wipfel jenseits der Havel vor seinen Fenstern lagen noch völlig im Licht.
König Friedrich Wilhelm war diesmal nicht zur Tabagie gegangen. Von seinem Ausritt heimgekehrt, ging er sogleich an die Arbeit. Der neue Plan für die Armee war schon zu lebendig in ihm. Er entwarf, berechnete und schrieb nieder:
„Wer von Gott einen gesunden und starken Körper empfangen hat, der ist ohne alle Frage nach seiner natürlichen Geburt und des Höchsten Gottes eigener Ordnung und Befehl mit Gut und Blut schuldig und verpflichtet, zum Schutz des Vaterlandes einzutreten, sobald der Kriegsherr es befiehlt.“
Den Regimentern wurden Kantone für die Rekrutierung zugeteilt, möglichst jedem Junkeroffizier sein eigener Gutsbezirk, dessen Leute er kannte.
„Durch das Kantonsystem“, verhieß der Landesvater und Kriegsherr, „wird die Armee unsterblich gemacht, indem sie eine stets fließende Quelle erhält, aus der sie sich immer wieder zu erneuern vermag.“
Vom neunzehnten bis zum einundvierzigsten Jahr war die Mannschaft seines Landes nun der Aushebung unterworfen; er hob sie als Soldaten aus, aber er war zugleich gewillt, sie gerade dadurch zu echten Bürgern seines Reiches zu erziehen, indem sie nun alle zum ersten Male Landesdienst leisten lernten.
Aus den Bürgerhäusern, die er begründete, von den Bauernhöfen, die er anlegte, sollten ihm Preußens Krieger kommen; und von den Adelsschlössern, die er entschuldete, seine Offiziere.
Und nun wendete er sich in seiner Schrift an seinen Sohn: „Dann wird er den Vorteil haben, dass der ganze Adel von Jugend auf in seinem Dienst erzogen wird und keinen Herrn kennt als Gott und den König von Preußen. Wenn Ihr lauter Offiziere habt aus Euren Landes Kindern, so seid versichert, dass das eine beständige Armee ist und dass Ihr beständige, brave Offiziere an ihnen haben werdet. Heute hat das noch kein Potentat.“
Die Knaben seines Landes wollte er von frühe an als seine Rekruten, als seine tapferen kleinen Söhne bezeichnen. Ein rotes Tüchlein sollten sie, sobald sie nur in seine neuen Schulen kamen, um den Hals geschlungen tragen; und das würde heißen: Dazu kommt einmal der blaue Rock.
Wenn sie die achtzehn Jahre hatten, wollte er sie rufen zur Wehr-Pflicht, alle, die „von Gott einen gesunden und starken Körper empfingen“. Er würde sie bei seiner alten Mustertruppe durch seine besten Offiziere exerzieren, drei Monate im Jahr: April, Mai und Juni; der Junker als Offizier würde die Burschen seines Dorfes kommandieren. Als Soldaten ohne Fehl und Tadel wollte der König sie dann wieder heimsenden, ein Büschel am Hut, das als ein Nachweis galt: In den Garnisonen Seiner Majestät trägt jeder der Unsren den Helm.
Wo aber nur ein Sohn in Hof und Haus war, gehörte er dem leiblichen Vater mehr als ihm; und der Landesvater gab ihn von vornherein frei; frei auch alle Kolonistensöhne, bis ein neues preußisches Geschlecht aus ihren Kindern geworden war; frei endlich auch die Söhne des Pfarrerstandes. Um die Diener Gottes war ihm immer ein Geheimnis trotz all ihrer Menschlichkeit – trotz all ihrer Feindseligkeit gegen ihn selbst.
Der Manufakturist Friedrich Wilhelm von Hohenzollern würde wieder eifrig exportieren müssen, um Kost und Löhnung für das Heer der Landessöhne des Königs von Preußen aufzubringen.
Der Pächter Friedrich Wilhelm von Hohenzollern würde wieder eine gewaltige Leistungssteigerung aller seiner Ländereien durchsetzen müssen. Schon gab er den Auftrag, Vorwerke für die Anlage von Mustergütern aufzukaufen.
Durch Umlagen und Steuern das neue Beginnen zu finanzieren, davor hatte der Generaldirektor Preußens einen heftigen Abscheu. Denn Steuern empfand er als trügerische Einnahmen, weil das Land nicht dabei „florierte“. Wo aber Steuer unumgänglich war, Verbrauchsakzise auf alle Luxusartikel zum Beispiel, belegte er in allererster Linie den Hof des Königs von Preußen mit hohen Abgaben. Kein königlicher Wirtschaftswagen, der nicht am Tore halten musste, um sich durchsuchen zu lassen.
Wieder setzte der Herr im Anfang seines neuen Werkes alle Schwierigkeiten, die entstehen konnten, groß und deutlich in die kühnen Pläne ein. Aber gelangen sie, so würde er als erster Landesherr eine allgemeine Wehr-Pflicht seines Volkes haben. „Heute hat das noch kein Potentat“, vermerkte er für den Sohn.
Mit einem hatte König Friedrich Wilhelm nicht gerechnet: mit einer Erleichterung und Bestätigung, die er niemals zu erhoffen wagte. Er war allein auf Widerstand gefasst, denn er wusste: Seine Korporale hatten keinen guten Ruf, und der Garnisonsdienst war hart.
Aber nun war es anders gekommen, und das Unerwartete geschah durch die Bauern. Seit er Frondienst, Leibeigenschaft und Prügelstrafe von ihnen zu nehmen und sie zu Herren und Erben ihrer Höfe zu machen suchte, war es, als könnten sie sich trotz aller strengen Kontrolle doch nur Gutes vom Bauernkönig versprechen, auch wenn er ihnen jetzt zum ersten Male nur als der Soldatenkönig entgegentrat. Es hob wohl ihren Stolz vor all den hohen Herren, dass sie, ihrer Knechtschaft entronnen, nun auch noch statt der armen Bauernzipfelmütze den hohen, blanken Helm der Grenadiere tragen sollten und dass sie statt zerrissener Kittel des Königs Rock anlegen durften wie die Junkersöhne. Und ihre Welt war nicht mehr nur das Dorf, in dem man vor dem nächsten Lehnsdienst gezittert hatte, sondern sie zogen in die neuen Städte des Königs hinaus und dienten ihm, dem Obersten, selber mit Junkern und einstigen Lehnsherren.
Der König war glücklich. Schon kehrten die ersten mit dem Büschel am Hut vom Wehrdienst in ihr altes Dorf zurück. Schon war die zweite Gruppe in Montur. Schon weigerten sich die Jungen mit dem roten Tüchlein um den Hals, sich von den Schulmeistern schlagen zu lassen; sie unterstünden allein ihrem König. So weit war der Stolz schon gediehen, und tatsächlich musste der König mit einer öffentlichen Erklärung hervortreten, die gewisse Gepflogenheiten in den Schulen vorerst doch noch sanktionierte; denn ein sechsundsechzigjähriger Lehrer hatte sich von einem Offizier erbitten müssen, Soldat werden zu können, um wenigstens als Soldat die „Soldaten“ verprügeln zu dürfen.
Sehr glücklich war der Herr; am glücklichsten in jener Stunde tiefer Ruhe, wenn er am Sonntagmorgen mit seiner Familie, dem Hofe und der Garnison in seiner neuen, lichten Kirche der Kanzel gegenübersaß und droben auf dem Chor die „Kinder der Seligkeit“, die Waisenknaben in den kleinen Soldatenröcken sangen, die Grenadiere ihre Hände über ihrem abgenommenen Helm gefaltet hatten und auf den Kirchenbänken überall die Burschen Hüte mit dem bunten Büschel auf den Knien hielten. In solchen Stunden wollte er am liebsten alle um sich sehen, die mit seinem Lande gediehen. Wenn er aus der Kirche trat, so sollten alle da sein, denen es gut erging im Umkreis seiner neuen Stadt. Mit Pferd und Wagen sollten sie kommen, ihren Herrn zu grüßen und Umfahrt vor ihm zu halten: Umfahrt auf dem einstigen Sumpf, der nun zur schönen Königsstadt geworden war. Denn der Text der heutigen Predigt war gewesen: „Siehe, ich habe auch in diesem Stück dich angesehen, dass ich die Stadt nicht umkehre, von der du geredet hast.“
Die ersten Häuser auf dem zugeschütteten und pfahldurchrammten Grund des Faulen Sees hatte der König noch abreißen lassen müssen; und wie in einem schweren Gerichte, das über ihn verhängt war, blieb ihm auch nicht erspart, den Abbruch der fast vollendeten Soldatenkirche anzuordnen! Dreimal ganz von neuem hatte der Herr das Werk in Angriff genommen; die Kirche hielt vom zweiten Mal an stand.
Aber nun gaben die jungen Bäume zweier breiter Alleen schon sanften Schatten. Reinlich, freundlich, festlich umrahmte ein Viereck von wohlhabenden Häusern mit edlen Giebeln und vornehmen Treppen und blanken Laternen die blühende Plantage; Obelisken mit den Emblemen und Insignien des Königs schmückten den Platz.
In den Kreisen von Monbijou und auch im Landadel, der des Lebens einer Residenz so lange entbehrte, nicht minder im so rasch emporgekommenen Bürgertum der Manufakturisten und Beamten, löste die Aufforderung des Königs zu sonntäglicher Auffahrt vor der Kirche und im neuen Stadtteil die höchsten Hoffnungen, Genugtuung und Beifall aus. Ah, endlich entsannen sich nun Majestät der Verpflichtungen eines Hofes; endlich sollte es in der neuen Residenz ein wenig gesellschaftliches Leben geben. So hatte es also seine Bedeutung, dass der Herr, nachdem er streng verbot, adlige Wappen an den Gutsgrenzen wie obrigkeitliche Insignien anzubringen, ausdrücklich wünschte, dass diese Wappen nun an Häusern, Brücken und Patronatskutschen zu finden wären. Dem Herrn war es das Zeichen eines Friedensschlusses gewesen.
Man war nun geradezu darauf bedacht, dem einsichtig gewordenen Herrn etwas wie eine Freude zu bereiten, und die Stoffe für die neuen Toiletten zu dem Korso – so nannte man die Auffahrt von vornherein – wurden überwiegend in den Königlichen Manufakturen bestellt. Der Adel hatte sich auch durchaus abgefunden, dass er die Anwesenheit der neuen bürgerlichen Stände würde dulden müssen. Gewiss, es war ein Schatten; aber Glanz blieb Glanz; zum ersten Male unter der Herrschaft dieses Königs brach er in Preußen ein.
Die Auffahrt selbst überstieg dann alle Erwartungen. Der König hatte die kostbarsten Pferde des Marstalls und die besten Wagen seiner Remisen für Familie und Gefolge herausgegeben; die Grenadiere bildeten ein schimmerndes und blitzendes Spalier; die Völker Potsdams, jauchzend und in allen Sprachen rufend, drängten heran; Kinder liefen vor dem Korso her, grüne Zweige schwenkend und Lieder anstimmend, als sei er ein Festzug. Die Karosse der Königin gab die Richtung an. Es schien tatsächlich etwas wie ein Zeremoniell entworfen zu sein.
König Friedrich Wilhelm hatte vor dem Kirchportal seinen Schimmel bestiegen. Am Turme nahm die Fahrt ihren Anfang. Langsam rückten die offenen Kaleschen und die reichgezierten geschlossenen Kutschen um den Kirchplatz an, dann rollten sie die breite, neue Straße am schattigen Kanal entlang. Aus Hollands Backsteinhäusern winkten alle die, denen Pferd und Kutsche noch nicht zu Gebote standen. Auf den Treppen zu den Kähnen, selbst in den Wipfeln einiger alter Linden am Ufer, hockten kleine Jungen und große Burschen und hielten das dichte Laub mit allen Kräften auseinander. Vom Kanal her führte die Umfahrt um den neuen Wilhelmsplatz, über den vergessenen Grund des Faulen Sees, und wieder die Allee an dem Kanal zurück noch einmal am König vorüber. Der saß noch immer am Kirchtor zu Pferde und winkte und grüßte jeder Karosse und jeder Equipage, Kalesche und Kutsche zu. Der König hatte auch eine Feldmusik bestellt und nahm sich gar das Recht des Kaisers, zu den Trommeln und Pfeifen noch mit Trompeten blasen zu lassen. Man fand ganz allgemein, dass Rex auch liebenswürdig sein könne.
Dann freilich schlug die gute Meinung unverhältnismäßig rasch um; denn bei der zweiten Runde schloss sich in straußenfederbedeckter Equipage, in überladener Kammerherrnrobe der Freiherr Präsident von Gundling an, schon am Morgen trunken – vom König geduldet, damit er aller Hoffart eine Warnung sei.
Und das Allerunbegreiflichste stellte sich jetzt erst heraus: Bäuerliche Kastenwagen, Gemüsekarren und Leiterwagen mit schweren Ackergäulen davor, alle, denen es im Umkreis seiner neuen Stadt nur irgend gut ging, hatte der König zur Sonntagsauffahrt gerufen. Da ließ sich nun der Bauer und Gärtner und Kärrner nicht mehr vertreiben; da polterten nun die Karren der Landleute hinter den Staatskarossen all der Herren und Damen von Stand hinterdrein, und der Korso war diesen zum Fastnachtszug entwürdigt. Ein großes Glück, dass Ihre Majestät an der Spitze des Zuges noch nichts davon erfuhr und begriff!
Kein Bauer, kein Fischer, kein Müller, der nicht vom König am Kirchtor gegrüßt worden wäre und das Lächeln des Königs sich nicht zugewandt wusste.
Nun kamen sie auch von den anderen Kirchen her, denn es war der Wunsch und das Gebet des Königs, dass Gott in Potsdam in allen Zungen und jedem Glauben der Erde zu der gleichen Stunde angebetet werde. Auch in den anderen Kirchen war die Feier des Sonntagsgottesdienstes vorüber. Der Dominikanerpater, welcher für die katholischen Grenadiere des Königs Italienisch und Madjarisch, Französisch und Spanisch, Portugiesisch und Polnisch hatte lernen müssen, führte aus der neuen Kirche Marienkinder und Musketiere heran, die ihre Rosenkränze in den Händen hielten. Die französisch-reformierte Gemeinde der Refugies und Hugenotten, würdig in ihren langen, dunklen Röcken, den schönen Pelzmützen und Hauben und reichen Spitzenkragen, schritt gemessen einher; und jeder hatte noch die frommen und fleißigen Hände gefaltet. Der Pope, dem für die Moskowiter, dem Geschenk der Zarin Katharina an den Preußenkönig, eine griechisch-orthodoxe Kapelle am Langen Stall erbaut worden war, wies mit Stolz auf seinen frommen Chor. Den hatte ihm der König erst ganz kürzlich aus Moskau bestellt. Die zwanzig türkischen Riesen des Herzogs von Kurland beteten und sangen indes noch in einem Saal, der nahe bei dem Gotteshause der Soldaten lag und dessen Fenster nach Osten hin offenstanden, ihr Allah il Allah! Denn der König hatte sie freundlich gefragt, ob ihnen nicht der preußische Sonntagmorgen für ihren osmanischen Freitag gelten könne; es liege ihm sehr viel daran.
Das Geläut der Türme – an zwei Kirchen hingen die Glocken noch in einem überkupferten Holzgerüst, weil die frisch aufgeschüttete Erde die steinernen Türme noch nicht zu tragen vermochte – wollte nicht enden; und nun sang auch das neue Glockenspiel der Soldatenkirche den Choral der vollen Mittagsstunde. Der König hatte es getreu den geliebten Erinnerungen seiner holländischen Jugendreisen gießen lassen, als sei der dunkle, ernste Ruf der schweren Glocken nicht genug zu Gottes Lob in der Mark Brandenburg, als müsse auch ein lichter, himmlischer Glockengesang über seine Völkerstadt hinschweben.
Aller Augen waren auf das Glockenwerk im Turm gerichtet, bis der übermäßige Widerschein der Sonne in der goldenen Wetterfahne sie blendete. Ein Geflirr von Gold war um den bronzenen Adler des Königs, der zu einer strahlenreichen Sonne strebte, als frommes Hoheitsabzeichen des Königs von Preußen auf dem Turme des Soldatengotteshauses. Bald sollten es auch seine Regimenter, seine Ämter alle führen. Das Wort der Heiligen Schrift, das zu dem Hoheitszeichen gehörte, wusste nur König Friedrich Wilhelm selbst; darüber hat er sich mit keinem beredet: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler.“ Denn der stolze Sinnspruch, den er vor der Welt ausgab, genügte ihm nicht. „Non soli cedit – Er weicht der Sonne nicht.“ Immer brauchte er das Wort des Glaubens.
Auch war kein Städtegründer vor Gottes dunklen, alten Domen zu hellen, neuen Kirchen geflüchtet, so wie der Preußenkönig einst aus Brandenburg gewichen war. Und keiner wartete wie er „auf eine Stadt, die einen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist“.
Alles war ihm Gleichnis und Verkündigung; auch die Umfahrt, die sie Korso nannten, war nur Zeugnis: „Es stehet herrlich und prächtig vor Ihm und gehet gewaltig und fröhlich zu an Seinem Ort. Bringet her dem Herrn, ihr Völker, bringet her dem Herrn Ehre und Macht!“
Zum letzten Mal für diesen Sonntagmorgen hatten die Karren und Karossen den König umkreist. Nun hielt die Kalesche Ihrer Majestät dicht vor ihm. Er trat an den Schlag und sprach einige Worte mit ihr, er tat viel freundliche Fragen. Die Königin fand es sehr heiß.
Der Herr ging auch zum Wagen der Kinder, hob seinen Hulla heraus, küsste und streichelte ihn und setzte ihn als Reiter aufs vorderste Kutschpferd, was den zarten Kleinen etwas ängstlich machte.
Inzwischen war man allenthalben ausgestiegen. Kronprinz Friedrich, von der Mutter lächelnd beachtet, hielt im Schatten drüben Cercle mit den neuen Gesandten. Der Freiherr Präsident von Gundling, als prüfe er nochmals das Glockenspiel, sah blinzelnd zu der Kirchenwetterfahne auf, zu dem Adler, der sich in die Sonne aufschwang.