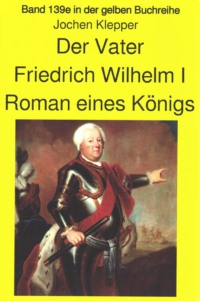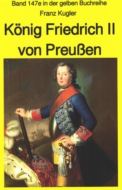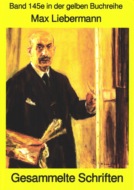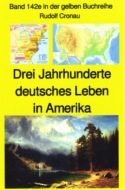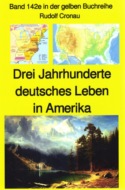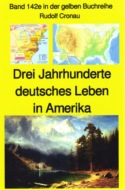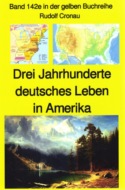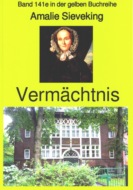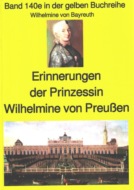Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 6
Einer der Fremden, wie sie zahlreich von Berlin herübergekommen waren, wies unauffällig auf den Kronprinzen, den er nicht kannte, und fragte den Freiherrn von Gundling, weil er ihm am nächsten stand, sehr leise, wer dies wohl sei.
„Die aufgehende Sonne des Brandenburgischen Hauses“, sagte Gundling, denn er blinzelte noch immer in all das glockenumsungene, goldene Flirren über dem Turm, auf den Adler und das reiche Strahlenbündel der Sonne. Und erst als der Fragende ihn höflich an seinen Irrtum gemahnte und bemerkte, er habe den jungen Herrn dort gemeint, den ernsten, schmalen, vornehmen Knaben, erklärte Gundling verbindlich, indem er seinen Staubmantel um Brust und Schultern drapierte wie für ein Pesnesches Gemälde:
„Ah, wer dies ist, mein Herr? Der Neffe des Königs von England!“
* * *
König Ragotins Schloss
König Ragotins Schloss
Einem König hilft nicht seine große Macht;
ein Riese wird nicht errettet durch seine große Kraft.
Die Bibel
Der König hatte eine Stadt in Preußisch-Litauen Brandenburg genannt.
Der König taufte eine Stadt der Neumark Königsberg.
Auch solche Namensgebung war ein Bild; oder eine Brücke zwischen seinem Königreich Preußen vor den Grenzen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und seiner reichsständischen Kurmark Brandenburg. Sie sollten alle, auch in solcher Namensgebung, schon die künftige Nation begreifen.
Potsdam gedachte der Herr, freilich nur manchmal und heimlich, nach sich selber Wilhelmsstadt zu nennen. Aber dann verwies er es sich immer wieder selbst; solcher Name könne seiner Stadt niemals von ihm, sondern nur durch die anderen Menschen verliehen werden.
Fragte nun aber ein Reisender, der vom Süden des Landes her auf die Hauptstadt zufuhr, aus dem Verschlag seiner Kutsche heraus den Bauern am Feldrain, welches Dorf dort an der Kiefernwaldung um das alte Schlösschen liege, so erhielt er die Antwort: „Königs Wusterhausen.“

Und das war ein neuer Name. Nur war sich niemand dessen bewusst.
Wunderlicher als der Herr auf Wusterhausen hat wohl nie ein König Hof gehalten. Ein Saal mit Pfeilern, die Geweihe und jagdliche Embleme trugen; eine Tabakstube, die zugleich als Speisezimmer der Familie diente; zwei Räume für die Königin; ein paar enge Kammern für die viel zu vielen Gäste; ein schmales Gelass mit einem großen steinernen Waschtrog für ihn selbst genügten dem König. Da gab es keine Hallen, Emporen und breiten Aufgänge; Turm und Wendeltreppe und im Nebenbau eine große Küche – das war alles. Höchstens waren noch die sauberen, langgestreckten Häuser für die siebzehn Pikeure, Leibjäger, Büchsenspanner und Jägerburschen des Königs neben den Ställen der Bären, Adler, Pferde und Hunde nennenswert.
Aber nun war doch immerhin bei dem Jagdschloss und dem Dorf, bei den Bärenzwingern und Adlerkäfigen des Königs, nahe an der Brücke zum Schloss eine von den neuen Kirchen des Königs erstanden. Und wie hier und in den Garnisonskirchen zu Potsdam und Berlin der Gottesdienst gehalten wurde, so sollte er im ganzen Lande sein. Vornehmlich in der Wusterhausener Kirche aber ließ sich der Herr um die Jagdzeit Probepredigten von Kandidaten halten.
Nun war wieder Jagdzeit, und auf Wusterhausen drängten sich die Offiziere und Minister und Gesandten, wimmelte es von allem, was jagdfroh war oder vor dem König doch so scheinen wollte; die vielen Räte aber waren da, in den Pausen weidmännischen Lebens mit König Friedrich Wilhelm zu arbeiten. Die Herren aus dem Ausland, die erstmalig auf dem Jagdkastell Herrn Friedrich Wilhelms weilten, befremdete es sehr, als die mit dem preußischen Hofe Vertrauteren sie darauf aufmerksam machten, dass demnächst die Pastoren auf das Jagdschloss kommen würden, alles sich dann nur noch um die Pastoren drehe und auch der an Rang und Würden am höchsten gestellte Gast dieses Schlosses alle nur erdenkliche Rücksicht auf die Pastoren nehmen müsse. Selbst Minister suchten oft Fürsprache durch Geistliche. Und auf allen seinen Reisen richte der Herr es so ein, dass er vom Sonnabend zum Sonntag in einem Pfarrhaus nächtigen könne.
Meist lächelten die Fremden ungläubig. Man hatte wohl von großen Kardinälen im alten London und Paris genug erfahren – aber ein lutherischer Hungerpastor bei Hofe?!
* * *
Es kam nun doch nur ein Pastor aus Halle, ein Herr Johann Anastasius Freylinghausen, des verstorbenen großen August Hermann Francke Schwiegersohn. Beide waren sie nicht abkömmlich, die Verwalter der Franckeschen Stiftungen, die Regenten des geistlichen Jugendstaates; des Professors Francke Sohn konnte erst in vierzehn Tagen folgen. Pastor Freylinghausen hatte nur noch einen kleinen Kandidaten bei sich; der bewachte ihm die Bücherstöße auf dem Wagensitz.
König Friedrich Wilhelm war um die Zeit der Ankunft des Hallenser Gastes vom ersten Jagen heimgekehrt, schon gegen halb zwölf Uhr des Mittags. Er saß mit den Generalen auf den Bänken unter den Linden im Schlosshof. Der Kastellan hatte Anweisung, den Hallenser geistlichen Herrn sofort zum König zu führen. Lebhaft ging der König auf ihn zu, nahm den Hut ab, geleitete ihn zur Bank, setzte sich und klopfte ein paarmal mit der flachen Hand auf die Bank. Der Pastor nahm das nun als einen Wink, neben dem König Platz zu nehmen. Die Generale gaben ihm erschreckte Zeichen. Es war mit dem Chef nicht so leicht. Ganz bestimmte Formen, ja recht deutliche Distanzen wollte er gewahrt sehen, auch wenn auf jedes Zeremoniell von ihm verzichtet wurde. Die Generale zwinkerten dem Pastor zu, er solle sich zu ihnen auf die Bank, dem König gegenüber, setzen. In Preußen suchten sich die Generale neuerdings mit den Pastoren gut zu stellen. Selbst der Küchenmeister auf Wusterhausen gedachte sich fromme Küchenjungen vom Pastor Freylinghausen vermitteln zu lassen.
Alles, aber auch alles wollte der König von dem Pastor wissen. Seine Lebhaftigkeit, namentlich sobald er fragte, war ungeheuer.

Franckesche Stiftung in Halle
Er kalkulierte sofort und ziemlich richtig den Etat der Franckeschen Stiftungen. Er ließ sich beraten, wie man die wöchentliche Ausgabe frischer Wäsche und Kleidung an die Waisenkinder, ein Novum, pünktlich und gleichmäßig durchzuführen vermöchte. Er wünschte, sobald der Gast sein Gepäck geordnet haben würde, die neuen Gesangbuchausgaben zu sehen, ob er sie wohl für die Armee verwenden könne. Zweimal musste man den Herrn darauf aufmerksam machen, dass im Zelte schon serviert worden sei. Wo Gelegenheit und Witterung es nur erlaubten, wollte der König im Freien speisen. Türkische Tücher, zwischen den Ästen zweier alter Linden aufgespannt, wehrten der Sonnenglut. Das reine, glatte Leinen der Tafel atmete Kühle. Der schmale, lange, dichtbesetzte Tisch war ländlich gedeckt, mit Zinngeschirr und Krügen.
Der Platz der Königin erstrahlte wieder von Silber. Frau Sophie Dorothea, ganz entzückend liebenswürdig gestimmt, bat den Geistlichen an ihre Seite. Sie war von ihren Kindern umgeben. Sie sprach sogleich von religiöser Erziehung. Denn die Königinschwester von England, wie Gundling Frau Sophie Dorothea nannte, verhielt sich selbstverständlich gemäß der Religionspolitik des welfischen Hauses und trat somit als imposante Beschützerin des Protestantismus auf. Und damit schien sie noch immer einen tiefen Eindruck auf den Gatten zu machen. Es war vielleicht die letzte Täuschung, die sie ihm gewährte. Der Rest eines ehelichen Glücks lag allein noch in diesem einen Irrtum, dem verhängnisvollsten, beschlossen.
Der Hallenser Pastor hatte vor der großen Fürstin nicht die Sicherheit eines Roloff; der stand unter all seinen Amtsbrüdern wohl einzig da; aber Freylinghausen vergab sich doch nichts. Etwas von der weltgewandten Art des alten Francke hatte sich auch den Erben mitgeteilt.
Auch ein holländischer Schiffskapitän war zu Gaste. Prinz August Wilhelm sprach das Tischgebet. Ein Vorgericht aus Fisch und jungen Erbsen wurde aufgetragen. Der König erklärte, wenn er keine Vorkost äße, so wäre ihm, als hätte er nicht recht gegessen. Das Gespräch nahm eine überaus sanguinische Richtung; von der Königin wurde es mit Eifer ausgesponnen. Die feine Zunge des Gatten nämlich war das einzige, was sie an ihm bewunderte; hierin paradierte sie sehr gern mit ihm; einmal war er ohne Frage allen überlegen! Bei Reb- und Haselhühnern vermochte der König sogar genau die Herkunft anzugeben, ob sie in der Mark, in Litauen, in Pommern oder im Cleveschen geschossen wurden. Da gab es viele Wetten mit Grumbkow, dem berühmtesten Gourmet am Hofe. Ein Bruch mit allem Feinschmeckerbrauch lag beim Herrn nur in der brüsken Ablehnung alles Hautgouts beim Wild vor. Da empörte sich sein Sauberkeitsgefühl; seine Neigung für das Frische, Klare trat hervor. Als etwas barbarisch galt auch seine Vorliebe für rohes Obst.
Der Kronprinz bediente die ganze Tafel mit Vorschneiden; dies schien etwas zu sein, das ein künftiger König lernen musste. Der Kronprinz war dabei ganz still und redete kein einziges Wort; er gedachte strikt die Rangordnung zu wahren und dem Pastor und dem Schiffskapitän zuletzt vorzulegen. Aber der König winkte ihm, dass er dem Gast aus Halle sogleich etwas reichen solle; es geschah auch sofort.
Der arme Pastor Freylinghausen hatte vor regem Befragtwerden nicht viel Zeit, zu essen. Unter anderem fing der König an: „Stille, ihr Herren!“ – abends vermerkte der Pastor im Tagebuch: „Ohnerachtet niemand redete“ – und stieß die Königin, die ihm schon lange wegen der Gründung eines Theaters in Ohren lag, heimlich an, indes er sagte: „Nun, Herr Freylinghausen, Er soll uns sagen, ob's recht sei, in Komödien zu gehen –.“ Worauf eine große Stille war. Und wer den König auch nur einigermaßen kannte, wusste: jeden Tag jetzt, wenn er von der Jagd zur Tafel kommt, wird König Friedrich Wilhelm eine solche Frage an den fremden Pastor tun. Ob es Sünde ist, zu jagen? Ob es Sünde ist, zu rauchen und zu trinken? Ob der lebendige Gott auch den Soldatenstand segnet, in dem es doch schließlich und immer wieder zum Vergießen von Menschenblut kommt? Ob ein Herrscher denn überhaupt selig werden kann? Ob nicht Sünden fürstlicher Personen von Tausenden von Menschen nachgeahmt und missbraucht werden, so dass ein großer Herr niemals sündigt, ohne sündigen zu machen und also ein Lehrer der Sünde wird? Ob Verwerfung und Erwählung ist ohne alles menschliche Zutun und als freier Ratschluss Gottes?
Dann aber, wenn die eine Frage ausgesprochen wäre, die Frage nach Verwerfung und Erwählung, würde der Pastor noch so viele Tage an dem langen Tisch im Gartenzelt erscheinen müssen, bis König Friedrich Wilhelm fast gar nichts mehr redete, auch nicht mehr jagte, sondern nach der Tafel rasch sein Pferd bestellte und schweigend durch die Stoppelfelder ritt, dem Pagen und dem Reitknecht weit voran – viele Stunden ritt, „um zu Gotte zu beten“.
* * *
Ob es Sünde ist, zu jagen –?
Der Pastor wurde von dem Hifthornschall im Hof geweckt.
Der sich am ersten vor der Turmtreppe zeigte, war König Friedrich Wilhelm selbst, ohne Orden und Band, im grünen Rode, den Hirschfänger am Gürtel. Der König, so zeitig es noch war, musste schon lange aufgestanden sein; seit drei Uhr hatte er am Schreibtisch gearbeitet, danach den Rundgang durch die Wirtschaftsgebäude, die Ställe, die Küche gehalten und sich bereits zum zweiten Mal gewaschen. Aber so blank auch sein Gesicht gerieben war – an der Frische dieses vierzigjährigen Mannes kamen einem Zweifel. Zu dunkle Schatten setzten sich um seine Augen ab, das runde, volle Gesicht wirkte durch die tiefen Falten, die seltsam rasch auftraten und sich erst sehr allmählich wieder glätteten, beinahe verfallen. Keine Behendigkeit, keine Lebhaftigkeit, keine Straffheit der Haltung, keine Munterkeit des Tones täuschten darüber hinweg. Vor allem aber machte die Art seines Betens zu viel Scheu und Ernst und Bangigkeit offenbar.
Denn er betete auch am Morgen der Parforcejagd auf dem Hofe seines Jagdschlosses, indes die Adler vom Zaren ihre Kugeln an den Ketten über die Steinpflasterung schleppten und die Bären in den Winkeln bei den Ställen tappten und schnappten. Er betete, kaum dass die Jagdgäste und seine Pikeure und Leibjäger ihn mit Gruß und Gegengruß umscharten; er sprach das Vaterunser vor; er stimmte den Morgenchoral an. Und es war seltsam, wie hell und voll er sang, er, der doch leise, heiser, schnarrend sprach; halb hochmütig, halb scheu. Nun, als der König aufsaß und vom Pferde herab sprach, war wieder nur das Herrische, ein wenig Näselnde in seiner Stimme. Und gar nichts als die Meute an den Riemen schien ihn etwas anzugehen. Die Pikeure in ihren roten Röcken, grünen Westen und gelben Lederhosen mussten jeder einzeln seine Koppel vor ihn führen. Der König tadelte: „Der kleine Paron haseliert wie sein Papa.“ Jeden seiner hundert Hunde kannte er mit Namen, Herkunft, Vorzug, Unart. Über Verfilgo, Pimpone, Petro, Presson, Petz, die Lieblinge, wurden ganze Korrespondenzen mit dem Fürsten von Anhalt-Dessau geführt; als Hundezüchter war ihm der Dessauer überlegen; wie hätte König Friedrich Wilhelm sich nicht von ihm raten lassen.
Grognonne, die Bärin, konnte es nicht leiden, wenn Pimpone und Petro, die liebsten unter den Lieblingen, den Herrn so unbändig umkläfften. Eifersüchtig und bedrohlich wiegte sie heran, und der Herr auf seinem Schimmel musste sie zärtlich mit der Reitgerte im zottigen Nackenfall krauen. Das war meist der Abschied. Dann fasste König Friedrich Wilhelm seine Zügel kurz, die Waldhornisten setzten das Horn an, und die Herren stoben davon, über die Brücke, durchs Dorf, an den Stoppelfeldern entlang auf den Wald zu. Es war auch heute noch ein prächtiger Anblick, obwohl der König die Kosten einer Jagd schon bei Regierungsantritt von zweihundert Talern auf sechs Taler herabgesetzt hatte.
Noch immer glaubten Jagdherr und Jäger von Wusterhausen, nun endlich diesen Herbst den Großen Hans, den Wunderhaften weißen Hirsch, den herrlichen, kühnen, noch vor dem Hubertustag zu erlegen. Nicht alle ritten gleich vom Schlosshof aus; denn unter den Gästen befanden sich auch ein paar alte Generale, mit denen es seit den großen Kriegen nicht mehr recht werden wollte; für die hielt Majestät die offenen, leichten „Wurstwagen“. Meilenweit ließ er sie bis zum Rendezvousplatz bringen; dort erst bestiegen sie die Pferde, was sie sich in keinem Falle rauben lassen wollten.
Im letzten dieser kleinen Jagdwagen befand sich bei den alten Herren auch der Kronprinz. Erst hatte er sich wegen leichter Krankheit ganz für die heutige Hatz entschuldigen lassen; dann, als der Vater ihn kurz nach sechs Uhr nochmals fragen ließ, erklärte er sich bereit, wenigstens doch mit hinauszufahren. Die Unruhe der alten Herren, den Reitern nur nicht gar zu langsam nachzukommen, teilte die junge Hoheit nicht. Königliche Hoheit beteiligten sich überhaupt nicht am Gespräch; und schwellender Hörnerklang, nahendes Rüdengebell belebten den überschlanken Prinzen nur wenig. Wie es gehen würde, wusste er im Voraus. Sechs Stunden kam man nicht aus Wald und Sumpf, bis dem Vater endlich der Bruch auf silbernem Tablett gereicht wurde. Allein im Walde kannte er ja ein Zeremoniell. Heute Parforcejagd, übermorgen Parforcejagd, am nächsten Tage wieder Parforcejagd! verlangte dieses Zeremoniell; und die Parforcejagd war das einzige, was an diesem Hofe von Frankreich übernommen wurde. Dann waren aber jedes Mal auch noch stundenlang die Reden des Königs „über die gesunde Motion und was für eine Erfrischung die ganze Natur dabei empfinde“ zu ertragen. Nur sonderbar, wieso Papa dann meist so erschöpft von der Jagd kam, dass er sich legen musste und erst am Abend wieder in der Tabagie erschien, durch neuen Anzug, neues Waschen und Frisieren weidmännische Frische vortäuschend –.
Den Prinzen, wie er da im Jagdwagen dahinfuhr, schauerte vor übergangener Müdigkeit, vor den kühlen Nebeln des Septembermorgens und dem Stumpfsinn seiner Begleiter. Kaum dass er mit im Jagen war, suchte er sich zu entfernen, blieb zurück und trachtete danach, ein Gebüsch zwischen sich und die Pikeure des Vaters zu bringen. Und als die Sonne hoch am Waldrand stand und aller Nebel nur noch Tau im Farnkraut war, hielt er allein entzückte Rast. Das Gebell der Hunde war unendlich fern; die Rufe der Jäger waren nicht mehr vernehmbar; der Waldhornklang verhallte nur als zartes Echo. Ein herber Duft stieg aus den Moosen auf, die sich der Sonne zu öffnen begannen. Unablässig wuchs das warme, sanfte Licht im Wald. Und was sich die spähenden Jäger vergeblich ersehnten, das wurde dem fliehenden Prinzen zuteil: Herrlich, leicht und ruhevoll schritt der weiße Hirsch an ihm vorüber; aus der Tiefe dunkler Kiefernwälder trat er in die Lichtung, mächtig und leuchtend, die braunen, glänzenden Augen voller Milde. Da lehnte der Prinz unhörbar leise die Flinte an die Birke vor ihm und zog seine Flöte aus dem Jagdrock. Er war nicht mehr der Knabe, der einmal sprach: „Trommeln ist mir nützlicher!“ Duhan, der Hugenotte, hatte ihn die Worte eines kleinen französischen Verses gelehrt, die Flöte sei im Anfang allen Musizierens gewesen und halb sei sie noch wie Gesang. Der Atem der Seele lebe in der Flöte. Der Mund sei an das Holz eines edlen Baumes gedrückt, und aus dem Hauch und Kuss erklinge noch einmal aller Vogelsang, der einst in seinen Wipfeln erscholl.
Am Anfang aller Kriegsmusik war die Trommel, rufend zur Eroberung der Erde; am Anfang aller Festmusik die Flöte, lockend zur Verklärung der Welt. So sagte der Vers. Der Prinz setzte die Flöte zu hellem Hirtenliede an die Lippen: zum Lobgesang an Pan, zur Hymne an Diana. Und alle Götter des Olympes und der sieben heiligen Hügel Roms begannen ihr herbstliches Fest in den Wäldern der Mark.
„Dir war der Weiße Hans beschieden, und du hast es verpasst.“ Der Vater hatte Friedrich gefunden. Er sagte es erstaunt und enttäuscht. Und auf einmal riss er ihm die Flöte zornig weg; was die wohl solle auf der Jagd; ob dies das Londoner Jagdzeremoniell sei; und außerdem habe er nun ihnen allen mit seinem verdammten Gepfeife den Weißen Hans verscheucht.
Der Hirsch, getrieben und gehetzt und gereizt, fiel an der Schneise einen Metzger, der zum Dorfe ging, gefährlich an. Der Metzger stach ihn mit dem Fleischermesser ab. Darin sahen alle ein sehr schlimmes Zeichen – und dies noch mehr als eine Schande – und kehrten recht verärgert von der Jagd zurück. Der König schien sogar bedrückt.
An diesem Spätnachmittag kam noch sehr viel Sammelpost aus Berlin. Die Ramen und Ewersmann liefen auf dem Flur vor den Zimmern des Königspaares nur so hin und her. Die Königin hatte ganz entzückende Briefe aus England. Wo sie des Gatten nur ansichtig wurde, stürzte sie, die Billetts in der leicht erhobenen Rechten, auf ihn zu. Er bat um Vertagung der Lektüre; und etwas verstimmt, etwas geistesabwesend, aber in seinen Worten nicht unfreundlich, ersuchte er die Gattin, ihn vorerst mit dem soeben eingetroffenen Arbeitsmaterial allein zu lassen. Sophie Dorothea nahm es diesmal spöttisch auf; wenn seine Manufakturaufträge und Zollrollen wirklich wichtiger waren als ihre hochpolitischen Manifeste... Etwas Ähnliches sagte sie ihm sogar. Er blickte fast ein wenig müde zu ihr hin, nahm ihr die Briefe ab und überflog sie: gespreizte, bombastische, inhaltlose Episteln der hinterbliebenen Mätressen des Herrn Schwiegervaters über die Stimmung am Londoner Hofe in Sachen der preußischen Heirat; Zettel, wie er sie nun schon zum zehnten Mal vor Augen bekam. Nein, so entschied es sich nicht, ob über das kranke Europa der müde Traum der österreichisch-spanischen Universalmonarchie noch einmal kommen sollte oder eine neue Zeit sich ankündigte, in welcher „der gute Kampf der Reformation“ sich unkriegerisch und herrlich vollendete, indem die alte Weltmacht Englands aufs friedlichste sich verband mit den nördlichsten Fürsten des Reichs, das Reich zu erretten, als es am schwersten bedroht war!
Längst war der König an den politischen Fähigkeiten der Gattin irre geworden. Ihre eigentümliche Neigung zum Mittelbaren, Vieldeutigen, Ungreifbaren schien ihm mehr und mehr hervorzutreten. Aber gerade dies Ungreifbare, Doppelsinnige, Nebensächliche hielt die Königin für die einzig echte Diplomatie, durch die sie die plumpe Geradheit des Gatten einigermaßen auszugleichen imstande war. Ihren Sohn hatte sie davon völlig überzeugt.
„Beenden Sie lieber Ihre gegenwärtige Handarbeit, statt dass Sie solchen Flikflak einer Antwort würdigen!“
Derart schroff hatte König Friedrich Wilhelm noch nie mit seiner Frau gesprochen. Brüsk verließ sie sein Zimmer und beriet sich sofort mit ihren beiden großen Kindern, was nun zu geschehen habe, um den für ganz Europa so bedeutsamen Moment über der Kurzsichtigkeit und Engstirnigkeit ihres Gatten und Vaters nicht zu versäumen.
Der König griff sofort zu den eigenen Briefschaften. Dies hier, dies war eine Bestätigung, dass alle englischen Pläne bald zum Scheitern kommen würden, so blühend und sinnvoll sie schienen. Als Landwirt war er nun ein armer Mann geworden. Man würde sich nicht mehr um seine wachsende Armee bewerben, denn nun würde er wohl noch zum Schuldenmacher werden.
Ach, dass die Könige wie die Bauern mit ihrem ganzen Glück und Wohl von Hagelschlag, Dürre und Wolkenbruch so hilflos abhängig waren!
Ach, unheilvolles Jahr, in dem die Kastanien und Apfelbäume zur Frucht noch einmal Blüten tragen mussten: herrliches Bild und entsetzliche Wirrnis in einem! Droben im Osten aber waren gar vom Winter an die Jahreszeiten in Aufruhr! Und seine Kolonisten hatten mit der fremden Erde keine Geduld, sie gingen mit seinen Unterstützungsgeldern davon, verkauften, was er ihnen schenkte, und all seine Gründungen blieben sinnloses Stückwerk. Die Nachrichten waren furchtbar. Er musste hinauf, ganz gegen den festen Dreijahresplan seiner Reisen; in diesem Jahre musste er noch einmal hinauf nach dem Osten! Fürs erste aber hieß es morgen nach Berlin zu gehen, eine geheime Sitzung des Generaldirektoriums einzuberufen.
Er gab bei weitem noch nicht den vollen Einblick in alles, was er schon wusste; er suchte sich vorerst nur die hervorragendsten Sachkenner als Begleiter aus; und den anderen, die indes in Berlin die Geschäfte zu führen hatten, befahl er ruhig und strikt, indem er es unter dem Eindruck dieser schweren Stunde bereits grundsätzlich festlegte: „Wenn Kalamitäten im Lande sind wie zum Exempel dieses Jahr in Preußen, soll solches cachiert werden. Es soll zwar Seiner Majestät jederzeit die reine Wahrheit berichtet werden, aber in der Stadt und sonst in der Welt soll es jederzeit gering gemacht und gesagt werden, dass es Bagatelle; dass alles schon redressieret; solches macht nichts und tut Seiner Königlichen Majestät nichts; dieselbe haben Geld Millionen; und sollen die Sachen niemals schlimm, sondern allemal groß und nichts gefährlich gemacht werden.“
Aber die Sachen standen schlimm, und die Lage war gefährlich; doch was ihn am tiefsten bewegte, besprach der Herr viel weniger mit seinen Ministern in Berlin als mit seinem Gast auf Wusterhausen, dem Pastor.
Wie er es besonders liebte, hatte er sich mit seinem Gesprächspartner in eine tiefe Fensternische des Hirschsaals allein zurückgezogen; die Ecksitze der Pfeiler schienen zum Gespräch auch einzuladen. Bei der Unterredung blickte König Friedrich Wilhelm bald hinaus, bald fasste er sein Gegenüber prüfend und fragend ins Auge. Die Eindringlichkeit seines Sinnens, Redens und Hörens war manchem schon ungeheuerlich erschienen.
Vor dem Fenster blühten hohe Sonnenblumen. Auf den Bauernhäusern jenseits des Grabens und über den Lindenwipfeln lag noch die dunstige Sonne des späten Nachmittags; unter den Bäumen aber war schon frühe Dämmerung und Kühle. Die Fenster waren weit geöffnet, und der König schien hinaus ins Freie zu sprechen. Er wollte, Freylinghausen möge auch noch nach Berlin fahren, um die beiden Kinder zu sehen, die sich vorerst nicht mit auf Wusterhausen befanden, die kleine, übermütige Sanssouci, Philippine Charlotte, und seine brave, vernünftige, ernste Sophie Dorothea Maria. Der König fragte auch sehr angelegentlich nach den Pastorenkindern. Aber das spürte der Geistliche deutlich: Im Augenblicke trug der Herr zu schwere Sorge um das Geschick der Königskinder, als dass er völlig Anteil nehmen konnte an dem Leben, Wohl und Wehe fremder Kleiner. Denn es könnte sein, sprach der König, dass ein hartes Schicksal seine Kinder ereile, dem sie nicht gewachsen seien, weil er sie nicht recht erzogen habe; weil Gouverneure und Gouvernanten seine Stelle verträten und endlich einem König seine Kinder immer ferne blieben. Gewiss, man mühe sich mit ihnen in Instruktion, Examen und Erzieherwahl; man suche sie auch nach Möglichkeit wenigstens einmal des Tages zur Tafel um seinen Tisch zu versammeln. Aber die vornehmsten Pflichten eines Hausvaters blieben von einem König unerfüllt; und es sei in nichts ersichtlich und in gar nichts habe man es in der Hand, ob die Kinder nun auch Gottes Kinder würden oder zu Kindern des Teufels missrieten. Auf das Bürschlein Hulla setze er nun freilich viel. Aber für manche seiner Kinder verwette er nichts mehr.
Manche seiner Kinder, sagte König Friedrich Wilhelm. Und dann ließ er den Kronprinzen rufen; den Kronprinzen, die Erzieher, die Generale. Etwas für alle Beteiligten Seltsames geschah; auch für den Pastor war es peinlich: Er sollte den Kronprinzen von Preußen examinieren, ob ihn der Glaube recht gelehrt worden sei. Freylinghausen, der das Leibeswohl und Seelenheil zweitausend junger Menschen betreute, schien dem König der Berufene dafür zu sein.
Sie lenkten alle ab: die Generale, der Pastor. Kronprinz Friedrich wurde totenblass. Der König blieb fest. Auf die ersten Fragen schwieg der Prinz. Dann aber begann er plötzlich sehr lebhaft zu reden, die heiligen Worte in ihrem geheimnisvollen Widerspiel wie advokatische Spitzfindigkeiten drehend und wendend, aber niemals als der Christusleugner greifbar. Der Vater aber wusste genug. Er nickte vor sich hin. Dies war die Bestätigung.
Während der Glaubensprüfung aber hielt der Herr ein Neues Testament in Händen. Das hatte er noch vom alten Professor Francke selbst bekommen und wollte es brauchen, solange er lebte; darin war sehr viel unterstrichen.
Ein Neues Testament befand sich in der Bibliothek des Sohnes nicht.
Tags zuvor, in Berlin, hatten sie dem König nach der geheimen, bitter ernsten Sitzung des Generaldirektoriums die heimliche Bibliothek seines Sohnes gezeigt. Ein Generalfiskal, einer der Späher, war zum König gekommen, ihm zu melden, dass an einer Stelle der Hofhaltung ein erheblicher Aufwand getrieben werde, ohne dass Deckung im Etat vorhanden oder der Posten auch nur vorgesehen sei. Der Generalfiskal kam vom Präsidenten der Generalrechenkammer. Creutz war es von der Ramen zugesteckt. Die Ramen aber wusste alles, aber auch alles von der Königin selbst.
So kannte nun also der König die Bücher des Sohnes. So wusste nun also der König, dass der Kronprinz Schulden machte. So hatte nun der Vater einen Blick in jene fremde Welt getan, in der Preußen und die Mark Brandenburg nur klägliche Sandwüsten und Kieferngehölze waren und ihre Domänen, Amtshäuser, Kasernen und Kirchen nicht verzeichnet wurden.
Er bemühte weder Schiedsrichter noch Kassenbeamte; er holte auch nicht einmal Friedrichs Gouverneure. Er ließ den Sohn nur mit dem Pastor diskutieren. Darin allein offenbarte sich dem König alles. Aber wie der König da auf den Pastor sah und horchte, spürte Gundling, dass der Herr die fromme Antwort und glaubensgewisse Erläuterung nicht für den Sohn, sondern am meisten für sich selbst begehrte –.
Er hatte die Hände in die Seiten gestemmt, blickte den Geistlichen beständig an; war ungemein aufmerksam und still. Und als der Pastor seine Reden endete, saß der Herr noch immer sinnend da.
Alle verließen den Hirschsaal recht betreten. Welches Ungeschick von Majestät! Der König folgte erst allmählich nach. Von dem Sohne sagte er gar nichts. Im Gange draußen fasste er den Prediger am Ärmel. „Weil übermorgen Sonntag ist – Er wird mir doch auch unvorbereitet predigen? Es wird die letzte Predigt sein vor einer unerwarteten und schweren Reise, Herr Freylinghausen. Mit der neuen Woche muss ich fort. Mein Land erregt mir Leid und Grauen.“
Der Pastor sagte ehrerbietig zu. Dem König schien es nicht genug; er setzte noch zu neuer Frage an. Aber als sie ausgesprochen war, stockte er und erschrak.
Die Frage war: „Glaubt Er –, dass ich selber predigen könnte?“
Dann stammelte er etwas davon, dass Könige zu predigen wissen müssten; denn ihre Taten seien nichts. Gott streiche sie durch; und eben dies, dies müssten Könige bekennen. Und als beginne er nun solche Königspredigt, sprach er wieder die Worte der Schrift wie die eigenen Gedanken des bedrängten Augenblickes aus: „Herr, du hast mich überredet, und ich habe mich überreden lassen; du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen; aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich, und jedermann verlacht mich.“
Als der Fürst von Anhalt-Dessau den ersten Satz im ersten Schreiben von der Reise seines königlichen Freundes las, wusste er, dass so nur ein Hilferuf anhob: „Euer Liebden sein so ein kluger und Penetranter Herr als einer mit in Europa ...“
Drei und vier und endlich sieben Briefe kamen von der Reise. Aber niemand als der Dessauer erhielt ein Schreiben. Er, der Gutsherr von Bubainen und Norkütten, wusste als einziger, dass diese Königsfahrt ein Kreuzesweg durch nicht enden wollende Stationen des Leides wurde: durch Brand und Dürre, Wolkenbrüche und Sturmflut, vernichtete Ernten, sterbende Herden, Aufruhr, Widerspenstigkeit, Raub und Verzweiflung. Ach, für Elenjagden und Kampfspiele zwischen Wisenten und Bären, die sie sich beide droben im Osten erhofften, war keine Zeit und kein Recht mehr. „Mehr Wölfe als Schafe“, schrieb der König vom Ostland. Am bedrückendsten aber schien dem Fürsten, dass seinen königlichen Freund das einzelne schon nicht mehr berührte. –