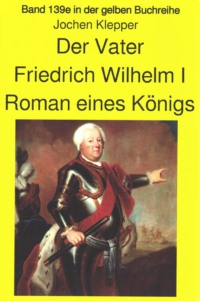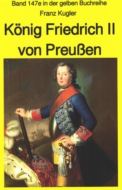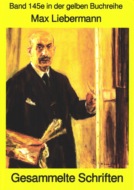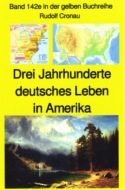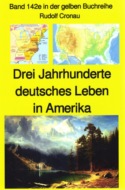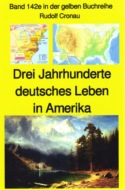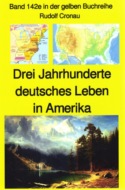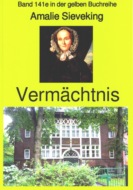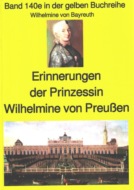Kitabı oku: «Jochen Kleppers Roman "Der Vater" über den Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I - Teil 2», sayfa 4

Der König zergliederte bereits die Einzelheiten des Lehrplans; er setzte bereits die bestimmtesten Posten im neuen Schuletat ein. Zwei Dreier die Woche, das mussten die Eltern wohl noch zahlen können. Wenn sie es ganz und gar nicht erübrigen konnten, dann schien es nun nicht zu viel verlangt, wenn man ein Ortsalmosen für die Armenkinder forderte.
Der König überschaute auch schon alle Schwierigkeiten, die aus dem Mangel an Lehrern und Gebäuden erwachsen sollten. Die Theologiestudenten sollten als erste einspringen und erst nach ein paar Jahren Schuldienst ins Pfarramt gelangen. Von den alten Schulmeistern mochten die kärglich besoldeten, bis eine Aufbesserung ihrer Bezüge möglich wurde, getrost ein Handwerk üben, das auf ihrem Dorfe gerade dringend fehlte. Grund und Boden für die neuen Schulen, ja, die Küchengärten für die Schulmeister, gedachte der König selbst zu schenken; die Baumaterialien auch; die Fuhren stellte er ebenfalls. Rasch sollte alles geschehen. Und umfassend sollte es sein. „Der Adel“, schloss der Herr, „wird sich hiernach zu richten haben und zur gemeinschaftlichen Einrichtung der Schulen die Hand bieten.“
Dass nun eine allgemeine Schul-Pflicht ausgesprochen war, genügte dem Herrscher noch nicht. Die größeren Kinder sollten, ehe sie zur Firmung und Konfirmation gingen, noch einmal einen besonderen geistlichen Unterricht erhalten.
Fünfzigtausend Taler, die wollte er als ersten Fonds für die Schulen zur Verfügung stellen. Die gedachte er gleich flüssig zu machen und aufs Neue zu sparen. Dann mochten sich die neuen Schulen mit den Kindern seines Landes füllen. Morgen wollte er die Anweisung auf fünfzigtausend Taler unterschreiben.
Er hatte für den Fonds einen Namen bereit, noch von den armen, trügerischen Zeiten seines Vaters her. Diesem Namen – Mons pietatis, Berg der Frömmigkeit – gab er nun Inhalt, Sinn und Wert und verschwieg gerade durch ihn seine fromme Scheu.
Was galt es ihm, dass schon sechs Millionen Taler droben im Ostland angelegt waren; dass elf Städte, feste Sitze des Handels und Handwerks, und dreihundertzweiunddreißig Dörfer wieder aufgebaut, verwahrloste Domänenämter in staatliche Bewirtschaftung genommen waren? Was machte er groß damit her, dass die Widerstände, die Ausflüchte, die Vorspiegelungen seiner Junker und Beamten sich von Jahr zu Jahr verringerten, wenn auch oft aus Resignation gegenüber seinem Machtanspruch?
„Dieses ist nichts“, sprach der Stifter der Schulen, „denn die Regierung will das arme Land in der Barbarei behalten. Doch wenn ich baue und verbessere das Land und mache keine Christen, so hilft mir alles nichts.“
Er kam ins Ostland als der letzte Ordensritter. Er wollte den Gottesstaat in der Öde, die ihm als Reich des Bettelkönigs übergeben war. Nun sollten in dem dunklen Land besonnte Berge mit blühenden Hängen aufstehen –.
„Was seht ihr scheel, ihr großen Gebirge, auf den Berg, da Gott Lust hat zu wohnen? Der Herr bleibt immer daselbst.“
Der Prediger sagte es dem Herrn zum Abschied.
Über den Worten des Psalms kam dem König die Nacht.
Er wusste nicht, als er an diesem Tag die Augen schloss, dass er nun für jegliches Kind seines Landes einen Erziehungsplan entworfen hatte, der jener hundertfach durchdachten Instruktion für seinen Ältesten nicht nachstand und im Letzten und Entscheidenden kein geringeres Ziel hatte, als einen frommen König und fromme Untertanen füreinander zu schaffen. Er sorgte nicht mehr nur für seine Erde. Der Mons pietatis erhob sich im Land.
* * *
Seit Wochen und Monden predigte die Königin: England.
Es war nicht die Geschwätzigkeit einer lebhaften Frau. Es war mehr, war leidenschaftlicher und tiefer. Vielleicht war es die dauernde Überwältigung durch allen Glanz dieser Welt, die zu jedem Augenblick bei ihr den schillerndsten Ausdruck fand. Vielleicht war es auch eine ständige Beschwingtheit, mit der sie kaum wahrnehmbare Anfänge sofort zu märchenhafter Vollendung auszuspinnen vermochte. Und das erfolgte nun in der Sprache kühner, kühler Politik. Es geschah mit dem Schein des Kalküls. Das ließ die Königin so glaubhaft erscheinen. Logische Beweisführungen, taktische Winkelzüge mussten ihr dazu dienen, die Maßlosigkeit und Unerfüllbarkeit ihrer Wünsche zu verhüllen. Sie beherrschte das gesamte Vokabularium der Kabinette; sie dichtete in der Geheimsprache der Diplomatie. Dies war ihr Lebensinhalt; dies verlieh ihr das Gefühl der Größe; dies schuf ihr damals gerade auch den Ruf einer zu Höchstem befähigten und berufenen Fürstin.
Sie prüfte sich nie. Sie lernte und sie überlegte und sie wägte nicht. Ihr flog alles zu, um, von dem Überschwang ihrer Lebensbegeisterung gewaltig entfacht, zu irdischer Prophetie in ihrem Munde zu werden. Freilich, das Leben begann ihr erst von den Stufen der Throne an lebenswert oder auch nur beachtungswürdig zu werden. Nie hätte sie nach der Erde gefragt, die, nur durch eine dünne Schicht aus edlem Holz und teurem Stein vom Sockel der Throne getrennt, allein und endlich auch die Throne selber trug.
Rieb sie, wie es ihre Gewohnheit war, im Gespräch mit sehr Vertrauten ganz unbewusst die Handflächen rasch und leicht aneinander, so war es wie die Geste eines frohen, ungeduldigen und erwartungsvollen Kindes, das einer überwältigenden Überraschung schon völlig gewiss ist. Einen Augenblick danach aber saß sie dem gleichen Partner ihrer Unterhaltung – hoheitsvoll in ihren Sessel gelehnt, die Arme majestätisch auf die goldenen Lehnen aufgelegt – wie der Premierminister aller Premierminister gegenüber; und was sie redete, schien Weltgeschichte.
Nicht selten kam es nun vor, dass dann der König vor ihr stand, den Kopf ein wenig gesenkt: und recht still. Manchmal zog er sich auch eines ihrer Taburetts heran und saß schweigend vor ihr, den Blick zu ihr erhoben: ein Abgehetzter, Erschöpfter, Staunender. Was war, so fragte er sich dann, sein zäher Fleiß vor solcher Spannkraft; was war sein mühsames Zusammentragen angesichts solchen Weitblickes? Vielleicht waren die Welfen die größeren Herrscher –.
Auch diesen Irrtum hat die Königin ihm gegeben. Wie sollten nicht auch ihre Kinder sich in ihr täuschen.
Sahen sie, was nur in Potsdam geschah, ihren Vater schon am Morgen, so kam er eilig in der düsteren Uniform aus seinen Zimmern gestürzt, schien übernächtig, hatte schon wieder einen Riesenberg verdrießlichster, kleinlichster Arbeit hinter sich, jagte auf den Exerzierplatz hinaus, entschuldigte sich auf dem langen Gang vor seinen Zimmern bei dem wartenden Kabinettsrat: was war er, als ein armer, abgearbeiteter Beamter, als ein kleiner, dienstbeflissener Offizier, dem sein harter, hoher Chef nicht eine Atempause gönnte und dem er obendrein noch schlechten Sold gab?
So erschien den Kindern der Papa; denn die Türen, die er in der Eile offenstehen ließ, gaben dem Blick die Kahlheit und die Kärglichkeit getünchter Kammern mit gestrichenen Kiefern- und Fichtenholzmöbeln in dem harten Lichte unverhüllter, aufgerissener Fenster frei.
Aber die Morgen der Mutter, namentlich wenn man in Monbijou wohnte, waren voller Feier und Verklärung, gelassen und königlich, milde und stolz. Umblüht und vogelumsungen, von Wasserspielen umsprüht, lag Monbijou in langer Morgenstille. Die Sonne stand schon hoch am Himmel über dem Fluss, doch in den Sälen, Galerien und Nischen der Königin blieben noch immer all die gemalten, reich gestickten, golddurchwirkten, üppig sich bauschenden Vorhänge zugezogen, und der neue Tag wehte nur wie ein Golddunst durch die bunten Räume. Ein Engel, glänzenden, tief dunklen Haares und ganz in weißem Batist – mit ein wenig billiger Spitze –, schwebte die Ramen durch die ganze Flucht, silberne Kannen mit Rosenwasser und Gurkenmilch für das Lever und mit Schokolade für das Dejeuner der Herrin hoch über sich haltend. Dann erst, nachdem sie noch lange im Boudoir der Königin weilte, tat die Kammerfrau die Flügeltür auf, und lächelnd, von Spitzen, Locken, Perlenketten umflossen, trat die Mama von den Stufen des straußenfederngekrönten Prunkbettes. Die Vorsäle hatten sich mit ihren Damen gefüllt; in einem Rauschen von Brokat sanken sie alle in tiefe Verneigung; und über das Raunen und Neigen und Grüßen hinweg rief, ihre Hand der Welt entgegenstreckend, die Welfin: „Sind Briefe aus England?“
Selbst die kleinsten Prinzessinnen erschauerten selig, sie wussten: Dies war das Glück, der Glanz, das Fest ohne Ende, wenn Post aus England eingetroffen war. Wie anders konnten die Briefe in dieses sommerliche Schloss am Fluss gelangen, als auf möwenflinken Seglern übers Meer, auf weißen, jagenden Seglern und den geschwindesten, feurigsten Schimmeln der Welt!
Durch den Tross der Damen bahnte sich der junge Prinz den Weg, schnell einmal dem öden Unterricht drüben im großen Schlosse entwischt. Er eilte auf die Mutter zu und umarmte sie; aber sie empfand es anders als die formlose Art des Gemahls; am Sohne war es graziös und bestrickend, war Einfall und heitere Laune. Die Königin zog den Kronprinzen an sich; ihre Ringe leuchteten aus seinem Haar. Er war ihr die aufgehende Sonne, der Anbruch strahlenderen Lebens, der Träger ihrer Träume. Post aus England war nun zwar nicht eingetroffen, aber in dem ganzen Morgen war ein Überschwang so ohnegleichen. Das Pensum, das der König dem Thronfolger verordnet hatte, blieb unerledigt.
Ihre Majestät bestellte die Kronprinzenerzieher zu sich. Sie handelten, so sagte sie, im höchsten Interesse des Königs, wenn sie den Prinzen etwas mehr den von ihr selbst vorgeschlagenen Beschäftigungen und Betätigungen überließen. England verspreche sich von ihrem Sohn –.
Ach, England versprach sich von dem Kronprinzen von Preußen nur das Schönste: Flötenmusik, Cembalospiel, Violinkadenzen, Gartenkomödien, hymnische Poeme, erhabene Zitate... Die Welt war dem Prinzen von Klängen und Versen durchrauscht.
Fragt einen jungen Prinzen mit übergroßen, schwärmerischen blauen Augen, wo er wohl das Königliche dieser Erde zu erblicken vermag – bei dem gehetzten Mann im simplen blauen Rock oder bei der lächelnden, ruhenden, feiernden, ewig die Glorie verheißenden, in Juwelen strahlenden, Weltgeschichte kündenden, von machtvollen Hoffnungen hingerissenen Frau, die den Knaben in den Mittelpunkt des Erdballs stellt!
Der König spürte, dass er seinen Sohn an die Sallets à la grecque der Gemahlin verlor.
* * *
Die Furcht vor ‚Dem König von Preußen‘, der die Generationen des Geschlechtes überdauerte und dessen Knecht er lediglich war, teilte Friedrich Wilhelm I. auch seinem ältesten Sohn mit, der dem gleichen Schicksal, wie er selbst es trug, entgegenwuchs. Die Furcht vor jenem unbekannten Herrn verband ihn mit dem Sohn wohl am tiefsten; er wollte Friedrich wappnen gegen solche Forderung und Härte. Aber die eigene Strenge gegen den Sohn, die daraus folgte, stieß seinen Ältesten von ihm. Der Vater war der ewig Warnende, der unablässig Fordernde, Gebietende; die Mutter begegnete ihm als die tagtäglich Schenkende, Lockende, Verheißende. Der Vater vereidigte seinen Ältesten auf die Instruktion eines preußischen Militärs und Beamten; die Mutter steckte ihm den schönen Roman zu, der von der Großen Welt der Könige erzählte.
Sie ahnte nicht, dass diese ihre Große Welt dem lesenden Knaben gar bald sehr eng werden würde und dass neue Gefilde sich vor ihm eröffneten, von deren Weite sie nicht eine ferne Ahnung hatte. Die Mutter gelobte ihm ein glanzvolles Königreich, wo der Vater ihm nur sandverwehte Äcker zu hinterlassen versprach. Der Sohn aber begründete sich selbst eine Welt. Er hatte vor dem stetig Fordernden die Flucht in die Bücher gelernt.
Vom Vater kamen nur Verbote, die schlechthin alles betrafen, was nicht unmittelbar der Vorbereitung auf das Amt des Königs von Preußen zu dienen imstande war.

Jacques Égide Duhan de Jandun – 1685 – 1746
Die drei Erzieher, die beiden Preußenoffiziere und Duhan, der Refugie, Männer von reicher Bildung und ungewöhnlicher Redlichkeit, Kriegsveteranen und Glaubensmärtyrer, konnten die Pläne des Vaters nicht völlig billigem und die Absichten der Mutter nicht gänzlich verurteilen. Sie wollten ihr Amt nach dem Geist und nicht nach dem Buchstaben erfüllen. Wo nun die beiden Offiziere solchen Konflikt mit der wörtlichen Instruktion des Königs spürten, schreckten sie freilich immer wieder vor der freien Auslegung des Textes zurück. Duhan, der Emigrant, den der König schon in den Laufgräben von Stralsund zum Lehrer des Sohnes erkor, wurde eigentlich aus Zutrauen zur oft erfahrenen Güte des Königs allmählich der heimliche Verbündete des Kronprinzen gegen den Vater. Er hoffte auf wachsende Einsicht sowohl beim Herrscher wie beim Thronfolger. Wozu gab der König schließlich seinem Sohn so gebildete Männer zur Seite? Schon existierte als ihrer beider verborgen gehaltenes Werk eine regelrechte Bibliothek, in fremdem Hause, dreitausend Bände des Englischen, Französischen, Spanischen, Italienischen umfassend. Lehrer und Schüler arbeiteten mit Hingabe an dem Katalog. Kein Buch, das nicht von Friedrichs eigener Hand verzeichnet worden wäre, mit gleicher Inbrunst, wie ein Creutz die Zahlen eintrug. Das Verzeichnis umschloss die Literatur der alten und der neuen Welt, des Himmels, der Erde und der Hölle, aber nur einen einzigen kurzen Abriss der brandenburgischen Geschichte in französischer Sprache.
In einem abgelegenen Hause zwischen der Königswohnung und den Räumen des Generaldirektoriums und Schloss Monbijou war ein neuer Kosmos erstanden. Vater und Mutter, beide lenkten sie den Sohn auf das Große; und in beider Munde war das Große zweierlei und sehr verschieden. Der Prinz, sehr schmal, sehr klug, sehr erregbar, glaubte sich dem wahrhaft Großen, das jenseits aller Deutungsmöglichkeiten und Unterschiede ist, auf beglückend naher Spur.
Vor Friedrichs jungem Geist entrollte sich ein ungeheurer Horizont, an dem Deutschland nur einen kleinen Platz einnahm und Brandenburg fast ganz verschwand. Sein Sinnen und Trachten war nur noch darauf gerichtet, die Vorbildung zu erlangen, um alle seine Bücher wirklich verstehen zu können. Der vom Vater eingeteilte Tag reichte nicht aus. Aber auch Friedrichs Nächte waren auf königliches Geheiß streng bewacht. Schliefen die Hüter, dann schlich sich der Prinz aus dem Bett; er warf sich einen der seidenen Schlafröcke über, wie die Mutter sie ihm schickte. Den Schein der Kerze suchte er ängstlich zu verbergen. Nirgends war Schutz als in der tiefen Wölbung des Kamins. Dort hockte dann der Knabe stundenlang mit seinem Buche.
In den flüchtigen Gesprächen des Tages meinte mitunter die älteste Schwester, das Wissen müsse ihm wohl über Nacht zugeflogen sein, von so viel Neuem war der Bruder jedes Mal erfüllt. Das also war aus dem geworden, der als kleiner Knabe, statt zu spielen, zu den Füßen ihres eigenen Lehrers hockte, wenn der unendlich dicke und weise La Croze ihr Unterricht gab –; La Croze, jene wandelnde Bibliothek, jenes Magazin der wissenschaftlichen Kuriositäten; La Croze, der aus dem Stegreif zwölf Verse Leibnizens in zwölf verschiedenen Sprachen zitierte, nachdem er sie ein einziges Mal hörte. Das waren die Zauberkunststücke gewesen, mit denen man Wilhelminens Brüderchen begeisterte –. Nun waren Himmel, Erde und Hölle von ihm durchstreift. Das ganze All lag vor den Königskindern offen, und der begeisterte Blick konnte ungehemmt schweifen. Die Wissbegier war weltumspannend, und eine ungeheure Belesenheit – denn Bände aus Friedrichs heimlicher Bibliothek fanden gar nicht so selten den Weg in Wilhelminens Appartement – gab den Geschwistern gar die Illusion, dass sie bald alles Wissenswerte wüssten. Sie lebten in einem geistigen Festrausch, wie er über die ganze gebildete Welt hereinzubrechen schien und wie die Erde ihn vielleicht auch nie mehr sehen sollte.
Ungeklärt blieb nur die nächstliegende Frage, wie das Loch im Kronprinzlichen Etat, verschuldet durch die Bücherkäufe, zugestopft oder auch nur verschleiert werden könne.
So ganz allgemein, wohl im Hinblick auf ihre Revenuen, hatte man zwar vor Mama ein ganz klein wenig von den finanziellen Sorgen angedeutet. Aber die Königin, so glänzend ihr Vermögen auch vom Gatten angelegt war, erklärte sich ganz außerstande, einzuspringen. Sie müsse doch Monbijou noch viel prächtiger ausgestalten. Es gebe ja sonst am Hofe keine einzige Stätte würdiger Repräsentation, wenn nun vielleicht viel häufiger als bisher Besuch aus England kommen würde. –
Durch die Kreise ihrer Damen machte Königin Sophie Dorothea bekannt, dass man in London den preußischen Thronfolger als eine aufgehende Sonne, das war das Modewort an den Höfen, betrachte. Niemand, der am Aufstieg ihres Sohnes tätigen Anteil nehme, werde je von England sein Lohn vorenthalten werden. „Je vous en ferai la cascade“, schloss die Königin mit dem zweiten Modewort und glaubte mit dieser allgemeinen Redensart, die lediglich Erörterungen verhieß, hinlängliche Garantien gegeben zu haben. Daraufhin begann man wirklich da und dort auf jene größere Zukunft Preußens zu spekulieren und bot dem Kronprinzen Geld an.
Noch ehe er sechzehn Jahre alt wurde und konfirmiert war, galt Kronprinz Friedrich als tief verschuldet, und Mama schien ganz entzückt davon, dass er sich nun einmal genau wie sie und ihr Vater und ihr Bruder durchaus nicht an beschränkte Verhältnisse gewöhnen konnte. Es war so nebensächlich, ob er Schulden hatte. Die englische Mitgift würde in diesem Falle einmal eine ganze Sturmflut für ein kleines, heißes Steinchen sein.
Der Prinz verzehrte sich im Lesen. Das nächste Buch und nicht die nächste Rechnung bedrängte ihn. Die Nächte in dem riesigen, zugigen Kamin taten das Ihre. Der Prinz war sehr krank.
Der König, der ihn um des unbewältigten Pensums willen von sich fernhielt, erkundigte sich erregt nach dem Gewichtsverlust. Er sandte ihm seinen englischen Koch und gab auch diesem noch genaueste Anweisungen. Mittags riet er eine Suppe von zwei Pfund Fleisch an, ein Frikassee oder Fisch und Braten. So auch abends. Er wartete gespannt auf die Wirkung seiner kräftigen Brühe.
Inzwischen, bis Meldung kam, bereitete er in einem Brief den Dessauer, den söhnereichen Vater, auf das vor, was er entsetzlich drohend nach dem Knabensterben seines Hauses vor sich sah: „Mein ältester Sohn ist sehr krank und wie eine Abzehrung, isset nits ich halte Ihn kaput wo es sich in kurtzen nit enderdt den ich so viell exempels habe. Sie können sich einbilden, wie mir zumute dazu ist. Ich will bis Montag abwarten; wo es dann nit besser wird, ein Konsilium aller Doctor halten; denn sie nit sagen könen, wo es ihm sitzet, und er so mager als ein Schatten wird, doch nit hustet. Also Gott sei anbefohlen, dem müssen wir uns alle unterwerfen. Aber indessen gehet es sehr hart, da ich soll itzo von die Früchte genießen, da er anfenget, raisonnabel zu werden, und müsste ihn in seiner Blüte einbüßen. Enfin, ist es Gottes Wille, der machet Alles recht; er hat es gegeben, er kann es nehmen, auch wiedergeben. Sein Will gescheh im Himmel als auf Erden. Ich wünsche Eurer Liebden von Herzen, dass Sie der liebe Gott möge vor alle Unglücke und solche Chagrin bewahren. Wenn die Kinder gesund sein, dann weiß man nit, dass man sie lieb hat ...“
Friedrichs Konfirmation konnte jedoch zum vorgesehenen Zeitpunkt stattfinden. Allerdings musste in letzter Zeit noch ein besonderer geistlicher Lehrer den Erziehern beigegeben werden. Die Glaubenslehre saß gar nicht recht fest. Vom Religionsunterricht hatte er laut Gouverneursgutachten seit acht Monaten nicht viel profitiert. Der Vater schrieb es der Krankheit zu. Er wusste nicht, dass sein Sohn die Nächte, die dem tiefen Knabenschlaf gehören sollten, zu vielen, vielen Stunden unter den Weisen der Antike und unter den Fackelträgern einer neuen Epoche der Vernunft verbrachte.
Die Mutter nahm von dem ganzen Ereignis nur wenig Notiz. Sie sah in ihrem großen Sohn nicht einen Konfirmanden. Das war ihr schlechterdings unmöglich. Sie vermochte in dem Kronprinzen von Preußen einzig und allein den aussichtsreichsten Bräutigam Europas zu erblicken. Um der englischen Besuche willen begann sie sich allmählich sogar auch für die Bauten des Gatten zu interessieren. Sie hoffte, einigen Einfluss nehmen zu können, damit ihre beiden ältesten Kinder und sie vielleicht in der neuen Residenz doch einen nicht gar zu unwürdigen Rahmen erhielten.
In allem war Potsdam das Bild: für Kampf und Wachstum des Landes, für Hoffnung und Verzicht, für Wille und Gebet des Königs.
Den ersten Ring von Mauern, den er um seine neue Stadt gezogen hatte – weit und fern, um ihm das Maß seines Glaubens zu geben –, hatte König Friedrich Wilhelm wieder niederlegen lassen. Die Menschen fragten sich, was es bedeute; wo wollte der König denn hin?! Im Süden, im Osten ragte die Stadt schon bis dicht an die Ufer der Havel; im Westen geboten die Wälder, für die Jagd und das Bauholz der Zukunft bestimmt, solchem Vordringen ein Halt; im Norden lag dicht vor der Mauer der träge Sumpf des Faulen Sees.
Sie bestürmten den König, die Wälder vorerst nicht weiter schlagen zu lassen. Der Herr sprach auch vernünftig und einsichtsvoll: „Diese Wälder müssen noch bleiben.“
Dann ritt er durch die Trümmer der zerschlagenen Mauer dicht an den Rand des Faulen Sees.
„Ich brauche undurchbrochenes Bauland“, sagte der Herr und deutete weit über den Sumpf hin. „Das ist tot, das ist faul, eine abgestorbene Bucht der großen Seen, die man zuschütten müsste. Dann könnte man bauen!“
Proteste und Eingaben häuften sich; wer sollte denn im Sumpfe wohnen?! Warnungen und Ratschläge gingen ein. In einer nahezu schon kühnen Weise wurde der Plan des Königs abgetan. Er aber wollte das Faule, das Träge, das Tote vernichten, und aus dem drohenden Sumpf sollte ihm der blühendste und schönste Teil der neuen Stadt erstehen: lichte, große, ja festliche Häuser denn zuvor in einer lieblichen Plantage. Nun durften wieder Gärten sein in Brandenburg. Nun forderte die Vollkommenheit des Bildes das erste, starke Blühen von dem todesschwangeren Grunde. Und solche Forderung stellte er, der die unzähligen Statuen von Sandstein in den Gärten seines Vaters verwittern und zerbröckeln und die Zierteiche verschilfen ließ; er, der für die Erhaltung der aus den Wipfeln geschnittenen Tore und Ehrenpforten nicht sorgte und nicht danach fragte, dass die prächtigen, für die Gartenwagen hoch aufgeschütteten Dammwege vergingen.
Aber nun erweckte es sogar den Anschein, als wolle der Herr sich endlich doch ein eigenes Lustschloss bauen. Den Bauplatz suchend, ritt er durch den Wald. Er ritt im Kreise quer über die vierzehn Alleen alten kurfürstlichen Jagdgrundes. Weit ging sein Blick in die Tiefe der Waldwege, haftete auf einer Eiche inmitten der Kiefern, suchte die leichtfüßige Flucht eines Rehes zu verfolgen und betrachtete den rauschenden Lauf eines Hirsches in Ästen und Laub mit wachsender Jagdlust. Der Herr zog den Kreis von Allee zu Allee immer enger und enger. Hier, wo sie alle sich kreuzten als ein Stern im tiefen Walde; hier, wo die Sonne aus den schwarzen Kiefernwipfeln brach, sollte das einzige Schlösschen stehen, das er sich als Heger und Weidmann zu gönnen gedachte.
Als es dastand, ein holländisches Häuschen mit einer Muschel im Giebel als einzigem Schmuck, meinten die, welche es besichtigen kamen, es sei die Bauhütte, und nun beginne der Schlossbau.
Aber nun bebaute der Herr schon den Sumpf. Er ließ den Saum der Wälder schlagen, die er durchritten hatte; und die Kiefern, eben erst zum Schlage reif geworden, wurden Pfahl um Pfahl in das Sumpfland gerammt, kaum dass in den tiefgezogenen Gräben das träge, stinkende Gewässer versickert war. Bis zum Dunkelwerden hatte der König dabeigestanden, wie sie die letzten Pfähle noch mit Weidenseilen aneinanderkoppelten, kreuz und quer und längs und breit. Schon fand der Blick eine ebene Fläche. Schon war ein sichtbarer Anfang.
Um die Morgendämmerung brachen in dem aufgewühlten Grunde unterirdische Strömungen hervor, hoben das Pfahlwerk brodelnd empor, zerweichten das Weidengeflecht und quollen in Blasen und kleinen Sturzbächen zur Oberfläche.
Früh, als die ersten Arbeiter kamen, sahen sie, wie sich die untersten Spitzen der Pfähle in langsamer und unaufhaltsam starker Drehung nach oben kehrten. Schreiend liefen sie vor die Fenster des Königs. Der sprang aus dem Bett und aufs Pferd, nicht einmal vollständig angekleidet. Er hielt nicht an, als er die wogenden und treibenden Pfähle erblickte; er stieg nicht ab, als er das dumpfe Poltern und unablässige Rauschen und Glucksen hörte; bis hinunter ans überschwemmte Ufer trabte er und ließ sich nicht rufen und halten, als gelte es einer verlorenen Schlacht im äußersten Wagnis die Wendung zu geben. Sein Reitknecht folgte ihm ängstlich. Plötzlich war es, als wollte der König ihn in jäher, harter Kehrtwendung zurückstoßen, als müsse er ihn vor einem Unheil bewahren. Da versanken sie beide. „Mein Pferd ist stark“, schrie der König, „rettet den Jungen!“ Mächtig arbeiteten die Pferde. Das des Reitknechts schluckte schwer am Schlamm und hielt nur noch den hoch emporgerissenen Kopf aus dem Sumpf. Der König hörte dicht an seiner Seite das Gurgeln, als das Lehmwasser über dem Reitknechtspferd zusammenschlug. Den Jungen zogen sie mühsam an Stangen heraus; den Schimmel des Königs, der sich schon zu festerem Grunde durchgestapft hatte, zerrten sie, zu vielen in den Sattel und die Riemen greifend, vorwärts. Den König hoben sie durchnässt und schlammbedeckt herab. Sie schickten Boten nach Wagen, Tüchern und Mantel. Der König war nur mit dem jungen Reitknecht befasst; er blickte gar niemand an, wich den besorgten Fragen aus und überhörte all das laute Preisen seiner Rettung. Sichtlich war etwas von Befangenheit in seinem ganzen Verhalten, spürbar selbst dann, als er sich abtrocknen ließ, den Mantel umnahm und den Wagen bestieg.
Zum Exerzieren erschien er wie immer. Bei Tische wurde übermäßig viel von dem Unglück und dem Unfall des Königs geredet; er selber war schweigsam. Den ganzen Tag über pilgerte man zu der Stätte des großen Begebnisses hinaus. Die Gegner des Königs oder zum mindesten seines Faulen-See-Projektes triumphierten. Creutz sah endlich wieder solchem Verschwenden ein Ende gesetzt. Beinahe fragte man den König gar nicht erst, wie er nun von der ganzen Sache denke. So sicher war man sich seines Verzichtes.
Die Woche ging mit den Aufräumungsarbeiten hin. Am nächsten Montag waren alle Bauarbeiter zur gewohnten Stunde wieder an den Faulen See bestellt. Auch der König erschien.
„Das Ganze von neuem beginnen“, sagte der Herr, und abermals verschwanden große Kiefernwaldungen als Pfahlroste für die neuen Häuser im Sumpf.
Gleichzeitig gab der König den Befehl, zur Rechten und Linken des Schlosses, an der Havel und an seinem neuen Kanal, eine Kirche zu errichten, als seien die Kirchen als die Grenzpfähle gedacht, mit denen er die Stadt abstach, und als wollte er dadurch die Menschen lehren, dass das, was er am Sumpf begann und auf sich nahm, nicht Trotz war, sondern Glaube.
* * *
Bald wurde das trübe Ereignis vom größeren Vorgang überschattet. Auf einer neuen Reise nach Hannover, in Osnabrück, war der König von England gestorben, im gleichen Zimmer, in dem er auch geboren worden war.
Es schien, als hätte sich nicht der Tod des englischen Herrschers ereignet, sondern als wäre der Preußenkönig selbst gestorben, derartige Veränderungen gingen um die Zeit des Todesfalls auf den Berliner Gesandtschaften vor sich. So ziemlich alle Gesandten außer dem kaiserlichen wurden abberufen; neue trafen ein und baten, baldmöglichst ihr Bestätigungsschreiben überreichen zu dürfen.
Die Königin in ihrer tiefen Trauer um den Vater hatte aufmerksam auf alles acht und fand es nun – gleichsam als einzigen Trost, den es zur Zeit für sie geben könne – ihrerseits für angebracht, wenn auch der König von Preußen zum mindesten sofort einen besonderen Beauftragten an ihren Bruder nach London entsendete.

König Georg II – Hannover – Großbritannien
Der König gedachte in diesen Tagen der Trauer seiner Gattin keinen Wunsch zu versagen und schrieb sehr höflich und sehr herzlich an den Vetter und Schwager, vergaß vor der Gemeinsamkeit des königlichen Amtes all ihres jugendlichen Zwistes und Knabenhasses von einst, bat um die Freundschaft des neuen Königs von England und erklärte sich an alle zwischen dem Verstorbenen und ihm getroffenen Abmachungen gebunden. Die Antwort traf sehr rasch ein, fiel hochfahrend und kühl aus und enthielt, wenn man sie in dürre Worte übersetzte, die Versicherung, dass der neue König von Britannien die alten Verträge gar nicht so ohne weiteres zu übernehmen gedenke. Dann in den obligaten, unverbindlichen Schlussformeln eines Fürstenbriefes lenkte er natürlich wieder ein.
Denn Brandenburg-Preußen begann ja nun ohne Frage eine Rolle zu spielen. Es war nicht mehr so, dass Preußen unter den alten Nationen noch das bunte Gemisch verstreuter Gebiete gewesen wäre, die sich vom Rhein bis zur Weichsel, von der Ostsee bis zu den böhmischen Bergen wirr und verzettelt hingezogen hatten. Es war nicht mehr so, dass man die kleine Truppe Brandenburgs für Sold zu eigenen Zwecken nach Bedarf pachten, hinhalten und entlassen konnte. Von eigenem, gutem Gelde hatte der König von Preußen sein Dreißigtausend-Mann-Heer schon verdoppelt. Und mit den Maßnahmen und Handlungen jedes seiner Tage strebte er aus dem furchtbaren Zwiespalt, Reichsstand und König eines freien Landes zu sein, suchte er mit aller Inbrunst und Gewalt sein Land im Reich und sein Land da draußen im Osten zur Einheit zu machen, ohne fremdes Recht auch nur von ferne anzutasten. Er war daran, ein Land der Stärke, des Wohlstands, der Ordnung mitten im Reich und im Herzen Europas zu begründen, indes das Reich zerfiel und das von Kriegen und Schwindelgeschäften erschöpfte Europa sich selber zu zerreißen drohte.
Man sah Preußens Tätigkeit, Beharrlichkeit und Mut an jedem Tage von neuem bewiesen und überschätzte darum dauernd seine Mittel. Wen nahm der große Diplomatenwechsel da wunder?