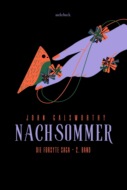Kitabı oku: «Zu vermieten», sayfa 3
Drittes Kapitel: In Robin Hill
Jolyon Forsyte hatte in Robin Hill den neunzehnten Geburtstag seines Jungen verlebt, war aber dabei ruhig seiner Beschäftigung nachgegangen. Er tat jetzt alles sehr ruhig, weil sein Herz angegriffen war und ihm, wie seiner ganzen Familie, der Gedanke an den Tod zuwider war. Er hatte sich nie klargemacht wie sehr, bis er eines Tages vor zwei Jahren gewisser Symptome wegen zum Arzt gegangen war und erfahren hatte:
»Jeden Augenblick, bei jeder Überanstrengung!«
Er hatte es mit einem Lächeln aufgenommen – bei einem Forsyte die natürliche Rückwirkung einer unangenehmen Wahrheit gegenüber. Allein, als die Symptome sich im Zuge auf dem Heimweg verschlimmerten, war er zu voller Klarheit über den Urteilsspruch gekommen, der über ihm schwebte. Irene verlassen, seinen Jungen, sein Haus, seine Arbeit – wenn er jetzt auch wenig genug arbeitete! Sie um eines unbekannten Dunkels willen verlassen, um eines so undenkbaren Zustands, eines solchen Nichts willen, daß er nicht einmal etwas von dem Wind wissen würde, der die Blätter über seinem Grab bewegte, noch den Geruch von Gras und Erde. Um solchen Nichts willen, das er nie würde begreifen können, mochte er auch noch so sehr versuchen, es zu tun. Daher durfte er die Hoffnung nicht aufgeben, sie, die er liebte, einst wiederzusehen! Sich dies vorzustellen, war eine stechende innere Qual. Bevor er an jenem Tage zu Hause anlangte, hatte er beschlossen, es Irene zu verschweigen.
Er würde vorsichtiger sein müssen, als je ein Mann gewesen, denn die geringste Kleinigkeit konnte es verraten und sie – beinah ebenso unglücklich machen wie ihn selbst. Sein Arzt hatte ihn in anderer Hinsicht für gesund erklärt, und siebzig Jahre waren kein Alter – er würde noch lange standhalten, wenn er konnte!
Dieser Beschluß, den er vor nahezu zwei Jahren gefaßt, entwickelte in vollem Maße die zartere Seite seines Charakters. Von Natur nicht aufbrausend, außer wenn er sich in nervöser Erregung befand, war er die verkörperte Selbstbeherrschung geworden. Die traurige Geduld alter Leute, die zum Müßiggang verurteilt sind, war durch ein Lächeln verhüllt, das sogar, wenn er allein war, auf seinen Lippen blieb. Und er ersann fortgesetzt allerlei Vorwände, um den erzwungenen Müßiggang zu verbergen.
Obwohl er sich selbst deswegen verspottete, heuchelte er eine Bekehrung zu einfacherem Leben, gab Wein und Zigarren auf und trank eine besondere Art von Kaffee ohne Kaffee darin. Kurz, er sicherte sich, wie ein Forsyte in seiner Lage es mit Hilfe seiner milden Ironie vermochte. Sicher vor Entdeckung, da seine Frau und sein Sohn in die Stadt gefahren waren, hatte er den schönen Maitag damit zugebracht, in Ruhe seine Papiere zu ordnen, damit er morgen sterben könnte, ohne irgend jemand zu belästigen, und somit seinem irdischen Sein tatsächlich den letzten Stempel aufzudrücken. Nachdem er sie in seines Vaters chinesischem Schrank verstaut und eingeschlossen hatte, legte er den Schlüssel in ein Kuvert, schrieb außen darauf die Worte: »Schlüssel zum chinesischen Schrank, worin die genaue Aufstellung meines Vermögens zu finden ist. J.F.« und steckte es in seine Brusttasche, um es für den Fall, daß ihm etwas zustoßen sollte, immer bei sich zu haben. Dann klingelte er nach Tee und ging hinaus, um ihn unter der Eiche einzunehmen.
Allen Menschen droht der Tod, und Jolyon, dem er nur ein wenig deutlicher und ernster drohte, hatte sich so daran gewöhnt, daß er, wie andere Leute, meist an andere Dinge dachte. Jetzt dachte er an seinen Sohn.
Jon war an diesem Tage neunzehn Jahre alt und hatte kürzlich einen Entschluß gefaßt. Er war weder in Eton erzogen worden wie sein Vater, noch in Harrow, wie sein verstorbener Halbbruder, sondern in einer der Anstalten, die bestimmt waren, das Schlechte des öffentlichen Schulsystems zu vermeiden und das Gute darin zu pflegen, aber vielleicht das Schlimme pflegten und das Gute vermieden. Jon hatte die Schule im April verlassen, ohne die geringste Ahnung zu haben, was er eigentlich werden wolle. Der Krieg, der ewig zu dauern versprach, war gerade zu Ende, als er im Begriff war, sechs Monate vor seiner Zeit ins Heer einzutreten. Seitdem hatte er sich allmählich an den Gedanken zu gewöhnen gehabt, daß es ihm jetzt freistand, selbst eine Wahl für sich zu treffen. Er hatte mit seinem Vater verschiedentliche Diskussionen gehabt, und als er munter erklärte, daß er zu allem bereit sei – ausgenommen natürlich Kirche, Heer, Rechtswissenschaft, Bühne, Medizin, Börse, Geschäft und die Technik –, war Jolyon ziemlich im klaren darüber, daß Jon eigentlich zu nichts Lust hatte. Er selbst hatte in dem Alter genau so gefühlt. Bei ihm hatte eine frühe Heirat und deren unglückliche Folgen dieser angenehmen Leere bald ein Ende gemacht. Ihn hatte die Not gezwungen, als Agent bei Lloyds einzutreten, und er war wieder zu Wohlstand gekommen, bevor sein künstlerisches Talent sich entpuppt hatte. Doch nachdem er seinen Jungen »gelernt« hatte, wie einfache Leute es nennen, Schweine und andere Tiere zu zeichnen, wußte er, daß Jon niemals Maler werden würde, und schloß aus seiner Abneigung gegen alles sonst, daß er wohl dazu bestimmt war, Schriftsteller zu werden. Da seiner Ansicht nach jedoch selbst für diesen Beruf Erfahrung notwendig war, fand Jolyon, daß für Jon nichts anderes übrigblieb als die Universität, Reisen und vielleicht das Studium der Rechte. Danach würde man sehen, oder vielmehr wahrscheinlich nicht sehen. Indessen war Jon diesen Anregungen gegenüber unentschieden geblieben. Solche Auseinandersetzungen mit seinem Sohn hatten Jolyon in dem Zweifel daran bestärkt, daß die Welt sich wirklich verändert hatte. Die Leute sagten, es sei ein neues Zeitalter. Aber mit seinem Scharfblick erkannte Jolyon, daß die Zeit unter einer leichten Veränderung der Oberfläche genau dieselbe war, die sie gewesen. Die Menschheit war noch in zwei Arten geteilt: die wenigen, die Phantasie hatten, und die vielen, die sie nicht hatten, mit einem Gürtel von Bastardwesen, wie er, in der Mitte. Jon schien Phantasie zu besitzen; sein Vater betrachtete das als schlechte Aussicht.
Mit einem tieferen Gefühl, als sein gewohntes Lächeln erkennen ließ, hatte er den Jungen daher vor vierzehn Tagen sagen hören: »Ich möchte es gern mit der Landwirtschaft versuchen, Papa, wenn es nicht zuviel kostet. Es scheint die einzige Art von Leben zu sein, die niemand schadet, ausgenommen die Kunst, und davon kann bei mir keine Rede sein.«
Jolyon hatte sein Lächeln unterdrückt und geantwortet:
»Gut, du sollst dahin zurückkehren, wo wir im Jahre 1760 unter dem ersten Jolyon waren. Es wird die Theorie des Kreises beweisen, und wenn der Zufall es will, wirst du vielleicht bessere Rüben ziehen, als er es getan.«
Ein wenig verdutzt hatte Jon erwidert:
»Aber hältst du es nicht für einen guten Plan, Papa?«
»Er ist nicht schlecht, mein Lieber, und wenn du dich wirklich dafür entscheidest, wirst du mehr Gutes tun als die meisten Menschen, was wenig genug ist.«
Zu sich selbst jedoch hatte er gesagt: »Aber er wird sich nicht dafür entscheiden. Ich gebe ihm vier Jahre. Schließlich ist es gesund und harmlos.«
Nachdem er die Sache nach allen Seiten hin überlegt und sich mit Irene beraten hatte, schrieb er an seine Tochter, Mrs. Val Dartie, und fragte sie, ob sie einen Landwirt in ihrer Nähe wüßten, der Jon als Eleven annehmen würde. Hollys Antwort war enthusiastisch. Sie wüßten einen vortrefflichen Mann ganz nahe bei ihnen, sie und Val wären glücklich, mit Jon leben zu können.
Der Junge sollte morgen fort.
Jolyon schlürfte seinen schwachen Tee mit Zitrone und betrachtete durch die Blätter der alten Eiche die Aussicht, die ihm zweiunddreißig Jahre so lieb gewesen. Der Baum, unter dem er saß, schien nicht einen Tag älter. So jung die kleinen, bräunlichen goldenen Blätter, so alt das weißliche Grüngrau des dicken rauhen Stammes. Ein Baum der Erinnerungen, der noch Hunderte von Jahren leben würde, wenn nicht irgendein Barbar ihn fällte. – Er erinnerte sich einer Nacht vor drei Jahren, als er, den Arm fest um Irene geschlungen, aus dem Fenster gesehen und ein deutsches Flugzeug beobachtet hatte, das gerade über dem alten Baum zu schweben schien. Am nächsten Tage hatten sie auf dem Felde des Nachbargutes ein Bombenloch gefunden. Das war, bevor er wußte, daß er zum Tode verurteilt war. Er wünschte beinah, daß die Bombe ihn getötet hätte. Es hätte ihm viel Ungewißheit erspart, viele Stunden kalter Furcht im Herzen. Er hatte damit gerechnet, bis zu dem normalen Forsytealter von fünfundachtzig oder mehr zu leben, wo Irene siebzig sein würde. Sie würde ihn wohl vermissen. Allein sie hatte ja Jon, der wichtiger für ihr Leben als er war. Jon, der seine Mutter anbetete.
Unter diesem Baum, wo der alte Jolyon, während er Irene erwartete, sein Leben ausgehaucht hatte, überlegte Jolyon, ob er, wo er alles so vollkommen in Ordnung gebracht, jetzt nicht lieber auch die Augen schließen und von ihnen gehen sollte. Es lag etwas Unwürdiges darin, so parasitenhaft an dem zwecklosen Ende eines Lebens zu hängen, in dem er nur zweierlei bedauerte – die lange Trennung zwischen seinem Vater und ihm, als er jung war, und daß er so spät zu der Verbindung mit Irene gekommen war.
Von seinem Platz aus konnte er eine Gruppe blühender Apfelbäume sehen. Nichts in der Natur bewegte ihn so, wie Obstbäume in der Blüte; und sein Herz tat ihm plötzlich weh, weil er sie vielleicht nie wieder blühen sehen würde. Frühling! Wahrlich, niemand sollte sterben müssen, solang das Herz noch jung genug war, Schönheit zu lieben! Amseln sangen sorglos in den Büschen, die Schwalben flogen hoch, die Blätter über ihm glänzten; und über den Feldern brannte in der Sonne junges Laubwerk jeder Schattierung, bis zu dem fernen Blau des »Rauchbusches«, das sich am Horizonte hinzog. Irenens Blumen, auf ihren schmalen Beeten, wirkten an diesem Abend erstaunlich individuell, fast wie eine Verheißung heiterer Lebenslust. Nur chinesische und japanische Maler, und vielleicht Leonardo, hatten jenes kleine erstaunliche Ego in jede gemalte Blume, jeden Vogel und jedes Tier zu bringen gewußt – das Ego und doch dabei das Eigentümliche der Art, das Leben in seiner Gesamtheit. Sie hatten es verstanden! »Ich habe nichts gemacht, das bleiben wird!« dachte Jolyon; »ich war ein Dilettant – ein bloßer Liebhaber, kein Schöpfer. Schließlich aber hinterlasse ich doch Jon, wenn ich gehe.« Welch ein Glück, daß der Junge nicht dem grausigen Krieg zum Opfer fiel! Er hätte so leicht getötet werden können wie der arme Jolly vor zwanzig Jahren, draußen in Transvaal. Jon würde dereinst etwas zuwege bringen – wenn die Zeit ihn nicht verdarb – er war ein phantasievoller Bursche! Sein Einfall, es mit der Landwirtschaft zu versuchen, war nur Gefühlssache bei ihm und würde wohl nicht von Dauer sein. Und gerade jetzt sah er sie über das Feld heraufkommen: Irene und der Junge kamen Arm in Arm vom Bahnhof. Er stand auf und schlenderte durch den neuen Rosengarten, um ihnen entgegenzugehen ...
An diesem Abend kam Irene in sein Zimmer und setzte sich ans Fenster. Sie saß dort ohne zu sprechen, bis er sagte:
»Was ist dir, meine Liebe?«
»Wir hatten heute eine Begegnung.«
»Mit wem?«
»Soames.«
Soames! Seit zwei Jahren hatte er vermieden, an diesen Namen zu denken, denn er wußte, daß es ihm schaden könnte. Und jetzt brachte das Pochen seines Herzens ihn beinah aus der Fassung, als drohe es, ihm die Brust zu sprengen.
Irene fuhr ruhig fort:
»Er und seine Tochter waren in der Galerie, und nachher in der Konditorei, wo wir Tee tranken.«
Jolyon ging zu ihr und legte die Hand auf ihre Schulter.
»Wie sah er aus?«
»Grau; sonst aber ganz der alte.«
»Und die Tochter?«
»Hübsch. Wenigstens fand Jon es.«
Jolyons Herz fing wieder an zu pochen. Das Antlitz seiner Frau hatte einen gespannten, bestürzten Ausdruck.
»Du hast nicht –?« begann er.
»Nein; aber Jon kennt ihren Namen. Das Mädchen ließ das Taschentuch fallen, und Jon hob es auf.«
Jolyon setzte sich auf sein Bett. Ein böser Zufall!
»June war mit dir. Hat sie sich eingemischt?«
»Nein; aber es war alles sehr sonderbar und gezwungen, und Jon konnte sehen, daß es so war.«
Jolyon holte tief Atem und sagte:
»Ich habe mich oft gefragt, ob es recht war, daß wir es ihm verschwiegen. Er wird eines Tages doch dahinterkommen.«
»Je später, desto bester, Jolyon; die Jugend hat ein so schnelles, hartes Urteil. Was hättest du mit neunzehn Jahren von deiner Mutter gedacht, wenn sie getan hätte, was ich getan?«
Ja! Das war es! Jon verehrte seine Mutter und wußte nichts von den Tragödien, den unerbittlichen Notwendigkeiten des Lebens, nichts von dem geheimen Kummer einer unglücklichen Ehe, nichts von Eifersucht oder Leidenschaft – wußte von alledem noch nichts!
»Was hast du ihm gesagt?« fragte er schließlich.
»Daß es Verwandte seien, wir sie aber nicht kennten; daß du dir nie viel aus deiner Familie gemacht hättest und sie sich nichts aus dir. Ich vermute, daß er dich danach fragen wird.«
Jolyon lächelte. »Das verspricht die Stelle der Luftangriffe einzunehmen«, sagte er. »Schließlich vermißt man sie.«
Irene blickte zu ihm auf.
»Wir haben gewußt, daß es eines Tages kommen würde.«
Er antwortete mit plötzlicher Energie:
»Ich könnte es nicht ertragen, dich von Jon getadelt zu sehen. Er wird es nicht tun, nicht einmal in Gedanken. Er hat Phantasie und wird es verstehen, wenn es ihm richtig erklärt wird. Ich glaube, ich täte besser, es ihm zu sagen, bevor er es von andern erfährt.«
»Noch nicht, Jolyon.«
Das sah ihr ähnlich – sie hatte keine Voraussicht und ging allem Kummer aus dem Wege. Doch – wer konnte wissen? – sie hatte vielleicht recht. Es war eine böse Sache, dem Instinkt einer Mutter zuwider zu handeln. Vielleicht wäre es richtig, den Jungen in Ruhe zu lassen, bis er an der Erfahrung einen Prüfstein hatte, nach dem er den Wert der alten Tragödie beurteilen konnte; bis Liebe, Eifersucht, Sehnsucht sein Mitempfinden vertieft hatten. Aber einerlei, man mußte vorsichtig sein – so vorsichtig wie möglich! Und lange, nachdem Irene ihn verlassen hatte, hielten die Gedanken über diese Vorsichtsmaßregeln ihn wach. Er mußte an Holly schreiben, ihr sagen, daß Jon noch nichts von den Familiengeschichten wußte. Holly war verschwiegen, sie würde sich ihres Mannes versichern, würde achtgeben! Jon konnte den Brief mitnehmen, wenn er morgen hinfuhr.
Und so verklang der Tag, an dem Jolyon die letzten Verfügungen über seinen materiellen Besitz getroffen, mit dem Läuten der Stallglocke, und es begann ein anderer für ihn im Schatten seelischer Bedrängnis, die nicht so abzutun und zu glätten war ...
Aber Jon, dessen Zimmer einst seine Kinderstube gewesen war, lag ebenfalls wach da als Beute eines Gefühls, über das die Menschen immer disputierten, die niemals »Liebe auf den ersten Blick« gekannt. Er hatte sie bei dem Leuchten der dunkeln Augen kommen gefühlt, die über die Juno hinweg in die seinen schauten – er war überzeugt davon, daß dies sein »Traum« war, so daß, was folgte, ihm natürlich und wunderbar zugleich erschienen war. Fleur! Ihr Name allein schon genügte beinah für ihn, der so empfänglich für den Reiz der Worte war. In einem homöopathischen Zeitalter, wo Knaben und Mädchen zusammen erzogen wurden und sich früh vermischten, bis das Geschlecht beinah aufgehoben schien, war Jon sonderbar altmodisch geblieben. Seine moderne Schule nahm nur Knaben auf, und seine Ferien hatte er immer in Robin Hill mit Schulkameraden oder den Eltern allein verlebt. Ihm war das Gift gegen die Keime der Liebe daher nie in kleinen Dosen eingeimpft worden. Und jetzt in der Dunkelheit stieg seine Temperatur sehr schnell. Er lag wach, Fleurs Bild vor Augen, und rief sich ihre Worte, namentlich das » Au revoir!« zurück, das so sanft und heiter geklungen hatte.
Er war noch in der Morgendämmerung so völlig wach, daß er aufstand und in Tennisschuhen, Beinkleidern und einem Sweater leise die Treppe hinunter und durch das Fenster des Lesezimmers hinausschlüpfte. Es wurde eben hell, und es roch nach Gras. »Fleur!« dachte er, »Fleur!« Es war geheimnisvoll weiß draußen, und nichts war wach als die Vögel, die gerade zu zwitschern begannen. »Ich will ins Wäldchen hinuntergehen«, dachte er. Er lief durch die Felder, erreichte den Teich gerade, als die Sonne aufging, und ging weiter in das Wäldchen hinein. Blaue Glockenblumen bedeckten den Boden wie einen Teppich, unter den Lärchenbäumen wisperte es geheimnisvoll – die Luft hatte gleichsam etwas Romantisches. Jon atmete die Frische ein und staunte die blauen Glockenblumen in dem heller werdenden Lichte an. Fleur! Ein Gedicht wie sie! Und sie wohnte in Mapledurham – auch ein hübscher Name, irgendwo am Fluß. Er konnte es gleich im Atlas auffinden. Er wollte an sie schreiben. Aber würde sie antworten? Oh! Sie mußte. Sie hatte gesagt: » Au revoir!« Nicht: »Leben Sie wohl!« Welch ein Glück, daß sie ihr Taschentuch halte fallen lassen! Sonst hätte er sie nie kennengelernt. Und je mehr er an das Taschentuch dachte, desto merkwürdiger schien ihm sein Glück. Fleur! Es war wirklich wie ein Gedicht! Rhythmen drängten sich in seinem Kopf. Worte strebten, miteinander verbunden zu werden, er war nahe daran, zu dichten.
Jon blieb mehr als eine halbe Stunde in dieser Gemütsverfassung, ging dann zum Haus zurück, nahm eine Leiter und kletterte vor lauter Seligkeit in sein Schlafzimmerfenster. Dann erinnerte er sich, daß das Fenster im Lesezimmer offen stand, ging hinunter und schloß es, nachdem er erst die Leiter weggestellt hatte, wie um die Spuren seiner Gefühle zu verwischen. Die Sache war zu tief, um sie sterblichen Seelen – selbst seiner Mutter – zu offenbaren.
Viertes Kapitel: Das Mausoleum
Es gibt Häuser, deren Seelen in die Hölle der Zeit eingegangen sind, ihre Körper aber in der Hölle Londons zurückgelassen haben. Dies war nicht ganz der Fall bei Timothys Haus in der Bayswater Road, denn Timothys Seele stand noch mit einem Fuße in Timothy Forsytes Körper, und Smither sorgte mit Kampfer und Portwein dafür, daß die Atmosphäre unverändert blieb in dem Haus, dessen Fenster nur zweimal täglich geöffnet wurden, um zu lüften.
In der Vorstellung der Forsytes war das Haus jetzt eine Art von chinesischer Pillenschachtel, eine Serie von Lagern, auf deren letztem Timothy lag. Er war nicht zu erreichen, so wurde wenigstens von Familienmitgliedern berichtet, die aus alter Gewohnheit oder Zerstreutheit eines schönen Tages vorfuhren, um sich nach ihrem überlebenden Oheim zu erkundigen. So zum Beispiel von Francie, die sich jetzt völlig von Gott emanzipiert hatte (sie bekannte sich offen zum Atheismus), von Euphemia, die sich von dem alten Nicholas, und Winifred, die sich von ihrem »Mann von Welt« emanzipiert hatte. Schließlich war aber jedermann jetzt emanzipiert, oder sagte, daß er es sei – was vielleicht nicht ganz dasselbe war!
Als Soames daher am Morgen nach jener Begegnung auf seinem Wege zur Paddingtonstation dort vorsprach, geschah es kaum in der Erwartung, Timothy leibhaftig anzutreffen. Er spürte eine leise Regung im Herzen, während er in vollem Sonnenschein auf der frisch geweißten Schwelle des kleinen Hauses stand, wo einst vier Forsytes gelebt hatten und jetzt nur noch einer darin wohnte wie eine Winterfliege; des Hauses, wo Soames unzählige Male ein und aus gegangen, seiner Bündel von Familienklatsch beraubt oder damit beladen; des Hauses der »Alten« eines andern Jahrhunderts, eines andern Zeitalters.
Der Anblick Smithers – die immer noch bis an die Achselhöhlen geschnürt war, weil die neue Mode, die 1903 aufkam, von den Tanten Juley und Hester nie »anständig« gefunden wurde – rief eine blasse Freundlichkeit auf Soames' Lippen hervor. Smither, die in jeder Einzelheit noch getreu nach dem alten Muster ausgestattet war, ein unschätzbarer Dienstbote – wie es keine mehr gab – erwiderte das Lächeln mit den Worten: »Ach, das ist ja Mr. Soames, nach so langer Zeit! Wie geht es Ihnen denn, Sir? Mr. Timothy wird sich freuen, zu hören, daß Sie hier waren.«
»Wie geht es ihm?«
»Oh! er hält sich ziemlich für sein Alter: aber natürlich, er ist ein wunderbarer Mann. Wie ich schon Mrs. Dartie sagte, als sie zuletzt hier war: Es würde Miß Forsyte und Mrs. Juley und Miß Hester sicher freuen, zu sehen, wie ihm ein Bratapfel noch schmeckt. Aber er ist ganz taub. Und ein Glück ist das, denke ich immer. Denn was wir bei den Luftangriffen mit ihm angefangen hätten, weiß ich nicht.«
»Was habt ihr dabei denn mit ihm angefangen?«
»Wir ließen ihn ruhig in seinem Bett und hatten die Klingel bis in den Keller hinuntergeleitet, so daß die Köchin und ich hören konnten, wenn er klingelte. Es wäre unmöglich gewesen, ihn wissen zu lassen, daß Krieg war. Ich sagte zu der Köchin: ›Wenn Mr. Timothy klingelt, mögen sie tun, was sie wollen, ich gehe hinauf.‹ Meine lieben Damen hätten einen Anfall bekommen, wenn sie gesehen hätten, daß er klingelte und niemand zu ihm ging. Aber er schlief während aller Angriffe wunderschön. Und bei dem einen am Tage nahm er sein Bad. Es war wirklich ein Glück, denn er hätte all die Leute auf der Straße bemerken können, die alle in die Höhe schauten – er sah oft aus dem Fenster.«
»So ist es!« murmelte Soames. Smither wurde schwatzhaft! »Ich wollte mich nur umschauen und sehen, ob etwas zu tun ist.«
»Ja, Sir. Ich glaube, es ist nichts als ein Geruch von Mäusen im Speisezimmer, den wir nicht zu beseitigen wissen. Merkwürdig, daß er da ist, denn es ist kein Krümchen darin, da Mr. Timothy seit Anfang des Krieges nicht mehr herunterzukommen pflegt. Aber es sind garstige kleine Dinger, man weiß nie, wo sie einen das nächste Mal fassen.«
»Verläßt er sein Bett zuweilen?«
»O ja, Sir; er macht morgens fleißig Bewegung zwischen Bett und Fenster, um keinen Luftwechsel zu riskieren. Und er fühlt sich ganz behaglich, nimmt jeden Tag regelmäßig sein Testament vor. Es ist ihm ein großer Trost.«
»Nun, Smither, ich möchte ihn gern sehen, wenn ich kann, für den Fall, daß er mir etwas zu sagen hat.«
Smither errötete über ihrem Schnürleib.
»Das wird aber ein Ereignis sein!« sagte sie. »Darf ich Ihnen das Haus zeigen, Sir, während ich die Köchin hinaufschicke, es ihm zu sagen?«
»Nein, gehen Sie zu ihm«, sagte Soames. »Ich kann mir das Haus allein ansehen.«
Man durfte vor andern seine Empfindungen nicht zeigen, und Soames fühlte, daß er anfing sentimental zu werden, während er durch die Räume ging, die so vollgesogen mit Vergangenheit waren. Als Smither aufgelöst vor Aufregung ihn verlassen hatte, trat Soames ins Speisezimmer und schnupperte; seiner Meinung nach waren es nicht Mäuse, sondern beginnende Holzfäule, und er untersuchte die Täfelung. Ob es sich lohnte, sie streichen zu lassen bei Timothys Alter? Das Zimmer war immer das modernste im ganzen Hause gewesen, und ein leises Lächeln kräuselte Soames' Lippen und Nasenflügel. Wände von reichem Grün über dem Eichengesims, ein schwerer Metallkronleuchter hing an einer Kette von der Decke herab, die durch imitierte Balken geteilt war. Die Bilder hatte Timothy vor sechzig Jahren einmal spottbillig bei Jobson gekauft – drei Snyders' »Stilleben«, zwei schwach kolorierte Zeichnungen von einem Knaben und einem Mädchen, sehr hübsch, die mit »J. R.« gezeichnet waren – Timothy hatte immer geglaubt, sie würden sich als Werke von Joshua Reynolds entpuppen, aber Soames, der sie bewunderte, hatte entdeckt, daß sie nur von John Robinson waren, und ein zweifelhafter Morland, ein weißes Pony, das beschlagen wird. Tiefrote Plüschvorhänge, zehn hochlehnige dunkle Mahagonistühle mit tiefroten Sitzen, ein türkischer Teppich und ein Mahagonitisch, der so groß war wie das Zimmer klein, das war die Einrichtung, deren Soames sich, unverändert an Körper und Seele, seit seinem vierten Jahr erinnern konnte. Er betrachtete hauptsächlich die beiden Zeichnungen und dachte: »Ich werde sie aus dem Nachlaß kaufen.«
Aus dem Speisezimmer ging er in Timothys Arbeitszimmer. Er erinnerte sich nicht, jemals in dem Raume gewesen zu sein. Er war vom Boden bis zur Decke mit Büchern angefüllt, und Soames betrachtete sie mit Neugierde. Eine Wand schien Erziehungsbüchern gewidmet, die Timothys Firma vor zwei Generationen veröffentlicht hatte – mitunter zwanzig Exemplare desselben Buches. Soames las ihre Titel und schauderte. An der Mittelwand standen genau dieselben Bücher, die in der Bibliothek seines Vaters in Park Lane zu stehen pflegten, woraus er schloß, daß James und sein jüngster Bruder eines Tages wohl zusammen ausgegangen waren und einen Haufen kleiner Bibliotheken aufgekauft hatten. Der dritten Wand näherte er sich mit größerer Spannung. Hier würde sich doch wohl Timothys eigener Geschmack finden. So war es. Die Bücher waren Attrappen. Die vierte Wand nahmen nur die mit schweren Vorhängen versehenen Fenster ein. Und davor stand ein großer Lehnstuhl, an dem ein Mahagonipult befestigt war, auf dem gelblich und zusammengefaltet die »Times« vom 6. Juli 1914, dem Tag, an dem Timothy zum ersten Male nicht heruntergekommen war, wie in Vorbereitung auf den Krieg noch auf ihn zu warten schien. In einer Ecke stand ein großer Globus von der Welt, die Timothy nie betreten hatte, weil er die tiefe Überzeugung hegte, daß außerhalb Englands alles unreell sei, und er einen wahren Abscheu vor der See empfand, auf der er an einem Sonntagnachmittag im Jahre 1836 in einem Vergnügungsboot in Brighton mit Juley, Hester, Swithin und Hatty Cheßman sehr krank gewesen war; und zwar hatte er das Swithin zu verdanken, der sich immer solche Dinge in den Kopf setzte, zum Glück aber ebenfalls krank gewesen war. Soames kannte die Geschichte ganz genau, da er sie mindestens fünfzigmal gehört hatte. Er trat an den Globus und ließ ihn sich drehen; ein leises Knarren war zu hören, er bewegte sich etwa einen Zoll weiter und brachte dabei ein langbeiniges Insekt in seinen Gesichtskreis, das auf dem vierundvierzigsten Breitengrad verendet war.
»Mausoleum!« dachte er. »George hat recht!« Dann ging er hinaus und die Treppe hinauf. Auf dem halben Absatz blieb er vor dem Kasten mit den ausgestopften Kolibris stehen, die ihn in seiner Kindheit entzückt hatten. Sie sahen nicht einen Tag älter aus, wie sie da an Drähten über dem Pampasgras hingen. Öffnete man den Kasten, würden die Vögel nicht zu summen anfangen, sondern das ganze Ding würde wohl zerfallen, nahm er an. Es hatte keinen Wert, ihn mit in den Nachlaß aufzunehmen! Und plötzlich fiel ihm Tante Ann ein – die liebe alte Tante Ann –, die ihn vor dem Kasten bei der Hand hielt und sagte: »Sieh her, Soamey! Sind sie nicht hübsch und lustig, die summenden kleinen Kolibris?« Und Soames erinnerte sich seiner eigenen Antwort: »Sie summen ja nicht, Tantchen.« Er mußte damals sechs Jahre alt gewesen sein, in einem schwarzen Samtanzug mit hellblauem Kragen – er erinnerte sich des Anzugs noch ganz gut. Tante Ann mit ihren Ringellocken, ihren gütigen hageren Händen und ihrem ernsten alten Lächeln – eine feine alte Dame, diese Tante Ann! Er ging weiter an die Tür des Wohnzimmers. Da hingen zu beiden Seiten davon die Gruppen der Miniaturen. Die allerdings würde er mit einkaufen! Die Miniaturen seiner vier Tanten, eine seines Onkels Swithin als junger Mann und eine seines Onkels Nicholas als Knabe. Sie waren alle von einer der Familie befreundeten jungen Dame zu gleicher Zeit gemalt, etwa um 1830, wo Miniaturen als etwas sehr Feines und auch Haltbares angesehen wurden, da sie auf Elfenbein gemalt waren. So manches Mal hatte er die Geschichte der jungen Dame gehört: »Sie war sehr begabt, mein Lieber, sie hatte geradezu eine Schwäche für Swithin, und sehr bald danach wurde sie schwindsüchtig und starb: ganz wie Keats – wir sprachen oft davon.«
Ja, das waren sie! Ann, Hester, Juley, Susan – als ganz kleines Kind; Swithin, mit himmelblauen Augen, rosigen Wangen und gelben Locken, in einer weißen Weste, die viel zu groß für ihn war, und Nicholas, wie Kupido, mit Augen, die gen Himmel blickten. Jetzt erst fiel es ihm ein, Onkel Nick hatte immer etwas davon gehabt – ein wundervoller Mann bis zuletzt. Ja, sie mußte Talent besessen haben, und Miniaturen hatten immer ihr eigen unvergängliches Gepräge und waren wenig abhängig von dem Wettringen an der Börse der Ästhetik. Soames öffnete die Wohnzimmertür. In dem Zimmer war alles abgestaubt, die Möbel unbedeckt, die Vorhänge zurückgezogen, genau, als weilten seine Tanten noch geduldig wartend darin. Und ihm kam ein Gedanke: »Wenn Timothy starb – weshalb nicht? Wäre es nicht beinahe eine Pflicht, dieses Haus zu erhalten – wie Carlyles –, eine Tafel anzubringen und es zu zeigen? ›Muster einer Wohnung aus der viktorianischen Zeit. – Eintritt ein Schilling, mit Katalog.‹« Es war eigentlich die vollkommenste Sache und vielleicht die toteste im heutigen London. Vollkommen hinsichtlich des speziellen Geschmacks und der Kultur, das heißt, wenn er die vier Barbizons, die er ihnen geschenkt, herunternahm und sie in seiner eigenen Sammlung unterbrachte. Die noch himmelblauen Wände, die grünen, mit roten Blumen und Farnen gemusterten Vorhänge, der gestickte Wandschirm vor dem gußeisernen Kaminrost, der Mahagonischrank mit Glasscheiben, voll kleiner Nippsachen, die mit Perlen gestickten Fußbänke, Keats, Shelley, Southey, Cowper, Coleridge, Byrons »Korsar« (sonst nichts von ihm) und die Dichter der viktorianischen Zeit in einer Reihe auf dem Bücherbrett, der eingelegte Schrank, mit stumpfem rotem Plüsch ausgelegt, voll von Familienreliquien, Hesters erstem Fächer, den Schnallen von ihres Vaters und ihrer Mutter Schuhen, drei Skorpionen in Flaschen und einem sehr gelben Elefantenzahn, den ihr Großonkel, Edgar Forsyte, der in Jute gehandelt, aus Indien geschickt hatte, einem Stück gelben Papiers mit spinnenähnlicher Schrift darauf, die Gott weiß was enthielt! Und die vielen Bilder an den Wänden – alles Aquarelle, außer jenen vier Barbizons, die wie Fremdlinge darunter wirkten, die sie auch waren, und zweifelhafte Kunden dazu – heitere, illustrative Bilder, »Bei den Bienen«, »Juchhe, da kommt die Fähre!« und zwei im Stile von Frith, alle mit Taschenspielern und Krinolinen, die Swithin ihnen geschenkt. Ach! Viele, viele Bilder, die Soames tausendmal voll überlegenen Entzückens angeschaut, eine wunderbare Sammlung glatter, matt vergoldeter Rahmen.