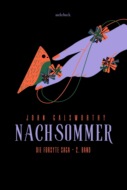Kitabı oku: «Zu vermieten», sayfa 4
Und das Boudoirpiano, schön abgestaubt, hermetisch verschlossen wie immer, und Tante Juleys Album mit gepreßten Seenesseln darauf. Und die Stühle mit den vergoldeten Beinen, die stärker waren, als sie aussahen. Und an einer Seite des Kamins das Sofa, aus karmesinfarbener Seide, wo Tante Ann und nach ihr Tante Juley zu sitzen gewohnt war, dem Licht gegenüber und gerade aufrecht. Und an der anderen Seite des Kamins der einzige wirklich bequeme Armsessel, mit dem Rücken zum Licht, für Tante Hester. Soames blickte umher, er meinte sie dort sitzen zu sehen. Ah! Und die Atmosphäre – selbst jetzt noch, von allerlei Stoffen, gewaschenen Spitzen und Gardinen, Lavendel in Beuteln und getrockneten Bienenfiügeln. »Nein«, dachte er, »dergleichen gibt es nicht noch einmal, das müßte bewahrt bleiben.« Und mochten sie darüber lachen, aber als Standard schlichten vornehmen Lebens, von dem man niemals abwich, als Muster des Geschmacks für Auge, Nase und Gefühl trug es den Sieg davon über das Heute – das Heute mit seinen Untergrundbahnen und Automobilen, seinem unaufhörlichen Rauchen, seinen jungen Mädchen mit den bis zur Taille entblößten Nacken, den übereinandergeschlagenen Beinen, die bis zu den Knien sichtbar waren (eine Augenweide für den Satyr in jedem Forsyte, aber kaum seine Vorstellung von einer Dame), mit ihren Füßen, die sie beim Essen um die Stuhlbeine schlangen, ihrem Gekicher und albernen Redensarten – Mädchen, die ihn schaudern machten, wenn er sich Fleur in Kontakt mit ihnen dachte; und mit den streng blickenden tüchtigen älteren Frauen, die selbständig waren und ihn ebenfalls schaudern machten. Nein! Seine alten Tanten hatten, wenn sie auch niemals ihre Herzen, ihre Augen oder sehr viel ihre Fenster öffneten, doch wenigstens Manieren und einen Standard und Ehrfurcht vor der Vergangenheit und Zukunft.
Mit einem beklemmenden Gefühl schloß er die Tür und ging auf den Zehenspitzen die Treppe hinauf. Er schaute unterwegs in einen Raum hinein: Hm! in vollkommener Ordnung seit den achtziger Jahren, mit einer Art von gelbem Ölpapier an den Wänden. An der Treppe oben zögerte er zwischen vier Türen. Welche von ihnen war Timothys? Und er lauschte. Ein Geräusch, als wenn ein Kind langsam sein Steckenpferd hinter sich herzöge, traf sein Ohr. Das mußte Timothy sein! Er klopfte, und eine Tür wurde von Smither geöffnet, die sehr rot im Gesicht war.
Mr. Timothy mache seinen Spaziergang, und sie sei noch nicht imstande gewesen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Wenn Mr. Soames in das Hinterzimmer kommen wolle, könne er ihn durch die Tür sehen.
Soames ging in das Hinterzimmer und beobachtete ihn.
Der Letzte der alten Forsytes schritt mit nachdrücklichster Langsamkeit und einer Miene vollkommenster Hingabe für sein Unternehmen zwischen dem Fußende seines Bettes und dem Fenster, einer Entfernung von etwa zwölf Fuß, hin und her. Den unteren Teil seines eckigen Gesichts, das nicht mehr glatt rasiert war, bedeckte ein schneeiger Bart, der so kurz wie möglich geschnitten war, und sein Kinn sah so breit aus wie seine Stirn, wo das Haar ebenfalls ganz weiß war, während Nase, Wangen und Stirn eine gute gelbliche Farbe hatten. In einer Hand hielt er einen dicken Stock, und die andere faßte in die Falten seines Jägerschlafrocks, unter dem seine Knöchel in Bettsocken und die Füße in Jägerpantoffeln sichtbar waren. Der Ausdruck in seinem Gesicht glich dem eines eigensinnigen Kindes, das erpicht auf etwas ist, das es nicht bekommen hat. Jedesmal, wenn er sich umwandte, stieß er mit dem Stocke auf und zog ihn dann hinter sich her, wie um zu zeigen, daß er ohne ihn fertig wurde.
»Er sieht noch kräftig aus«, sagte Soames leise.
»O ja, Sir. Sie sollten ihn sein Bad nehmen sehen – es ist wunderbar; er genießt es so.«
Diese ganz lauten Worte waren eine Bestätigung für Soames' Annahme, daß Timothy völlig kindisch geworden war.
»Nimmt er irgendein Interesse an den Dingen im allgemeinen?« fragte Soames ebenfalls laut.
»O ja, Sir, an seinem Essen und an seinem Testament. Es ist ganz erstaunlich, ihn es immer wieder umwenden zu sehen, nicht um es zu lesen, natürlich; und alle Augenblick fragt er nach dem Preis von Konsols, und ich schreibe es dann sehr groß für ihn auf eine Tafel. Natürlich schreibe ich immer dasselbe, wie sie waren, als er im Jahre 1914 zuletzt Notiz davon nahm. Wir veranlaßten den Arzt, ihm das Zeitungslesen zu verbieten, als der Krieg ausbrach. Oh! er war zuerst außer sich darüber. Aber bald gab er nach, weil er wußte, daß es ihn ermüdete; und er ist wunderbar in dem Bemühen, seine Energie zu bewahren, wie er es zu nennen pflegte, als meine lieben Damen noch lebten; Gott segne sie! Wie ärgerlich er oft über sie gewesen ist; sie waren immer so geschäftig, wenn Sie sich erinnern, Mr. Soames.«
»Was würde geschehen, wenn ich hineinginge?« fragte Soames. »Würde er mich erkennen? Ich setzte sein Testament auf, wie Sie wissen, als Miß Hester im Jahre 1907 starb.«
»Ach, Sir«, erwiderte Smither zweifelnd, »darüber kann ich nichts sagen. Ich glaube, es wäre möglich, er ist wirklich ein wundervoller Mensch für sein Alter.«
Soames ging in die Türöffnung und wartete, bis Timothy sich umdrehte, dann sagte er mit lauter Stimme: »Onkel Timothy!«
Timothy stapfte den halben Weg zurück und hielt inne.
»Eh?« sagte er.
»Soames«, rief Soames mit hoher Stimme und streckte die Hand aus, »Soames Forsyte!«
»Nein!« sagte Timothy, und mit seinem Stock laut auf den Boden stoßend, setzte er seinen Gang fort.
»Es scheint nicht zu wirken«, sagte Soames.
»Nein, Sir«, erwiderte Smither ziemlich verzagt; »Sie sehen, er hat seinen Spaziergang noch nicht beendet. Ihn beschäftigt immer nur eine Sache zur selben Zeit. Ich bin überzeugt, daß er mich heute nachmittag fragen wird, ob Sie wegen des Gaslichts gekommen wären, und es wird schwer sein, es ihm verständlich zu machen.«
»Glauben Sie, daß er einen Mann um sich haben müßte?«
Smither hob abwehrend die Hände. »Einen Mann! O nein! Die Köchin und ich werden vollkommen fertig mit ihm. Ein Fremder um ihn würde ihn in kürzester Zeit wahnsinnig machen. Und meine Damen hätten den Gedanken, einen Mann im Hause zu haben, nicht gemocht. Außerdem sind wir so stolz auf ihn.«
»Ich nehme an, daß der Doktor zu ihm kommt?«
»Jeden Morgen. Er gibt seine bestimmten Anweisungen, und Mr. Timothy ist so gewöhnt daran, daß er es gar nicht beachtet, außer daß er die Zunge herausstreckt.«
Soames wandte sich ab. »Es ist sehr traurig und schmerzlich für mich«, sagte er.
»Oh, Sir!« erwiderte Smither besorgt, »so dürfen Sie nicht denken. Jetzt, wo er sich über nichts mehr ärgern kann, genießt er sein Leben so recht, wirklich, das tut er. Wie ich schon zu der Köchin sagte, Mr. Timothy ist zufriedener, als er je gewesen. Wenn er nicht badet, sehen Sie, oder seinen Spaziergang macht, ißt er, und wenn er nicht ißt, schläft er; so ist es. Er hat keine Sorgen und keinen Schmerz.«
»Nun«, sagte Soames, »das ist wahr. Ich will hinuntergehen. Übrigens, lassen Sie mich das Testament sehen.«
»Dazu muß ich meine Zeit abwarten, Sir; er hat es unter seinem Kopfkissen, und er würde mich sehen, solange er noch auf ist.«
»Ich möchte nur wissen, ob es dasjenige ist, das ich aufgesetzt habe«, sagte Soames, »sehen Sie irgendwann einmal nach dem Datum und lassen Sie mich's wissen.«
»Ja, Sir, aber ich bin sicher, daß es dasselbe ist, weil die Köchin und ich Zeugen waren, wenn Sie sich erinnern, und da stehen noch unsere Namen, und wir haben es nur einmal getan.«
»Ganz recht«, sagte Soames. Er erinnerte sich. Smither und Jane waren richtige Zeugen gewesen, aber es war ihnen nichts in dem Testament vermacht, so daß sie kein Interesse an dem Tode Timothys haben konnten Es war – das sah er völlig ein – eine fast ungebührliche Vorsicht gewesen, aber Timothy hatte es so gewünscht, und übrigens hatte Tante Hester reichlieh für sie gesorgt.
»Sehr gut, Smither«, sagte er, »leben Sie wohl. Sehen Sie nach ihm, und wenn er irgendwann etwas sagen sollte, schreiben Sie es auf und lassen Sie es mich wissen.«
»O ja, Mr. Soames, das werde ich sicher tun. Es war eine so angenehme Abwechslung, Sie zu sehen. Die Köchin wird ganz aufgeregt sein, wenn ich es ihr erzähle.«
Soames schüttelte ihr die Hand und ging hinunter. Er blieb volle zwei Minuten an dem Hutständer stehen, wo er seinen Hut so viele Male aufgehängt hatte. »So geht alles dahin«, dachte er, »vergeht und beginnt aufs neue. Armer alter Kerl!« Und er horchte, ob vielleicht das Geräusch von Timothys Nachschleppen seines Steckenpferdes die Treppen herunter zu hören war oder der Geist eines alten Gesichts sich über dem Geländer zeigte und eine alte Stimme sagte: »Ach, das ist ja der liebe Soames, und wir sprachen gerade davon, daß wir ihn seit einer Woche nicht gesehen!«
Nichts – nichts! Nur der Geruch von Kampfer und Staubkörnchen in einem Sonnenstrahl durch das fächerartige Fenster über der Tür. Das kleine alte Haus! Ein Mausoleum! Dann riß er sich los und ging, um einen Zug noch zu erreichen.
Fünftes Kapitel: Heimaterde
»Auf Heimaterde tritt sein Fuß,
Sein Name ist – Val Dartie.«
Mit einem solchen Gefühl etwa machte Val Dartie sich in seinem vierzigsten Jahr an demselben Donnerstagmorgen sehr früh aus dem alten Gutshaus auf, das er im Norden von Sussex gekauft hatte. Sein Ziel war Newmarket, das er seit dem Herbst im Jahre 1899 nicht mehr gesehen hatte, als er von Oxford heimlich zu dem Cambridgeshire hingefahren war. Er zögerte an der Tür, um seine Frau zu küssen, und steckte eine Flasche Portwein in die Tasche. »Übermüde dein Bein nicht, Val, und wette nicht zuviel.«
Bei ihrer Umarmung, Brust an Brust, und dem Blick ihrer Augen in die seinen fühlte Val Bein und Flasche sicher. Er wollte mäßig sein, Holly hatte immer recht – sie besaß eine natürliche Anpassungsfähigkeit. Es schien ihm gar nicht so merkwürdig wie vielleicht andern, daß er – obwohl er ein halber Dartie war – seiner jungen Kusine die zwanzig Jahre hindurch, seit er sie auf so romantische Art draußen im Burenkrieg geheiratet hatte, vollkommen treu geblieben war, ihr ohne jedes Gefühl von Opfer oder Langeweile treu geblieben – sie war so beweglich, wußte so klug seiner Stimmung immer ein wenig zuvorzukommen. Da sie Vetter und Kusine waren, hatten sie, oder vielmehr hatte Holly beschlossen, keine Kinder zu haben, und wenn sie auch ein wenig blasser war, hatte sie doch ihr gutes Aussehen, ihre Schlankheit und die Farbe ihres dunklen Haares behalten. Val bewunderte namentlich das Leben, das sie für sich führte, dabei aber doch ihm widmete, und ihr Reiten, das sich jedes Jahr vervollkommnete. Sie trieb ihre Musik weiter, las eine furchtbare Menge von Romanen, Dichtungen, allerlei Zeug. Draußen auf ihrer Farm in der Kapkolonie hatte sie sich aller »Nigger«-Kinder und -Frauen in wunderbarer Weise angenommen. Sie war tatsächlich tüchtig, machte aber nicht viel Wesens davon und stellte sich gar nicht vornehm. Wenngleich er nicht gerade zu Demut neigte, war Val doch allmählich zu dem Gefühl gekommen, daß sie ihm überlegen war, und grollte ihr deswegen nicht – das war ein großer Tribut. Es sei hier erwähnt, daß er sie nie ansah, ohne daß sie es merkte, ihr Blick aber mitunter ganz unvermutet auf ihm weilte.
Er hatte sie im Torweg geküßt, weil er es auf dem Bahnsteig nicht tun konnte, obwohl sie ihn zur Station begleitete, um das Auto zurückzufahren. Wenn auch gebräunt und zerfurcht durch das Wetter in den Kolonien und die Tücken, die von Pferden nicht zu trennen sind, dazu gehindert durch das Bein, das, im Burenkrieg geschwächt, ihm in dem eben beendeten Kriege wahrscheinlich das Leben gerettet hatte, war Val fast noch derselbe, der er in den Tagen ihres Brautstandes gewesen; sein Lächeln war so offen wie anziehend, seine Wimpern wenn möglich noch dichter und dunkler, die Augen klar und grau, seine Sommersprossen vielleicht dunkler, das Haar an den Schläfen ein wenig ergraut. Er machte den Eindruck eines Menschen, der sich in einem sonnigen Klima viel mit Pferden beschäftigt hat.
Während er am Tor mit dem Auto eine scharfe Wendung machte, sagte er:
»Wann kommt der junge Jon?«
»Heute.«
»Brauchst du irgend etwas für ihn? Ich könnte es am Samstag mitbringen.«
»Nein, aber du könntest mit demselben Zuge kommen wie Fleur – um ein Uhr vierzig.«
Val ließ den Ford schneller laufen; er fuhr noch, wie jemand in einem fremden Land mit schlechten Wegen fährt, der jedes Kompromiß zurückweist und bei jedem Loch auf den Himmel rechnet.
»Das ist ein Mädel, das weiß, was es will«, sagte er. »Ist dir das nicht auch aufgefallen?«
»Ja«, sagte Holly.
»Onkel Soames und dein Papa – ein wenig peinlich, nicht wahr?«
»Sie weiß nichts davon, und er weiß nichts davon, und es darf natürlich nichts erwähnt werden. Es ist nur für fünf Tage, Val.«
»Stallgeheimnis! Recht so!« Wenn Holly es für sicher hielt, dann war es so. Sie lächelte ihm verschmitzt zu und sagte: »Hast du bemerkt, wie reizend sie sich selbst einlud?«
»Nein.«
»Sie tat es aber. Wie findest du sie, Val?«
»Hübsch und klug, aber sie wäre wohl imstande, an jeder Ecke durchzugehen, wenn ihr die Laune danach steht, glaube ich.«
»Ich möchte wissen«, sagte Holly, »ob sie eins dieser modernen Mädchen ist. Man fühlt sich ganz ratlos, wenn man in all dies hineinkommt.«
»Du? Du findest dich doch so rasch in alles hinein.«
Holly schob ihre Hand in seine Rocktasche.
»Was hältst du von Profond, diesem Belgier?« fragte Val.
»Ich glaube, er ist ein ganz ›guter Teufel‹.«
Val grinste.
»Er scheint mir ein verdächtiger Freund für unsere Familie. Sie ist wirklich in einer fatalen Lage mit Onkel Soames, der eine Französin geheiratet hat, und deinem Vater, der Soames' erste Frau nahm. Unsere Großväter wären außer sich geraten.«
»Die anderer Leute ebenfalls, mein Lieber.«
»Dieses Auto«, sagte Val, »braucht eine Aufmunterung, es kommt bergauf nicht von der Stelle. Ich werde abwärts wohl die volle Geschwindigkeit einschalten müssen, wenn ich den Zug noch erreichen soll.«
Seine Vorliebe für Pferde hatte ihn immer gehindert, wirklich Gefallen an einem Auto zu finden, und die Geschwindigkeit des Ford unter seiner Führung war mit der unter Hollys Führung gar nicht zu vergleichen. Aber er erreichte den Zug.
»Sei vorsichtig auf dem Rückweg, sonst wirst du noch herausgeschleudert. Leb wohl, Liebling.«
»Leb wohl«, rief Holly und warf ihm eine Kußhand zu.
Im Zuge, nach einer Viertelstunde Unentschiedenheit zwischen seinen Gedanken an Holly, seiner Morgenzeitung, dem Anblick des schönen Tages und seiner schwachen Erinnerung an Newmarket, vertiefte Val sich in den Inhalt eines kleinen dicken Buches mit allen Namen, Stammbäumen und Notizen über Zucht und Gestalt von Pferden. Der Forsyte in ihm neigte dazu, eine bestimmte Rasse zu wählen, und er unterdrückte entschlossen den Dartiehang zu Flüchtigkeit. Als er nach dem günstigen Verkauf seiner Farm und seiner Pferdezucht in Südafrika nach England zurückkehrte und bemerkte, daß die Sonne selten schien, sagte Val sich: »Ich muß durchaus etwas mit meinem Leben anfangen, oder dies Land wird es mich fühlen lassen. Jagen genügt nicht, ich will züchten und aufziehen.« Mit diesen vernünftigen Ansichten und seiner Entschlossenheit, die er sich durch seinen langen Aufenthalt in einem neuen Lande erworben, hatte Val bald den schwachen Punkt der modernen Zucht herausgefunden. Sie waren alle durch die Mode und die hohen Preise fasziniert. Er wollte schöne Tiere kaufen und sich um Namen nicht kümmern! Aber hier saß er bereits hypnotisiert von dem Blendwerk einer bestimmten Rasse! Halb unbewußt dachte er: »Es ist etwas in diesem verwünschten Klima, das einen dazu bringt, sich im Kreise zu drehen. Doch einerlei. Ich muß einen Abkömmling des Mayflybluts haben.«
In dieser Stimmung erreichte er das Mekka seiner Hoffnung. Es war eins jener ziemlich ruhigen Rennen, die günstiger für diejenigen sind, die es vorziehen, Pferde anzusehen, als sich um die Buchmacher zu kümmern; und Val hielt sich an die Koppel. Die zwanzig Jahre seines Lebens in den Kolonien hatten ihn von dem Dandyismus befreit, in dem er erzogen war, ihm aber die nötige Eleganz des Reiters gelassen und ihm einen scharfen Blick für das gegeben, was er die »Albernheit« mancher Engländer und das Papageienhafte mancher Engländerin nannte – Holly aber hatte nichts davon, und Holly war sein Vorbild. Aufmerksam, rasch, mit allem Nötigen versehen, ging Val stets gerade auf sein Ziel los, mochte es sich um ein Pferd oder einen Trunk handeln; und er war gerade im Begriff, sich eine Mayflystute zu sichern, als eine Stimme dicht neben ihm sagte:
»Mr. Val Dartie? Wie gehen es Mrs. Val Dartie? Ich hoffen, sie ist wohl.« Und er sah den Belgier neben sich, den er bei seiner Schwester Imogen getroffen hatte.
»Prosper Profond – ich traf Sie beim Lunch«, sagte die Stimme.
»Wie geht's?« murmelte Val.
»Danke, gut«, erwiderte Monsieur Profond lächelnd mit einer gewissen unnachahmlichen Langsamkeit. »Einen guten Teufel« hatte Holly ihn genannt. Nun! Er sah ein wenig wie ein Teufel aus mit seinem dunklen, kurzgeschnittenen spitzen Bart, wenn auch wie ein schläfriger und gutgelaunter, mit schönen Augen, die unerwartet intelligent aussahen.
»Hier ist ein Herr, der Sie kennenlernen möchte – ein Vetter von Ihnen – Mr. George Forsyte.«
Val sah eine hohe Gestalt und ein glattrasiertes Gesicht, stierähnlich, ein wenig düster, mit spöttischem Ausdruck in den großen grauen Augen; er erinnerte sich seiner dunkel aus alten Tagen, wenn er mit seinem Vater im Iseeum-Klub speiste.
»Ich pflegte mit Ihrem Vater zu den Rennen zu gehen«, sagte George. »Was macht der Rennstall? Wollen Sie einen meiner Klepper kaufen?«
Val lachte, um das plötzliche Gefühl zu verbergen, daß Züchtung hier nichts mehr galt. Sie glaubten an nichts mehr hier, nicht einmal an Pferde. George Forsyte, Prosper Profond! Der Teufel selbst war nicht nüchterner als diese beiden.
»Ich wußte nicht, daß Sie ein Rennbahnliebhaber sind«, sagte er zu Monsieur Profond.
»Nein, ich machen mir nichts daraus. Ich seglen mit meiner Jacht. Eigentlich, ich machen mir auch daraus nichts, aber ich sehen gern meine Freunde. Ich haben ein Frühstück bereit, Mr. Val Dartie, nur ein kleines Frühstück, wenn Sie Lust dazu haben; nicht viel – nur ein kleines eben – in meinem Auto.«
»Danke«, sagte Val, »sehr freundlich von Ihnen. Ich komme in einer Viertelstunde etwa.«
»Dort drüben. Mr. Forsyte kommt auch«, und Monsieur Profond wies mit einem gelbbehandschuhten Finger auf den »kleinen Wagen mit dem kleinen Frühstück«; dann ging er weiter, lässig, verschlafen und fremd, und George Forsyte, geschniegelt, unförmig, mit seiner vergnügten Miene, begleitete ihn.
Val war bei der Mayflystute stehengeblieben. George Forsyte natürlich war ein alter Knabe, aber dieser Profond mochte in seinem Alter sein. Val fühlte sich außerordentlich jung, als wäre die Mayflystute ein Spielzeug, über das die beiden gelacht hatten. Das Tier hatte alle Wirklichkeit verloren.
»Was sehen Sie an der ›kleinen‹ Stute?« meinte er die Stimme von Monsieur Profond sagen zu hören, »was haben Sie an ihr? – wir müssen alle sterben!«
Und George Forsyte, der alte Freund seines Vaters, noch immer auf der Rennbahn! Die Mayflyrasse – war sie eigentlich besser als irgendeine andere? Er konnte mit seinem Gelde ebensogut etwas Amüsanteres unternehmen.
»Nein, wahrhaftig!« murmelte er plötzlich, »wenn es keinen Zweck hat, Pferde zu züchten, hat nichts einen Zweck. Wozu bin ich denn hergekommen? Ich werde sie kaufen.«
Er trat zurück und beobachtete das Zurückebben der Besucher des Sattelplatzes. Geschniegelte alte Herren, schlaue, stattliche Gesellen, Juden, Trainer, die aussahen, als hätten sie nie im Leben ein Pferd gesehen; große, schlaffe, lässige oder lebhafte Frauen mit lauten Stimmen; junge Männer mit einer Miene, als versuchten sie die Sache ernst zu nehmen – zwei oder drei von ihnen mit nur einem Arm.
»Das Leben hier ist ein Spiel!« dachte Val. »Die ›Startglocke‹ läutet, Pferde rennen. Geld wechselt den Besitzer; wieder läutet es, wieder rennen Pferde, das Geld kommt zurück in andere Hände.«
Aber beunruhigt über seine eigene Philosophie, ging er an das Tor des Sattelplatzes, um die Mayflystute hinuntergaloppieren zu sehen. Sie bewegte sich gut; dann ging er zu dem »kleinen« Auto hinüber. Das »kleine« Frühstück war, wie man es sich oft erträumt, aber selten bekommt; und als es vorüber war, ging Monsieur Profond mit ihm zurück zum Sattelplatz.
»Ihre Frau ist sehr hübsch«, war seine überraschende Bemerkung.
»Die hübscheste Frau, die ich kenne«, erwiderte Val trocken.
»Ja«, sagte Monsieur Profond, »sie haben ein hübsches Gesicht. Ich bewundern hübsche Frauen.«
Val sah ihn argwöhnisch an, aber etwas Gütiges und Offenes in dem diabolischen Wesen seines Gefährten entwaffnete ihn für den Augenblick.
»Wenn Sie irgendeinmal Lust haben, auf meine Jacht zu kommen, werd' ich Sie immer gern für kurze Zeit mitnehmen.«
»Danke«, sagte Val wieder gewappnet, »meine Frau haßt die See.«
»Ich auch«, sagte Monsieur Profond.
»Weshalb segeln Sie denn?«
Die Augen des Belgiers lächelten. »Oh! Ich weiß nicht. Ich haben alles versucht; das ist das letzte, was ich haben versucht.«
»Es muß verd – – kostspielig sein. Ich würde etwas Vernünftigeres unternehmen.«
Monsieur Profond zog die Brauen hoch und schob seine dicke Unterlippe vor.
»Ich bin ein leichtlebiger Mensch«, sagte er.
»Sind Sie mit im Krieg gewesen?«
»Ja–a. Auch das haben ich getan. Ich war vergast; es war ein klein wenig unangenehm.« Er lächelte verschlafen mit der Miene eines Menschen, dem alles glückt, als habe er es seinem Namen zu verdanken. Ob seine kleinen Sprechfehler Affektation war, konnte Val nicht entscheiden, der Mann war offenbar zu allem fähig. In dem Kreis von Käufern um die Mayflystute, die das Rennen gewonnen hatte, sagte Monsieur Profond:
»Sie wollen mitbieten?«
Val nickte. Mit diesem schläfrigen Satan neben sich aber fehlte ihm der Glaube. Wenn er durch die Vorsorge seines Großvaters, der tausend Pfund im Jahr für ihn ausgesetzt hatte, zu denen noch die tausend kamen, die Hollys Großvater jährlich für sie ausgesetzt hatte, schließlich auch vor Schicksalsschlägen geschützt war, besaß er doch nicht einen Überfluß an Kapital, das ihm zur Verfügung stand, da er das meiste von dem Erlös seiner südafrikanischen Farm für seinen Landsitz in Sussex verwendet hatte. Und sehr bald kam er zu der Einsicht, daß der Preis zu hoch für ihn war. Das Äußerste für ihn – sechshundert – war überschritten; er gab das Mitbieten auf. Die Mayflystute kam für siebenhundertfünfzig Guineen unter den Hammer. Er machte ärgerlich kehrt, als die langsame Stimme Monsieur Profonds an sein Ohr schlug: »Ich haben die kleine Stute gekauft, wissen Sie, aber ich brauchen sie nicht, nehmen Sie sie und schenken Sie sie Ihrer Frau.«
Val sah ihn mit erneutem Argwohn an, aber der launige Ausdruck in seinen Augen war so, daß er wirklich keinen Anstoß daran nehmen konnte.
»Ich haben eine kleine Menge Geld im Kriege verdient«, begann Monsieur als Antwort auf seinen Blick. »Ich hatten Munitionsaktien. Es machen mir Spaß, es auszugeben. Ich verdienen immer Geld. Und ich brauchen sehr wenig für mich. Ich haben es gern, wenn meine Freunde es nehmen.«
»Ich werde sie zu dem Preis von Ihnen kaufen, den Sie zahlten«, sagte Val mit plötzlicher Entschiedenheit.
»Nein«, sagte Monsieur Profond, »Sie nehmen sie. Ich brauchen sie nicht.«
»Unsinn! man nimmt doch nicht –«
»Weshalb nicht?« lächelte Monsieur Profond. »Ich bin ein Freund von Ihrer Familie.«
»Siebenhundertfünfzig Guineen sind doch keine Kiste Zigarren«, sagte Val ungeduldig.
»Gut, dann behalten Sie sie, bis ich sie brauchen, und machen Sie mit ihr, was Sie wollen.«
»Solange sie Ihnen gehört, habe ich nichts dagegen«, sagte Val.
»So ist's recht«, murmelte Monsieur Profond und entfernte sich.
Val beobachtete ihn. Er mag ein »guter Teufel« sein, aber vielleicht auch nicht. Er sah, daß er sich George Forsyte anschloß, und danach begegnete er ihm nicht wieder.
Die Nächte nach dem Rennen brachte Val im Hause seiner Mutter in der Green Street zu.
Winifred mit ihren zweiundsechzig Jahren hatte sich wunderbar gehalten, wenn man die dreiunddreißig Jahre mit in Betracht zog, in denen sie mit Montague Dartie fertig zu werden hatte, bis eine französische Treppe sie glücklich erlöste. Es war eine große Befriedigung, ihren Lieblingssohn nach so langer Zeit aus Südafrika zurück zu haben, ihn so wenig verändert zu sehen und seine Frau in ihr Herz zu schließen. Winifred, die Ende der siebziger Jahre, vor ihrer Heirat, Vorkämpferin für Freiheit, Vergnügen und Mode gewesen war, mußte einräumen, daß ihre Jugend durch die heutigen jungen Damen überboten war. Sie schienen zum Beispiel die Ehe als einen Zufall zu betrachten, und Winifred bedauerte zuweilen, daß sie es nicht ebenfalls getan; ein zweiter, dritter, vierter Zufall hätte ihr vielleicht einen Partner von weniger betörendem Reiz beschieden; schließlich aber hatte er ihr doch Val, Imogen, Maud und Benedikt (der beinahe Hauptmann und doch unbeschädigt durch den Krieg war) gelassen – von denen bis jetzt noch keiner geschieden war. Dachte sie an deren Vater, so staunte sie oft über die Beständigkeit ihrer Kinder, und es war ihr ein angenehmer Gedanke, daß sie alle, mit Ausnahme von Imogen vielleicht, echte Forsytes waren. Die »Kleine« ihres Bruders, Fleur, beunruhigte Winifred mehr. Das Kind war so unstet wie all diese modernen jungen Mädchen – »sie ist ein Flämmchen im Zugwind«, hatte Prosper Profond einmal nach Tisch gesagt –, aber sie war nicht zappelig und sprach nicht mit lauter Stimme. Der unbeirrte Forsyteismus in Winifreds eigenem Charakter verwarf instinktiv die überspannten Gefühle, die Gewohnheiten und das Motto des modernen Mädchens: »Ach was, heute ist heut! Ausgeben, morgen sind wir arm!« Sie sah als rettende Tugend bei Fleur, daß sie, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, nicht ruhte, bis sie es bekam – obwohl sie hinsichtlich dessen, was später geschah, wohl zu jung war, um die Tragweite ihrer Handlungsweise zu beurteilen. Das Kind war ein »sehr hübsches kleines Ding«, und es war ein Vergnügen, sie auszuführen, mit dem französischen Geschmack ihrer Mutter und der Gabe, ihre Kleider zu tragen. Jeder wandte sich um nach Fleur – das war von großer Bedeutung für Winifred mit ihrer Vorliebe für Stil und Vornehmheit, die sie, was Montague anbelangte, so grausam getäuscht hatte.
Als sie sich beim Frühstück am Samstagmorgen mit Val über sie unterhielt, kam sie auf das »Gespenst« in der Familie zu sprechen.
»Von der Sache zwischen deinem Schwiegervater und deiner Tante Irene, Val – es ist zwar ewig lange her – darf Fleur aber nichts erfahren. Dein Onkel Soames ist sehr sonderbar darin. Du mußt also vorsichtig sein.«
»Ja! Aber es ist verteufelt schwierig – Hollys junger Halbbruder soll bei uns wohnen, während er die Landwirtschaft erlernt. Er ist schon da.«
»Oh!« sagte Winifred. »Welch eine Komödie! Wie ist er denn?«
»Ich sah ihn nur einmal – in Robin Hill, als wir 1909 zu Hause waren; er war nackt und mit blauen und gelben Streifen bemalt – ein lustiger kleiner Bursche!«
Winifred fand das »allerliebst« und fügte gemütlich hinzu: »Na, Holly ist ja vernünftig; sie wird schon wissen, was sie zu tun hat. Ich werde es deinem Onkel nicht sagen. Es würde ihn nur ärgern. Es ist ein großer Trost, daß du wieder zurück bist, mein lieber Junge, jetzt, wo ich älter werde.«
»Älter! Was! du bist so jung wie je. Dieser Profond, Mutter, ist mit dem alles in Ordnung?«
»Prosper Profond? Oh! der amüsanteste Mann, den ich kenne.«
Val brummte und erzählte die Geschichte mit der Mayflystute. »Das sieht ihm ähnlich«, murmelte Winifred. »Er macht die sonderbarsten Dinge.«
»Nun«, sagte Val heftig, »unsere Familie hat nicht viel Glück gehabt mit dieser Sorte; sie sind zu leichtherzig für uns.«
Es war richtig, und Winifred saß eine volle Minute in Gedanken versunken, bevor sie erwiderte:
»Nun ja, er ist ein Ausländer, Val, man muß es nicht so genau nehmen.«
»Gut, ich nehme seine Stute und mache es irgendwie wieder wett.«
Und kurz darauf verabschiedete er sich von ihr, nahm ihren Kuß entgegen und verließ sie, um zu seinem Buchmacher, in den Iseeum-Klub und zur Viktoriastation zu gehen.