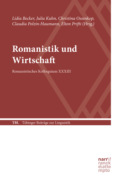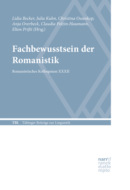Kitabı oku: «Sich einen Namen machen», sayfa 6
2.2.3 Die Entwicklung einer Szene in Europa
Wie bereits erläutert, werden insbesondere Graffitifilme wie „Wild Style“ (1983) und „Style Wars“ (1985) sowie Publikationen wie „Subway Art“ (1984) für die Verbreitung des Szenegraffitis in Europa verantwortlich gemacht (REINECKE 2012: 29). Auch Reisende, die im Anschluss an ihre New-York-Besuche in ihren europäischen Heimatstädten sprühten, trugen zur wachsenden Popularität des Szenegraffitis bei (GALLE spiegel.de 2011). Darüber hinaus soll der Aufbau von Writer-Netzwerken auch durch die erschwinglichen Interrailtickets der Bahn forciert worden sein (GALLE spiegel.de 2011). So konnten die Sprüher in die Metropolen der Nachbarländer reisen, sich dort vernetzen und mit diesen neuen Kontakten anschließend Fotos austauschen. Es entstanden auch erste Graffitimagazine.1
In den 80er-Jahren verbreitete sich das Phänomen Graffiti in nahezu jeder europäischen Großstadt, wobei den nordeuropäischen Ländern wie den Niederlanden und Deutschland dabei eine Vorreiterrolle zugekommen sein soll (GALLE spiegel.de 2011). DOMENTAT berichtet über die Anfänge der Szene in Berlin und schreibt, dass die ersten Graffitis dort zu Beginn der 80er-Jahre auftauchten (1994a: 24). Zum beliebten Objekt wurde die Berliner Mauer, die bis 1987 fast vollständig bemalt gewesen sein soll (WALDENBURG 1993: 14).2 Bis zu ihrem Fall bildete sie einen wichtigen Treffpunkt der jungen Szene (DOMENTAT 1994a: 25). Während die Akteure zunächst allein oder zu zweit arbeiteten, bildeten sich in Berlin Ende der 80er-Jahre die ersten Crews (DOMENTAT 1994a: 24). Auch in anderen deutschen Großstädten wie München und Dortmund erschienen erste Graffitis, entwickelten sich lokale Szenen und erste Writergemeinschaften (BEHFOROUZI 2006: 24). In München tauchten erstmals 1984 Graffitis an S-Bahnen auf; der erste vollbesprühte Zug (Whole Train) Europas soll 1985 in München eingefahren sein (KREUZER 1986: 225).
Ein gesteigertes Interesse am Phänomen Graffiti ist sicherlich auch auf Personen wie Harald Naegeli, Gérard Zlotykamien und Blek le Rat zurückzuführen, die schon den öffentlichen Raum für Zeichnungen genutzt hatten, bevor das Szenegraffiti aus Amerika populär geworden war (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2016: 97).3 Harald Naegeli hatte bereits 1977 in Zürich mit seinen figürlichen Zeichnungen, die sich oft „gezielt auf die städtische Umwelt“ bezogen, für Aufmerksamkeit gesorgt (STAHL 1989: 63).4 In Frankreich wurden Gérard Zlotykamien und Blek le Rat aktiv, die Zeichnungen und Schablonenarbeiten im öffentlichen Raum anbrachten (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2016: 97). Naegeli, Zlotykamien und Blek fertigten zwar primär figürliche Werke an – was im Kontrast zu der Praktik des Szenegraffitis steht, den eigenen Namen zu verbreiten –, durch sie wurde illegale Kunst im öffentlichen Raum jedoch stärker ins Bewusstsein der Bevölkerung gerückt, weshalb ihr Schaffen „ebenfalls als Teil der Geschichte des modernen Graffiti“ angesehen werden kann (PAPENBROCK UND TOPHINKE 2016: 97).
2.2.4 Graffiti und Street Art
Bei Street-Art handelt es sich um eine relativ neue Bezeichnung, die ganz verschiedene „visuelle […] Ausdrucksformen ‚inoffizieller‘ Besetzung durch Zeichen und Codes auf den Oberflächen des urbanen Raums“ umfasst (KRAUSE UND HEINICKE 2006: 58).1 REINECKE zitiert in ihrer Arbeit den Street-Art-Künstler 56K, der Street-Art als eine Szene beschreibt, „wo die Leute gemeinsam haben, dass alle sehr unterschiedlich sind. Viele kommen aus dem Writing oder kennen diese Subkultur sehr gut“ (56K zitiert in REINECKE 2012: 113). Aus dieser Aussage lässt sich bereits ableiten, dass verschiedene Praktiken zur Street-Art gezählt werden und es starke Bezüge zur Graffitiszene gibt.
Die Übergänge zwischen Graffiti und Street-Art sind fließend, was sich auch daran zeigt, dass sowohl in den Szenen selbst als auch in der Forschung immer wieder diskutiert und ausgehandelt wird, was als Graffiti und was als Street-Art gelten kann. Der Graffitiforscher SIEGL fasste Street-Art in seinem Eintrag in der BROCKHAUS-Enzyklopädie aus dem Jahr 2006 noch als Hyperonym für den „gesamte[n] Bereich sowohl offizieller als auch inoffizieller, häufig temporärer künstler. Arbeiten im öffentlichen Raum“ auf (BROCKHAUS-Enzyklopädie 2006: 460). In dieser Perspektive stellten Graffitis – genauso wie Sticker, Straßenmalerei sowie Plakat-, Schneide- und Klebearbeiten – eine Ausprägung der Street-Art dar. 2009 betrachtet SIEGL seine Definition jedoch als überholt und formuliert sie folgendermaßen um:
Inzwischen […] steht der Begriff Street-Art für ein eigenes […] Genre der bildenden Kunst: es gibt Street-Art-Passagen, Street-Art-Galerien etc., in denen käufliche Werke zur Schau gestellt werden. (SIEGL graffitieuropa.org 2009)
Graffiti und Street-Art gelten in dieser aktualisierten Definition als eigenständige Formen; erstere Form also nicht mehr als Subkategorie der Street-Art.
Nach REINECKE hat sich die Street-Art aus dem Graffiti entwickelt: Viele Writer der ersten Generation, die in den 80er- und 90er-Jahren aktiv waren, fürchteten mit dem Eintreten in das strafmündige Alter hohe Geld- und Gefängnisstrafen (REINECKE 2012: 177). Sie suchten sich daher neue Ausdrucksformen, bei denen die Gefahr, erwischt zu werden, geringer ist. Das Anbringen von Street-Art im öffentlichen Raum ist zumeist legal oder richtet wenig Schaden an, weshalb es von der Polizei nur selten sanktioniert wird.2 Für den Wechsel der Szenen wird darüber hinaus das Argument genannt, mit Street-Art eine größere Gruppe von Menschen erreichen zu können. Graffitis sind für Szeneunkundige oft nur schwer zu entziffern und werden von Passanten daher in der Regel weniger beachtet. Bunte Schablonenarbeiten, Poster und Wandbilder werden in der Öffentlichkeit dagegen positiver aufgefasst, „da sie Wiedererkennungswert haben, verstanden werden und oftmals der Unterhaltung dienen“ (REINECKE 2012: 114).
Gemeinsam haben beide Szenen, dass alle Angehörigen unautorisiert Arbeiten im öffentlichen, urbanen Raum hinterlassen. Graffiti und Street-Art-Werke integrieren sich gleichermaßen in das Stadtbild und unterbrechen damit die städtische Ordnung (WACŁAWEK 2012: 122). Des Weiteren sind auch Street-Art-Werke ephemer und somit „Bilder für den Augenblick“ (KRAUSE UND HEINICKE 2006: 60). Zum Teil nutzen die Akteure auch das gleiche Material. Das Hauptwerkzeug der Writer ist zwar die Sprühdose, es werden aber auch dicke Marker verwendet – genau wie Street-Art-Künstler ihre Werke mitunter auch mit der Sprühdose anfertigen.
Wie oben bereits angeklungen ist, verfolgen die Akteure mit ihrem künstlerischen Schaffen jedoch unterschiedliche Ziele: Der Fokus der Writer liegt auf „der Reproduktion des eigenen Namens bzw. Pseudonyms gegenüber seiner Szene“ (KRAUSE UND HEINICKE 2006: 60). Graffitiwriter wollen mit ihren Werken somit in erster Linie die Mitglieder ihrer Szene erreichen. Szenefremde werden durch die Schriftbilder, deren Bedeutung oft rätselhaft bleibt, eher auf Distanz gehalten. Diese Wahrnehmung als „kryptische Ausdrucksform“ führt WACŁAWEK zufolge auch dazu, dass Graffiti in der Öffentlichkeit oft mit Vandalismus assoziiert werde (2012: 123).3 Demgegenüber sprechen die Werke der Street-Art eine größere Anzahl von Menschen an. Die figürlichen Formen bieten mehr Spielraum für Interpretationsmöglichkeiten und ermöglichen den Zugang zur Kunst für eine breitere Masse (KRAUSE UND HEINICKE 2006: 60). Street-Art ist damit leichter für Außenstehende verständlich und wird daher auch eher als Kunst anerkannt.
Auch die Graffitiszene selbst grenzt sich in der Regel klar von der Street-Art-Szene ab. In einem Interview mit der Leipziger Graffiticrew RADICALS (Backspin 87/2007) werden die Crewmitglieder gefragt, ob sie an der Entwicklung der Street-Art teilnehmen würden, woraufhin die Writer BLAIR und BIEST Folgendes antworten: „Ich bleibe lieber bei den alten Methoden, schon der Geruch von Sprühlacken macht mich an, das werde ich nicht gegen Leim oder Aufkleber eintauschen.“ BIEST verweist außerdem auf die unterschiedlichen Produktionsvorgänge: „Ich brauche die Aktion. Etwas Gebasteltes irgendwo hinhängen ist doch eher wie Christbaum-Schmücken.“ (Backspin 87/2007: 60)
2.2.5 Zusammenfassung
In einigen Publikationen wird argumentiert, dass sich das Szenegraffiti in eine jahrtausendealte Traditionslinie stellen lässt. Hier wurde hingegen dargelegt, dass sich die steinzeitliche Höhlenmalerei, die Zeichen der mittelalterlichen Reisenden und die politischen Parolen im 19. und 20. Jahrhundert sowohl formal als auch funktional vom modernen Szenegraffiti unterscheiden. Das moderne Szenegraffiti entwickelte sich in den 60er- und 70er-Jahren in den USA, anfänglich beeinflusst durch die zum Teil prekären Lebensbedingungen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Aus den Aktionen einzelner Schreiber entwickelte sich zunehmend eine Bewegung, die sich auch auf weitere amerikanische Städte ausweitete. Indem andere Individuen das Schreiben des eigenen Namens an die Wand als sinnstiftend anerkannten und es auch selbst praktizierten, bildete sich zunehmend eine Szene heraus.
In dieser Arbeit wird ein enger Graffitibegriff zugrunde gelegt, weil die Graffitinamen, die im Fokus dieser Arbeit stehen, erst im modernen Graffiti zum zentralen Gegenstand werden. Es konnte zwar herausgestellt werden, dass Menschen bereits in der Antike und im Mittelalter ihren Namen unautorisiert auf Oberflächen im „öffentlichen Raum“ angebracht haben, allerdings erfolgte dies nicht in Anbindung an eine soziale Gruppe. Zu einer sinnhaften Handlung, die innerhalb eines sozialen Netzwerkes fortlaufend ausgeführt wird, entwickelte sich das Anbringen des Pseudonyms erst mit Entstehung der Graffitiszene. Um nachvollziehen zu können, warum das Herstellen onymischer Graffitis eine sinnhafte Tätigkeit darstellt, werden im folgenden Abschnitt Informationen zur Graffitiszene dargestellt.
2.3 Die Szene
The emergence of individual names and name categories is always based on the cultural and social context. In other words, names are not only part of language; they are part of society and culture, as well. Names are always born in the interaction between people, the linguistic community, and the environment. (AINIALA 2016: 371)
Dieser Aussage aus dem „Oxford Handbook of Names and Naming“ zufolge sind Namen stets eng mit dem sozialen und kulturellen Kontext verbunden, in dem sie entstehen. Bezieht sich diese Aussage von AINIALA auf Namen im Allgemeinen, so ist anzunehmen, dass sie für die Namen im Szenegraffiti sogar eine besondere Gültigkeit besitzt. Denn die Namen sind nicht nur an eine soziale Gruppe – die Szene – gebunden, sondern sie sind für diese Gruppe außerdem von besonderer Relevanz. Es gibt möglicherweise keine andere Jugendszene, in der Namen eine so zentrale Bedeutung einnehmen. Daher ist es wichtig, die soziale Gruppe, die die Namen wählt und im öffentlichen Raum immer wieder sichtbar macht, genauer in den Blick zu nehmen. Die Namen lassen sich nur dann adäquat beschreiben und verstehen, wenn ihre Fundierung in der Graffitiszene berücksichtigt wird.
Dies soll der folgende Abschnitt leisten, in dem die Werte, Sinnschemata und Strukturen der Szene dargestellt werden. Es gilt dabei etwa zu erläutern, wie die Szene organisiert ist, wie der Einstieg in die Szene erfolgen kann und aus welchen Gründen Graffitis hergestellt werden.
2.3.1 Graffiti als Szene
Die Graffiti-Writer bilden eine Art Gesinnungsgemeinschaft, auf die in der Forschung mit Ausdrücken wie „Szene“ (DITTMAR 2009: 101), „Subkultur“ (WACŁAWEK 2012: 55, MACDONALD 2001, REINECKE 2012: 27), „Jugendkultur“ (STEINAT 2007: 21) oder ganz allgemein mit „Bewegung“ („Movement“ SNYDER 2009: 31f.) referiert wird. In dieser Arbeit wird die Bezeichnung Szene verwendet, weil die Graffitiakteure selbst oftmals von einer Szene sprechen, wenn sie auf ihre Gemeinschaft referieren, und weil diese Bezeichnung auch in Magazinen wie „Backspin“ gebraucht wird.1 Gegenüber den eingangs erwähnten, alternativen Bezeichnungen ist Szene außerdem vorzuziehen, weil es – anders als Subkultur – keine Milieuzuweisung und – anders als Jugendkultur – keine Bindung an das Jugendalter impliziert (LAUENBURG 2008: 13).
Eine Szene wird in der soziologischen Forschung verstanden als „[e]ine Form von lockerem Netzwerk; einem Netzwerk, in dem sich unbestimmt viele beteiligte Personen und Personengruppen vergemeinschaften“ (HITZLER UND NIEDERBACHER 2010c: 15). Die Gemeinschaft zeichnet sich in erster Linie dadurch aus, dass alle Beteiligten eine gleiche oder ähnliche Gesinnung teilen (HITZLER UND NIEDERBACHER 2010c: 16). Durch die Vernetzung erhoffen sich die Mitglieder, Verbündete zu finden, mit denen sie szenetypische Praktiken ausführen und Gespräche führen können. Ganz zentral für jede Szene ist dementsprechend ein „Issue“ oder „Thema“, das ebendiese gemeinsame Gesinnung ausmacht (HITZLER UND NIEDERBACHER 2010c: 16). Der Zusammenhalt bezieht sich nicht nur auf die mentale Ebene – die gemeinsame Gesinnung –, sondern wird oft auch nach außen hin sichtbar gemacht, indem die Szenemitglieder eine „kollektive (Selbst-)Stilisierung“ praktizieren (HITZLER UND NIEDERBACHER 2010c: 17).2
Graffiti kann als Szene interpretiert werden, weil mit dem Sprühen von Graffitis ein für alle Akteure zentrales Thema besteht. Dies zeigt bereits ein Blick in die Szenemagazine „Backspin“ und „Juice“, in denen die Interviewten stets in ihrer Rolle als Graffitisprüher auftreten. Ein weiterer Grund, Graffiti als Szene zu bezeichnen, besteht darin, dass sich die Akteure selbst als eine Gemeinschaft von Gleichgesinnten verstehen. Zu dieser Gemeinschaft kann man Zugang erhalten, wenn man sich das szenespezifische Wissen zulegt und bestimmte Fähigkeiten aneignet. Diese Haltung zeigt etwa die Antwort von TRUS von der BAD CREW (Berlin) auf die Frage, wie er und die anderen Mitglieder der Crew gegenüber dem „Nachwuchs“ eingestellt sind:
Nachwuchs ist prinzipiell ne gute Sache. Ich meine irgendwer muss den Job ja irgendwann übernehmen. IRGENDWANN! Jedoch hat das Ganze auch seine Grenzen. Und zwar dort, wo Respektlosigkeit und Leichtsinn Einzug halten. Dort, wo die Toys durch unsere Yards und Layups schlendern und die Leute von der BP auf sich und womöglich auch auf uns aufmerksam machen. […] Wir waren auch nicht die ersten und mussten lernen wie das Game gespielt wird. Aber wir taten es! Sonst wären wir heut nicht da, wo wir sind. (Interview mit der BAD CREW auf ilovegraffiti.de 2010)
Von Neueinsteigern wird demnach erwartet, dass sie sich an den bestehenden Mitgliedern orientieren. Insbesondere das Lexem „Game“ verdeutlicht diese Einstellung: Es gibt Spielregeln, die für eine Teilnahme am „Spiel“ eingehalten werden müssen.
Gleichsam trifft der Aspekt der Selbststilisierung auf Graffitiwriter zu, weil sich die Akteure den Stilen der Szene anpassen. Dies erfolgt im Graffiti weniger über die äußere Erscheinung der Akteure, sondern vielmehr über die Graffitis selbst (SCHNEIDER 2010: 74). Indem sie beispielsweise einen selbstgewählten Namen im öffentlichen Raum hinterlassen, bestimmte Styles aufgreifen oder das typische Vokabular verwenden, weisen sie sich als Mitglieder der Graffitiszene aus.
Von „der Szene“ im Graffiti zu sprechen, ist allerdings zugleich nicht ganz unproblematisch. Der Singular impliziert, dass es ein großes, globales Netzwerk der Writer gibt. Dies ist einerseits zutreffend, denn dass die Akteure auch über Ländergrenzen hinaus stark vernetzt sind, belegen diverse Szeneinterviews, in denen Writer von weltweiten Kontakten berichten. Auch sind die Akteure weltweit durch die Tätigkeit des Graffitiherstellens verbunden. Die Annahme einer großen Szene ist andererseits aber auch stark generalisierend. Nivelliert wird dabei nicht nur die Vielfalt individueller Motive, Formen etc., sondern auch Unterschiede, die das Land oder die Region betreffen bleiben unberücksichtigt. Writer aus Deutschland agieren vor einem anderen soziokulturellen Hintergrund als Akteure aus Mexiko oder den USA und haben daher möglicherweise andere Motive, Ziele etc. Da sich viele wichtige Studien aber gerade auf den amerikanischen Raum beziehen (z.B. MACDONALD 2001) und zwischen dem amerikanischen und dem deutschen Graffiti auch deutliche Parallelen bestehen, erscheint es legitim, diese Ergebnisse an den geeigneten Stellen einfließen zu lassen. Ähnlich vorsichtig ist auch mit den Erkenntnissen älterer wissenschaftlicher Publikationen umzugehen, die sich oft auf die Anfangszeit der Szene beziehen. Es muss nicht nur in den Blick genommen werden, dass die Szene regionale bzw. nationale Unterschiede aufweist, sondern dass sie sich auch mit der Zeit weiterentwickelt hat. „Szenen sind dynamisch“ (HITZLER UND NIEDERBACHER 2010c: 25), weshalb die Erkenntnisse der 80er- und 90er-Jahre nicht unreflektiert auf die Szene der 2000er- und 2010er-Jahre übertragen werden können.
2.3.2 Crews als „Communities of Practice“
Die Vergemeinschaftung, die HITZLER UND NIEDERBACHER als elementares Merkmal von Szenen beschreiben (2010c: 15), wird im Graffiti am deutlichsten, wenn sich Writer zu Kollektiven zusammenschließen und gemeinsame Aktionen durchführen. Bei diesen Interessengemeinschaften handelt es sich um locker organisierte Gruppierungen, die beliebig gegründet und aufgelöst werden können. Sie werden in der Literatur zum Thema Graffiti als „Crews“ (SNYDER 2009, RAHN 2002, REINECKE 2012), seltener auch als „Writing Groups“ (KARL 1986: 47) bezeichnet. Die Crews haben – wie die Sprüher – einen eigenen Namen.
In der amerikanischen Graffitiforschung findet sich ein interessanter Ansatz, bei dem Graffiticrews als „communities of practice“ eingeordnet werden (VALLE UND WEISS 2010: 130, MACGILLIVRAY UND SAUCEDA CURWEN 2007: 355).1 Das Konzept der „Communities of Practice“ ist ursprünglich von LAVE UND WENGER ([1991], 2003) im Rahmen der Lerntheorie entwickelt worden. Als „Communities of Practice“ werden dabei mehr oder weniger feste soziale Gemeinschaften verstanden, in denen sich die Individuen durch die aktive Teilhabe an den Praktiken der Gemeinschaft weiterentwickeln. Die Lerner2 steigen der Theorie nach in eine soziokulturelle Praktik als Neulinge ein und lernen durch Partizipation, um so selbst nach und nach zu vollwertigen Mitgliedern der Gemeinschaft zu werden (LAVE UND WENGER [1991], 2003: 53). Lernen erfolgt in dieser Perspektive weniger mit dem Ziel, neue Aufgaben erfüllen oder Probleme bewältigen zu können, sondern es erfolgt, um die eigene Position innerhalb der sozialen Gruppe zu verändern (LAVE UND WENGER [1991] 2003: 53). Lernen ist demzufolge als sozialer Prozess zu verstehen.3
Das Konzept der „Community of Practice“ lässt sich auf die Graffitiszene insgesamt übertragen, denn diese Gemeinschaft zeichnet sich gerade durch die Praktik aus, Graffitis herzustellen.4 Es lässt sich jedoch – so argumentieren VALLE & WEISS (2010: 129) – auch auf Graffiticrews als kleinere Gruppierungen innerhalb der Szene anwenden. Zu dieser Erkenntnis kamen VALLE UND WEISS durch ihre ethnographische Feldforschung zu Graffiticrews in Mexiko-Stadt:
On crews, learning occurs by participating in a peripheral manner: novices serve as lookouts while the others paint; masters draw the lines, and the others paint the background. Graffiti artists learn by practicing and by reproducing what they saw the masters or more advanced artists do. (VALLE UND WEISS 2010: 134)
In der amerikanischen Graffitiforschung ist auch zu lesen, dass Neulinge mitunter durch einen Mentor in die Szene eingeführt werden, der ihnen die Regeln erklärt und Techniken zeigt (LACHMANN 1988: 234, RAHN 2002: 150).5 Der Mentor ist Lehrer und Vorbild zugleich, dessen Style der Lehrling adaptiert, bevor er eine eigene Stilrichtung entwickelt. Dieses „Lehrlingssystem“ in der amerikanischen Graffitiszene trug auch dazu bei, dass Techniken, Styles und auch ideelle Werte an spätere Sprühergenerationen weitergegeben wurden (DOMENTAT 1994c: 11, CHRISTEN 2003: 63ff.).6 Zu den ideellen Werten, die Szeneeinsteigern vermittelt werden, gehört beispielsweise, dass einige Flächen nicht besprüht werden: Kirchen und andere religiöse Gebäude, Friedhöfe, Statuen, private Autos und Häuser werden nach den „moral codes of the subculture“ ausgespart (FERRELL UND WEIDE 2010: 55).7
Aussagen der Sprüher in Szenemagazinen und weiteren Publikationen zeigen an, dass in der deutschen Graffitiszene z.T. ähnliche Strukturen bestehen. Neulinge werden hier ebenfalls als Toys bezeichnet und üben typischerweise zunächst auf Papier, bevor sie sich an Wänden versuchen.8 Der Berliner Writer DES78 übte etwa ein Jahr lang, bis er seine „ersten Pieces an der Line“ malte (TRUE 2 THE GAME 2003, o.S.). Interviews im „Backspin“-Magazin ist außerdem zu entnehmen, dass sich auch die von VALLE UND WEISS beschriebenen Lern-Lehr-Situationen zwischen geübten Sprayern und Neulingen in der deutschen Szene finden. Der Writer ROCK berichtet beispielsweise davon, wie ihm der Szeneeinstieg durch seinen Lehrer SCORE erleichtert wurde: „Der hat mich mit an die Line genommen und mir gezeigt, wie man malt und wo man Dosen herbekommt.“ (Backspin 91/2007: 70) Von einem Lehrer-Schüler-Verhältnis ist auch bei REINECKE zu lesen: „Es ist typisch, dass ein Anfänger damit beginnt, die Farbfüllungen für seinen Lehrer zu malen.“ (2012: 34) Was LAVE UND WENGER ([1991] 2003) für „Communities of Practice“ im Allgemeinen beschreiben, lässt sich demzufolge vorsichtig auf die deutsche Graffitiszene übertragen: Die Writer nehmen oftmals zunächst eine periphere Position innerhalb der Gemeinschaften ein und professionalisieren sich zunehmend durch Beobachtung und Teilhabe, wodurch nach und nach die Identität als Graffitiwriter geprägt wird. Die ersten Tags bringen Neulinge zumeist im direkten Umfeld ihres Wohnortes an. Mit zunehmender Sicherheit im Umgang mit der Sprühdose vergrößert sich das Aktionsviertel und reicht vom Stadtviertel bis hin zur ganzen Stadt (SCHMITT UND IRION 2001: 41).
Auf Graffiticrews lässt sich ebenfalls übertragen, was LAVE & WENGER für „Communities of Practice“ im Allgemeinen formulieren. Sie gehen davon aus, dass es sich um ein „set of relations among persons, activity, and world, over time and in relation with other tangential and overlapping communities of practice“ handelt (1991: 98). „Communities of Practice“ sind demnach nicht gleichbleibend und beständig, sondern von der jeweiligen Zeit, den Mitgliedern, den Aktivitäten etc. geprägt. Auch Graffiticrews bestehen in wechselnden Konstellationen. Mitglieder verlassen die Gemeinschaften, wenn ästhetische Vorstellungen nicht mehr übereinstimmen, persönliche Differenzen vorliegen oder aus Furcht vor (erneuten) strafrechtlichen Folgen (SCHMITT UND IRION 2001: 20, SCHRÖER 2013: 180ff.). Es werden dann entweder neue Mitglieder aufgenommen oder Crews zugunsten neuer Formationen völlig aufgelöst. Nach SCHMITT UND IRION bestehen die Gruppierungen selten länger als einige Jahre (2001: 20).9 Die Crewzugehörigkeit ist dementsprechend locker geregelt und freiwillig (SCHNEIDER 2012a: 24).10
Es ist durchaus üblich, dass Graffitiakteure verschiedenen Crews angehören und somit in wechselnden Konstellationen arbeiten.11 In der Graffitiszene existieren damit „overlapping communities of practice“ (LAVE & WENGER [1991] 2003: 98). Die Writer taggen dementsprechend auch die Namen verschiedener Crews.12 Trotz Crewzugehörigkeit arbeiten die Akteure auch allein – sie sind bei ihren Aktivitäten nicht an die Gruppe gebunden (SCHNEIDER 2012a: 24). Die Mitglieder der Crews bilden mitunter enge soziale Bindungen aus, was etwa die folgende Aussage des Berliner Writers KOSEM anzeigt, der im Interview auf die Frage antwortet, was ihm seine Crew CRN bedeute:
Na, so wie es bei den meisten ist, ist die Crew mehr für einen, als nur 3 Buchstaben die man neben das Bild malt. Mittlerweile bin ich auch 10 Jahre bei CRN und ich hoffe es werden mindestens nochmal 10. Man identifiziert sich ja irgendwo damit.. Und die Jungs werden mir auch von Jahr zu Jahr symphatischer! (KOSEM auf ilove-graffiti.de 2012)
Nach TAYLOR ET AL. können die Mitglieder ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit entwickeln, was wiederum zu einer Anhäufung von „social capital resources“ führt (2016: 196). Unter „social capital resources“ verstehen die Autoren in Bezug auf die Graffitiszene den andauernden Zugang zu „sociological support networks“, der für eine starke Bindung der Crewmitglieder untereinander sorgt und sie erfolgreich als eine Einheit agieren lässt (2016: 196). Daraus schlussfolgern sie,
that the receipt of social capital support resources not only enhances crew members’ sense of place affinity and sense of belonging, but also their psychological sense of wellbeing. Specifically, by providing the archetypical types of social capital support resources (e.g. reciprocal trust, information sharing, social engagement networks, camaraderie and protection) crews provide their members with an increased sense of purpose, self-worth and group identity […]. (TAYLOR ET AL. 2016: 196)
Die Crewmitglieder können dadurch sogar den Status einer Ersatzfamilie erlangen.13 Dies wird auch dadurch deutlich, dass sie sich – wie Familien in der bürgerlichen Welt – einen gemeinsamen Namen teilen (SCHNOOR 2005: 88). Häufig taggen die Mitglieder ihren Individualnamen und den Crewnamen nebeneinander, was an die Zweigliedrigkeit des bürgerlichen Namensystems aus Ruf- und Familiennamen erinnert (s. Abb. 7).


Abb. 7: Individualname und Crewname werden oft zusammen getaggt (21739, 21769).
Der Zusammenschluss der Writer zu „Communities of Practice“ bietet auch den Vorteil, dass die Mitglieder arbeitsteilig vorgehen können und ihre Fähigkeiten somit zusammenführen. Großflächige Throw Ups und Pieces entstehen dadurch in kürzerer Zeit, was den Bekanntheitsgrad der jeweiligen Crew steigert. Außerdem können sich die Mitglieder bei Aktionen gegenseitig schützen. Die Mitglieder einer Crew werden in den Graffitis auch häufig gegrüßt, indem ihre Namen um den zentralen Schriftzug herum geschrieben werden (vgl. hierzu Abschnitt 7.5.1). Dass es sich dabei um Grüße handelt, markieren Wörter wie „YO“ oder „TO“, was alternativ oftmals als „2“ realisiert ist.


Abb. 8: Grußlisten in Throw Ups bzw. Pieces von 12 (28206) und KORMA (31150), jeweils links neben dem flächig ausgestalteten Namen im Zentrum platziert
Bei Arbeiten im Kollektiv müssen sich die Mitglieder vorher allerdings absprechen und auf die Aufgabenverteilung einigen. Der Writer MENK von den RADICALS aus Leipzig erklärt im Interview mit „Backspin“, wie eine derartige „Aktion“ abläuft:
Bei jeder Aktion versuchen wir vorher alles genau abzusprechen und zu planen, damit das Ganze möglichst professionell und zügig über die Bühne geht. Wir verteilen klare Aufgaben wie Vorziehen, Füllen, Cutten, Backline etc. (MENK in Backspin 87/2007: 59)
Die Aussage von MENK deutet darauf hin, wie gut organisiert Crews bei ihren illegalen Aktivitäten vorgehen.
Darüber, wie viele Akteure bei derartigen Aktionen zusammenwirken und aus wie vielen Writern eine Crew besteht, finden sich in der Literatur nur einige wenige Angaben. TAYLOR ET AL. beziehen sich primär auf die amerikanische Szene und geben an, dass es kleine Crews mit zwei bis fünf Mitgliedern, große Crews mit 20 bis 50 Zugehörigen und sehr große Crews mit 50 bis 100 Personen gibt (2016: 195f.). SCHNEIDER schreibt, dass die Personenzahl der Crews stark variiert und zwischen fünf und 20 Personen liegen kann (2010: 75).14 Nach KARL, der sich auf die deutsche Szene der 90er-Jahre bezieht, gibt es auch Gruppen mit nur zwei Mitgliedern (1986: 47). Selbst Szeneangehörigen fällt eine Schätzung schwer, wie die folgende Aussage des Writers Jörg zeigt:
Innerhalb der lokalen Szenen gibt es […] Crews, das sind, was weiß ich, 10, 20 Leute, die dann unter ihre eigenen Bilder noch ein paar Namen von den Leuten aus der Crew setzen […]. (Writer Jörg zitiert in HITZLER ET AL. 2005: 109)
Diese unterschiedlichen Aussagen deuten darauf hin, dass Crews in ihrer Größe und in ihrer Bestandszeit sehr variabel sind.