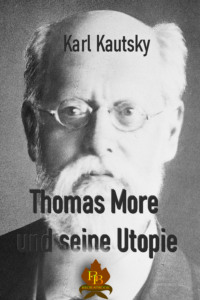Kitabı oku: «Thomas More und seine Utopie», sayfa 3
In Deutschland nahm die Proletarisierung des Landvolkes seit dem Bauernkrieg große Dimensionen an, indes die Entwicklung der kapitalistischen Industrie und einer Kolonialpolitik durch die Veränderung der Wege des Weltverkehrs gehindert wurde. Das Proletariat fand also die Abzugskanäle der Industrie und der Kolonien nicht vor, die es in anderen Ländern wenigstens zum Teile aufsaugten, und mußte sich gänzlich auf Krieg und Räuberei werfen. Dies erscheint uns als eine wichtige Ursache der Dauer des Dreißigjährigen Krieges. Der Krieg wurde möglich durch die massenhaften Proletarier, welche die Soldtruppen lieferten. Der Krieg selbst erzeugte wieder neues Bauernelend, neue Proletarier und damit auch neue Söldner. Die kämpfenden Parteien fanden also das Reservoir von Soldaten nicht eher erschöpft, als bis der Bauer fast völlig verschwunden war. Dann gab's freilich auch keine Soldaten mehr.
Die Not zwang die nicht in den Waffen geübten Arbeitslosen zur Ausbeutung des Mitleids oder der Vertrauensseligkeit besser Situierter. Die Landstreicherei und Gaunerei wurden eine Landplage, Räuber und Diebe machten alle Straßen unsicher.
Vergebens suchte man durch eine furchtbar grausame Blutgesetzgebung die Landstreicherei zu unterdrücken. Arbeitsgelegenheit wurde dadurch nicht geschaffen, die Proletarisierung des Landvolkes dadurch nicht gehindert. Alle Versuche, die Kleinbauern vor den Grundherren zu schützen, erwiesen sich als vergeblich. Das Massenelend und die Massenverwilderung wuchsen trotz aller Gesetze und Erlasse, trotz Galgen und Rad.
3. Leibeigenschaft und Warenproduktion.
Das Schicksal der Bauern, die auf ihren Höfen belassen wurden, war nicht viel besser als das ihrer freigesetzten Brüder. In manchen Gegenden, namentlich Englands, verschwand der Bauer völlig, um durch kapitalistische Pächter ersetzt zu werden, die mit Taglöhnern wirtschafteten, an denen von jener Zeit an kein Mangel war.
Wo die Bauern nicht durch Taglöhner ersetzt wurden, mußten jene es sich gefallen lassen, auf das Niveau der letzteren herabgedrückt zu werden. Im Mittelalter hatte der Feudalherr seiner Bauern bedurft. Je mehr Bauern, desto mehr Macht. Als die Städte mächtig genug wurden, entlaufene Bauern gegen ihre Herren zu schützen, als auch die Kreuzzüge eine Menge Volks außer Landes führten, das des harten Druckes der Leibeigenschaft überdrüssig geworden, und eine allgemeine Bevölkerungsabnahme auf dem Lande eintrat, da mußten die Feudalherren günstige Bedingungen gewähren, um ihre Leute zurückzuhalten und neue anzuziehen. Daher die Verbesserung der Lage der Bauern im dreizehnten Jahrhundert. Vom vierzehnten Jahrhundert an wird der Bauer in steigendem Maße für den Feudalherrn überflüssig, und damit verschlechtert sich seine Lage wieder zusehends. Wenn man ihn nicht verjagt, so deswegen, um den Taglöhner zu ersparen. Die Ländereien des Bauernhofes werden beschnitten, damit das Gebiet der Gutsherrschaft vergrößert werden kann, oft bleibt dem Bauer nichts als eine Hütte und etwas Gartenland. Die Frondienste der Bauern wurden natürlich nicht entsprechend beschnitten. Im Gegenteil, sie wurden ins Ungemessene verlängert. Die Produktion für den Selbstgebrauch hat eine gewisse Grenze, das Bedürfnis der zu Versorgenden, auch dort, wo sie auf der Zwangsarbeit beruht. Der Warenproduktion mit Zwangsarbeit ist dagegen dieselbe maßlose Profitwut eigen wie dem Kapitalismus: Geld kann man nie genug haben. Es fehlt ihr aber die eine Schranke des Kapitalismus, die diesem mitunter fühlbar wird, die Widerstandskraft des freien Arbeiters.
Die Warenproduktion mit Zwangsarbeit ist daher die scheußlichste Form der Ausbeutung. Die orientalische patriarchalische Sklaverei erscheint als eine Idylle gegenüber der Sklaverei, wie sie in den Zucker- und Baumwollplantagen der Südstaaten der Union noch vor wenigen Jahrzehnten herrschte. Und so war auch die Leibeigenschaft der Feudalzeit unvergleichlich milder als die, welche aus der Entwicklung der Warenproduktion erwuchs. (Vergleiche Marx, Kapital, 1. Band, S. 219 [Fabrikant und Bojar].)
Die kapitalistische Produktionsweise in den Städten förderte mitunter die Leibeigenschaft. Der Kapitalismus bedurfte zu seiner Entwicklung massenhafter Zufuhr von Rohstoffen, wie sie damals mitunter nur der landwirtschaftliche Großbetrieb mit Leibeigenen leisten konnte. Die Leibeigenschaft in Europa war in der Tat zu gewissen Zeiten ebenso eine Lebensbedingung für die kapitalistische Produktionsweise, wie später die Sklaverei in Amerika.
Noch 1847 konnte Marx schreiben: »Die direkte Sklaverei ist der Angelpunkt der bürgerlichen Industrie, ebenso wie die Maschinen usw. Ohne Sklaverei keine Baumwolle, ohne Baumwolle keine moderne Industrie. Nur die Sklaverei hat den Kolonien ihren Wert gegeben; die Kolonien haben den Welthandel geschaffen; und der Welthandel ist die Bedingung der Großindustrie.« (Marx, Das Elend der Philosophie, Stuttgart 1885. S. 103.) – Noch vor wenigen Jahrzehnten, während des Sezessionskrieges, erklärten die englischen Kapitalisten die Sklaverei der Südstaaten für eine notwendige Existenzbedingung der englischen Industrie.
Nichts komischer, als wenn Großgrundbesitz und Kapital sich um die Liebe der Arbeiterklasse bewerben: »Ich bin der natürliche Schützer des Arbeiters,« ruft jener; »ich will, daß jeder seine feste Stellung in der Gesellschaft habe, daß es keine Proletarier gebe.« »Höre nicht auf die Lockungen,« ruft der Kapitalist, »ich bin es, der dich aus dem Joche der Leibeigenschaft erlöst hat.«
In Wirklichkeit haben Grundbesitz und Kapital einander nichts vorzuwerfen; nicht nur das Kapital, auch der Grundbesitz hat an der »Befreiung« der Arbeiter von der Scholle mitgearbeitet; andererseits hat auch das Kapital für Leibeigenschaft und Sklaverei geschwärmt, wo es ihm paßte.
4. Die ökonomische Überflüssigkeit des neuen Adels.
Die Entwicklung der Warenproduktion führte dazu, daß die Formen des Feudalismus zur größtmöglichen Ausbeutung des ländlichen Arbeiters ausgenutzt wurden, den man kaum mehr Bauer nennen kann.
Indes die Ausbeutung des Leibeigenen wuchs, schwand die Notwendigkeit des Feudaladels rasch dahin. Im Mittelalter hatte nicht nur der Feudalherr zu seiner Erhaltung des Bauern bedurft, sondern dieser auch des Feudalherrn, der ihn vor Vergewaltigung schützte, ihm einen Teil seiner gerichtlichen und administrativen Pflichten gegenüber dem Gemeinwesen abnahm und ihn vor allem von der erdrückenden Last des Kriegsdienstes befreite.
Mit der Entwicklung des modernen Staates wurden die Gründe immer hinfälliger, die den Bauer im Anfange des Mittelalters in die Abhängigkeit trieben. Je stärker die staatliche Zentralgewalt wurde, je mehr die Polizei die inneren Fehden unterdrückte und der Adel aufhörte, eine selbständige militärische Macht zu besitzen, desto überflüssiger wurde es für den Bauern, einen Herrn zu haben, der ihn gegen die Mächtigen schützte. Der Schutz- und Schirmherr wurde jetzt derjenige, gegen den er des meisten Schutzes bedurfte.
Der Feudalherr hatte dem Bauer die Last des Kriegsdienstes abgenommen und sie auf sich geladen. Der moderne Staat nahm sie dem Feudalherrn ab und lud sie wieder dem Bauer auf. An Stelle des Ritterheers trat, wie schon erwähnt, das Söldnerheer, das sich aus Bauern rekrutierte: entweder aus den zugrunde gegangenen oder, sobald diese Quelle schwächer floß, aus den noch seßhaften Bauern. Aus der Werbung wurde bald eine wenig verblümte Pressung. Der Bauer war es auch, dem die Erhaltung des Heeres zufiel; die Soldaten wurden bei ihm einquartiert, und zu den Abgaben an Adel und Kirche gesellten sich die Geldabgaben an den Staat, hauptsächlich zur Erhaltung des Heeres. Wohl prahlte der Adel nach wie vor, daß er der zur Verteidigung des Vaterlandes auserkorene Stand sei, aber seine ganze Ritterlichkeit bestand jetzt darin, daß er sich die gut bezahlten Offiziersstellen vorbehielt.
Auch an der Landesverwaltung und Gerichtsbarkeit hatte der Grundbesitz immer weniger Anteil; sie fielen immer mehr der Bureaukratie zu, zu deren Erhaltung der Bauer natürlich auch beitragen mußte. Was sich von der alten feudalen Gerichtsbarkeit in den Patrimonialgerichten noch erhielt, wurde nur ein neuer Hebel zur Vermehrung der Ausbeutung.
Von allen Diensten, die der Adel einst dem Bauer erwiesen und wofür dieser ihm seine Gegenleistungen abstattete, blieb keiner übrig, indes die Leistungen des Bauern maßlos ausgedehnt wurden.
Schließlich wurden die feudalen Lasten und Schranken zu einer wahren Fessel der Produktion, welche dringend danach verlangte, daß die ländliche Warenproduktion den feudalen Charakter gänzlich abstreife. Die feudale Aneignungsweise geriet in Widerspruch mit den Forderungen der Produktionsweise. Der feudale Adel, längst überflüssig geworden, wurde von diesem Punkte an entschieden schädlich, seine Beseitigung ein Gebot der Notwendigkeit.
Wir können auf diese weitere Entwicklung hier nicht näher eingehen, da in dem von uns behandelten Zeitraum nur ihre Anfänge sichtbar werden. Der erste und, wenn auch nicht der Form, so doch dem Endziel nach, schüchterne Protest gegen diese Anfänge des eben gekennzeichneten modernisirten, den Bedürfnissen der Warenproduktion angepaßten Feudalismus waren die Bauernkriege. Sie bildeten gleichzeitig eine der letzten krampfhaften Zuckungen der ersterben-den Markgenossenschaft; sie waren aber auch die Vorläufer der großen Revolution von 1789.
5. Das Rittertum.
Zwischen dem großen Adel und den Bauern stand der niedere Adel, die Ritter, zum großen Teil Nachkommen der alten, gemeinfreien Bauern, die infolge günstiger Umstände ihre Freiheit zu wahren gewußt hatten. Dem Lehndienst an einen Mächtigeren hatten sie sich freilich nicht entziehen können, aber sie waren frei von grundherrlichen Leistungen und Abgaben. (G.L.v. Maurer, Einleitung zur Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt. München 1854. S. 236 ff.)
Der Ritter stand zwischen dem großen Grundherrn und dem Bauern, wie heute der Kleinbürger zwischen dem Kapitalisten und dem Arbeiter steht. Und er spielte auch eine ähnliche schwankende Rolle, ging heute mit den Bauern gegen die Fürsten, um morgen mit den Fürsten gegen die Bauern zu gehen, sobald diese gefährlich wurden. Der Typus dieses Rittertums ist Götz von Berlichingen. Natürlich fehlte es auch nicht an Rittern, die mit vollem Herzen für die Sache der Bauern eintraten: wer hat nicht schon von Florian Geyer gehört? Aber in der Mehrzahl blieben sie unzuverlässig. Selbst Huttens Stellung gegenüber den Bauern war keine entschiedene.
Ob das Rittertum für die Sache der Bauern oder der Grundherren eintrat, sein Untergang als selbständige Klasse war nicht aufzuhalten. Entweder gelang es dem Ritter, in die Klasse der großen Grundherren aufzusteigen, seine Güter so sehr zu erweitern, daß er zur Warenproduktion übergehen konnte, oder sein Grundbesitz wurde bedeutungslos, oft die Beute eines mächtigen Nachbarn, stets unzureichend, dem Ritter einen »standesgemäßen« Unterhalt zu gewähren. Dieser war gezwungen, von der Bildfläche als Grundbesitzer zu verschwinden und in den Städten sein Fortkommen zu suchen als Kaufmann oder, was für weniger entwürdigend galt, als Literat im Gefolge eines großen Herrn, namentlich aber als eine Art höherer Lakaien und Leibgardisten des Fürsten. Der Ritter wurde zum Höfling oder zum Landsknecht.
In Spanien, England und anderen Ländern eröffnete die Kolonialpolitik dem niederen Adel eine willkommene Gelegenheit, sein Ideal zu erreichen: ohne Arbeit reich zu werden. Das Faustrecht, das man ihm daheim legte, gelangte in den Kolonien und im Seeraub zu hoher Blüte.
Neben dem Kaufmann war der niedere Adel eine wichtige Triebkraft der Kolonialpolitik.
Natürlich vollzog sich die Anpassung des niederen Adels an die neue Produktionsweise ebensowenig ohne schwere Konvulsionen, als die anderen sozialen Umwandlungen der Reformationszeit. Hartnäckig strebte das Rittertum danach, seine Selbständigkeit aufrecht zu erhalten, was jedoch nur möglich war, wenn die feudale Produktionsweise in ihrer ursprünglichen Form fortbestehen blieb. Dabei nahm aber das Rittertum die Bedürfnisse an, welche die Entwicklung der Warenproduktion in den herrschenden Klassen geweckt: die Ansprüche des Rittertums an das Leben wurden immer größer, die Möglichkeit, ihnen auf dem Boden der feudalen Produktionsweise zu genügen, immer geringer. Wenn andererseits das Rittertum die Lebensweise der Feudalzeit fortsetzen wollte, geriet es immer mehr in Gegensatz zu den tatsächlichen Verhältnissen.
Der Kontrast zwischen Wollen und Können beim Rittertum ward immer schärfer, er bildete eine der charakteristischsten Eigentümlichkeiten der Anfänge der Neuzeit. Dieser Kontrast nahm oft eine tragische Gestalt an, aber dem damaligen städtischen Literatentum, das den neuen Geldmächten zujauchzte, erschien er nicht so. Der Ritter war neben dem Mönch und dem Bauern der Vertreter der alten, feudalen Produktionsweise. Jeder dieser drei Stände wurde von der Bevölkerung der großen Städte, in denen sich das geistige Leben konzentrierte, gehaßt und verachtet. Aber das Bürgertum, solange es revolutionär war, hatte nichts von Rührseligkeit und Heuchelei an sich. Moralische Entrüstung war die Waffe, die es am seltensten anwendete. Es bekämpfte seine Gegner durch Spott und Hohn. Der dumme Bauer, der geile Pfaffe, der verkommene bettelstolze Ritter gehören zu den Lieblingsfiguren der Literatur der Renaissance und ihrer Ausläufer.
Wir treffen sie zuerst in Italien, wo die neue Produktionsweise sich am frühesten entwickelt, bald aber werden diese Figuren in der Literatur von ganz Europa heimisch. Vom Dekameron (erschien 1352 oder 1353) des Boccaccio bis zum Don Quixote (erschien 1604) des Cervantes zieht sich eine lange Reihe von Dichtungen, in denen bald der eine, bald der andere, bald alle drei genannten Stände dem Gelächter preisgegeben werden.
Der größte Teil dieser Literatur ist heute vergessen. Zwei Figuren unter den vielen, welche die lachende Grabrede des Rittertums bildeten, sind aber heute noch jedermann bekannt, sie sind, für unsere Begriffe, unsterblich geworden: Don Quixote und Falstaff.
Die »Lustigen Weiber von Windsor« (geschrieben 1602) erscheinen heute den meisten als ein sehr harmloses Lustspiel, aber es ist ein erbitterter Klassenkampf, der da mit genialem Humor travestiert wird. Ob Shakespeare mit dem Lustspiel eine politische Tendenz verfolgte, wissen wir nicht; aber er zeichnete, was er sah, den Kampf zwischen dem niedergehenden Rittertum, das sich nicht dem bürgerlichen Rahmen anpassen will, und dem aufstrebenden Bürgertum dessen Weiber klüger und tapferer sind, als die Ritter ohne Furcht und Tadel. Die »Lustigen Weiber von Windsor« sind der übermütige Jubelruf der siegreich vordringenden Bourgeoisie.
Drittes Kapitel. Die Kirche.
1. Die Notwendigkeit und Macht der Kirche im Mittelalter.
Die in den vorigen Kapiteln angedeuteten Klassengegensätze nahmen im Laufe der Entwicklung die verschiedensten Gestalten an, sie wechselten von Zeit zu Zeit und von Ort zu Ort und kombinierten sich je nach den äußeren Einflüssen, den historischen Traditionen, dem Stande der Erkenntnis und den augenblicklichen Interessen in der mannigfachsten Art. Aber wie verworren dadurch die Geschichte des fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts auch erscheinen mag, ein roter Faden zieht sich klar erkennbar durch sie und gibt dieser Zeit ihre Signatur: der Kampf gegen die päpstliche Kirche. Man verwechsle nicht die Kirche mit der Religion. Von dieser werden wir später handeln.
Die Kirche war die vorherrschende Macht der Feudalzeit gewesen: mit dem Feudalismus mußte auch sie zusammenbrechen.
Als die Germanen in das römische Weltreich eindrangen, da trat ihnen die Kirche entgegen als Erbe der Cäsaren, als die Organisation, die den Staat zusammenhielt, als der Vertreter der Produktionsweise des Ausgangs der Kaiserzeit. So erbärmlich auch dieser Staat war, so herabgekommen auch die Produktionsweise, beide waren den politischen und ökonomischen Zuständen der barbarischen Germanen weit überlegen. Diese überragten moralisch und physisch das verkommene Römertum, aber es nahm sie gefangen mit seinem Wohlleben, seinen Schätzen. Der Raub ist keine Produktionsweise, wenn auch manche Ökonomen das zu glauben scheinen. Die bloße Plünderung der Römer konnte die Germanen auf die Dauer nicht befriedigen, sie fingen an, nach Art der Römer zu produzieren. Je mehr sie das taten, desto mehr aber gerieten sie unvermerkt in die Abhängigkeit von der Kirche, denn diese war ihre Lehrmeisterin; desto notwendiger wurde eine dieser Produktionsweise entsprechende staatliche Organisation, die wieder keine andere Macht schaffen konnte, als die Kirche.
Die Kirche lehrte die Germanen höhere Formen des Landbaus – die Klöster blieben bis spät ins Mittelalter die landwirtschaftlichen Musteranstalten. Geistliche waren es auch, die den Germanen Kunst und ausgebildetes Handwerk brachten; unter dem Schutze der Kirche gedieh nicht nur der Bauer, sie schirmte auch die Mehrzahl der Städte, bis diese stark genug waren, sich selbst zu schützen. Der Handel wurde von ihr besonders begünstigt.
Die großen Märkte wurden meist in oder bei Kirchen abgehalten. In jeder Weise sorgte die Kirche dafür, Käufer zu solchen Märkten heranzuziehen. Sie war auch die einzige Macht, die im Mittelalter für die Erhaltung der großen Handelsstraßen sorgte und durch die Gastfreundschaft der Klöster das Reisen erleichterte. Manche derselben, zum Beispiel die Hospitze auf den Alpenpässen, dienten fast ausschließlich der Förderung des Handelsverkehrs. So wichtig erschien dieser der Kirche, daß sie sich zu dessen Belebung mit dem zweiten Faktor verbündete, der neben ihr die Kultur des untergegangenen römischen Reiches in den germanischen Staaten vertrat: dem Judentum. Die Päpste haben dieses lange Zeit hindurch geschützt und gefördert. Überhaupt wurden die Juden zur Zeit, als die Deutschen noch unverfälschte Germanen waren, als Bringer einer höheren Kultur freudig aufgenommen und eifrig herbeigezogen. Erst als die christlich-germanischen Kaufleute selbst das Schachern ebensogut verstanden wie die Juden, wurden sie Judenverfolger.
Daß das ganze Wissen des Mittelalters allein in der Kirche zu finden war, daß sie die Baumeister, Ingenieure, Ärzte, Historiker, Diplomaten lieferte, ist allbekannt.
Das ganze materielle Leben der Menschen und damit auch ihr geistiges war ein Ausfluß der Kirche: kein Wunder, daß sie auch den ganzen Menschen gefangen nahm, daß sie nicht nur sein Denken und Fühlen bestimmte, sondern auch all sein Tun und Lassen. Nicht nur Geburt, Ehe, Tod gaben ihr Anlaß einzugreifen, auch die Arbeit und die Feste wurden von ihr geregelt und kontrolliert.
Die ökonomische Entwicklung machte aber die Kirche nicht nur notwendig für den einzelnen und die Familie, sondern auch für den Staat.
Wir haben schon darauf hingewiesen, daß der Übergang der Germanen zu einer höheren Produktionsweise, zum entwickelten Ackerbau und zum städtischen Handwerk, auch die Entwicklung eines ihr entsprechenden Staatswesens notwendig machte. Aber der Übergang der Germanen zur neuen Produktionsweise ging zu rasch vor sich, namentlich in den romanischen Ländern Italien, Spanien, Gallien, wo sie sie fertig und bei der eingeborenen Bevölkerung fest eingewurzelt vorfanden, als daß es ihnen möglich gewesen wäre, die neuen Staatsorgane aus ihrer urwüchsigen Verfassung zu entwickeln. Der Kirche, die sich schon im verfallenden Kaiserreich zu einer politischen Organisation entwickelt hatte, die den Staat zusammenhielt, fielen jetzt die staatlichen Funktionen fast ausschließlich zu. Sie machte den Germanenhäuptling, den demokratischen Volksvorsteher und Heerführer zum Monarchen: aber mit der Macht des Monarchen über das Volk stieg auch die Macht der Kirche über den Monarchen. Er wurde ihre Puppe, die Kirche aus einer Lehrerin zur Herrscherin.
Die mittelalterliche Kirche war wesentlich eine politische Organisation. Ihre Ausdehnung bedeutete die Ausdehnung der Staatsmacht. Die Gründung eines Bistums in einem heidnischen Lande durch einen Monarchen bedeutete nicht etwa bloß, daß damit die Mittel verstärkt wurden, den Heiden alle möglichen Glaubensartikel und Gebete beizubringen: um eines solchen Zweckes willen hätte weder Karl der Große die fränkischen Bauern ruiniert und unzählige Sachsen erschlagen, noch hätten die Sachsen, in Glaubenssachen tolerant, wie meist die Heiden, dem Christentum den jahrzehntelangen zähen Widerstand bis zur äußersten Erschöpfung entgegengesetzt. Die Gründung eines Bistums in einem heidnischen Lande bedeutete die Verbreitung der römischen Produktionsweise daselbst und seine Einverleibung in den Staat, der das Bistum gründete.
Je mehr die Produktionsweise der Germanen die Stufe erklomm, auf die sie im Römerreiche zur Zeit seines Sturzes herabgesunken war, desto unentbehrlicher wurde die Kirche für Staat und Volk. Sie war für beide nützlich, damit ist aber nicht gesagt, daß sie ihre Stellung im Interesse der von ihr abhängigen Elemente und nicht im eigenen Interesse benutzt hätte. Sie ließ sich ihre Dienste teuer bezahlen: die einzige allgemeine Abgabe, die das Mittelalter kennt, der Zehnte, floß ihr zu. Die wichtigste Quelle von Macht und Einkommen war aber im Mittelalter, wie wir bereits gesehen, das Grundeigentum. Die Kirche entwickelte den gleichen Hunger nach Land und Leuten wie der Adel, suchte, so wie dieser, Land zu erwerben und untertänige Leute zu gewinnen. Den Grundbesitz, den die Kirche im römischen Reich besessen hatte, ließen ihr meist die germanischen Einwanderer; wo nicht, wußte sie ihn bald wieder zu gewinnen, und oft noch etwas dazu. Die Kirche bot den gleichen, ja oft noch größeren Schutz als der Adelige, daher gaben sich ihr viele Bauern zu eigen. Die Kirche führte die Staatsverwaltung, Geistliche waren die Räte der Könige. Kein Wunder, daß diese sich oft beraten ließen, aus dem Krongut das Eigentum der Kirche zu mehren. In eroberten heidnischen Landen war die reichliche Ausstattung von Klöstern und Bistümern mit Grundeigentum geradezu ein Gebot der Notwendigkeit. Überdies war die Kirche die einzige Macht, welche das Königtum dem Adel entgegensetzen konnte; wurde dieser zu übermütig, dann wußte jenes keinen anderen Rat, als ihn dadurch zu schwächen, daß es ihm einen Teil seines Grundbesitzes entzog und der Kirche als eigen oder als Lehen gab. Und wo die Kirche konnte, da wartete sie nicht, bis es Bauern, König und Adel beliebte, ihren Grundbesitz zu mehren, sondern nahm, was sie nehmen konnte und rechtfertigte, wenn zur Rede gestellt, den Raub durch eine gefälschte Schenkungsurkunde. War doch die Geistlichkeit allein des Schreibens und Lesens kundig! Urkundenfälschungen waren im Mittelalter ein ebenso gewöhnliches Mittel zur Legitimierung einer Grunderwerbung als heute wucherische Darlehen, Prozesse und dergleichen. Der Benediktiner Dom Veyssière im achtzehnten Jahrhundert behauptete, unter 1200 Verleihungsurkunden, die er in der Abtei Landevenecq in der Bretagne untersuchte, seien 800 entschieden falsch. Er getraute sich nicht zu sagen, wieviel von den 400 anderen echt seien.
Es schien, als sollte die Kirche der alleinige Grundeigentümer in der ganzen Christenheit werden. Indessen war dafür gesorgt, daß die Bäume nicht in den Himmel wuchsen. Der Adel war der Kirche immer feind; wuchs deren Grundbesitz zu sehr, dann bekam auch das Königtum Angst vor ihrer Übermacht und suchte sie mit Hilfe des Adels einzuschränken. Auch die Einfälle von Heiden und Mohammedanern schwächten in erster Linie die Kirche. Drastisch hat Montesquieu dieses Auf- und Abwogen der Kirchenmacht, dieses wechselnde Ausdehnen und Zusammenschrum-pfen der Kirchengüter in Frankreich beschrieben: »Die Geistlichkeit bekam so viel, daß man ihr unter den drei französischen Dynastien (Merowinger, Karolinger und Capetinger) mehrere Male alte Güter des Königreichs geschenkt haben muß. Allein wenn die Könige, der Adel und das Volk Mittel fanden, den Geistlichen alle ihre Güter zu schenken, so fanden sie deren nicht minder, sie ihnen wieder zu nehmen. Die Frömmigkeit bewirkte unter den Merowingern die Stiftung einer Menge von Kirchen; allein der kriegerische Geist veranlaßte ihren Übergang in den Besitz der Kriegsleute, welche sie wieder unter ihre Kinder verteilten. Wie viele Ländereien büßte nicht die Geistlichkeit in dieser Weise ein! Die Karolinger taten gleichfalls ihre Hände auf und setzten ihrer Freigebigkeit weder Maß noch Ziel. Da kommen aber die Normannen, rauben und plündern, verfolgen vor allem die Priester und Mönche, suchen die Abteien auf und sehen sich überall um, wo sie irgend einen geweihten Ort finden können. ... Wie viele Güter mußte nicht die Geistlichkeit bei solchem Stande der Dinge einbüßen! Kaum waren noch Geistliche übrig, um ihr Eigentum zurückzufordern. Der Frömmigkeit der Capetinger blieb also wieder Gelegenheit genug, Stiftungen zu machen und Ländereien zu verschenken. ... Die Geistlichkeit hat immer erworben, immer wieder herausgegeben und erwirbt noch jetzt.« (Montesquieu, Geist der Gesetze, 31. Buch, 10. Kapitel.)
Die Ausdehnung eines so wechselnden Eigentums in einer Zeit, die von statistischen Aufzeichnungen keine Idee hatte, ist schwer zu bestimmen. Im allgemeinen kann man sagen, daß im Mittelalter ein Drittel des Grundbesitzes in den Händen der Kirche war.
In Frankreich wurden Aufzeichnungen über die Kirchengüter während der französischen Revolution gemacht. Diesen zufolge war die Kirche besonders reich in den seit 1665 annektierten Provinzen. Sie besaß an Grundeigentum im Cambrésis 14/17, desselben, im Hennegau und Artois drei Vierteile, in der Franche-Comté, Roussillon und dem Elsaß die Hälfte, in den anderen Provinzen ein Drittel oder mindestens ein Viertel des Grundbesitzes (Louis Blanc, Histoire de la revolution française. Brüssel 1847. 1. Band, S. 423.) Seit der Reformation hatte sich der Grundbesitz der Kirche in den französischen Ländern kaum erheblich verändert.
Die kolossale Ausdehnung des kirchlichen Grundbesitzes in Deutschland kann man daraus ersehen, daß noch 1786 die reichsunmittelbaren geistlichen Territorien 1424 Quadratmeilen umfaßten. Die ausgedehnten Besitzungen der Kirche in weltlichen katholischen Staaten, wie Bayern und Österreich, sind da ebensowenig gerechnet wie die, welche in den protestantischen Ländern säkularisiert worden waren.
Der Grundbesitz der Kirche war ein Ergebnis ihrer ökonomischen und politischen Machtstellung. Er führte seinerseits wieder eine Erweiterung dieser Macht mit sich.
Wir haben schon früher darauf hingewiesen, welche Macht der Grundbesitz im Mittelalter verlieh. Alles das darüber Gesagte gilt in verstärktem Maße für die Kirche. Ihre Güter waren die bestangebauten, die dichtestbevölkerten, ihre Städte die blühendsten, das Einkommen und die Macht, die sie aus beiden zog, daher größer, als ein gleich großer Grundbesitz dem Adel oder dem Königtum verlieh. Aber dies Einkommen bestand großenteils in Naturalien, was mit diesen anfangen? So wohl sich's auch die Herren Mönche und sonstigen Kleriker geschehen ließen, alles, was ihnen zufloß, konnten sie nicht verzehren. Wohl hatten Äbte und Bischöfe im Mittelalter Fehden auszufechten, gleich weltlichen Herren, wohl mußten sie gleich diesen ein reisiges Gefolge halten und sehr oft auch Lehensdienste leisten, aber so kriegerisch war die Kirche doch selten, daß der größte Teil ihrer Einkünfte von ihrer streitbaren Macht aufgezehrt worden wäre. Das Mittel, womit sie siegte, war weniger ihre physische als ihre geistige Überlegenheit, ihre ökonomische und politische Unentbehrlichkeit. Sie hatte für Kriegszwecke weniger auszugeben als der Adel, sie nahm mehr ein als dieser. Nicht nur war ihr Grundbesitz ergiebiger, ihr fiel auch der Zehnte zu von dem ihr nicht unterworfenen Grundbesitz. Sie hatte daher ein geringeres Interesse als der Adel, die Ausbeutung ihrer Untertanen übermäßig hoch zu schrauben. Sie war im allgemeinen milde gegen diese: unter dem Krummstab war es wirklich gut wohnen, wenigstens besser als unter dem Schwerte eines kriegs- und jagdlustigen adeligen Herrn. Trotz dieser verhältnismäßigen Milde verblieb den verschiedenen kirchlichen Institutionen doch noch ein Überschuß an Lebensmitteln, und diesen wußten sie nicht anders zu verwenden als zur Armenpflege.
Die Kirche hatte hier, wie in vielen anderen Punkten, nur an ihre Traditionen aus der Kaiserzeit anzuknüpfen. Im sinkenden Römerreich war der Pauperismus immer mehr und mehr angewachsen, die Armenunterstützung eine immer dringendere Aufgabe für den Staat geworden. Aber der alte, heidnische Staat war auf deren Lösung nicht eingerichtet; sie fiel der neuen, von den veränderten Verhältnissen hervorgerufenen und ihnen entsprechenden Organisation zu, der Kirche. Die Armenpflege, wie sie der ökonomische Zustand gebot, wurde zu einer ihrer wichtigsten Funktionen, und ihr hatte sie nicht zum mindesten das rasche Anwachsen ihrer Macht und ihres Reichtums zu verdanken. Die immer notwendiger werdenden und immer wachsenden wohltätigen Stiftungen von Privaten, Gemeinden, des Staates selbst wurden der Geistlichkeit zur Verwaltung überwiesen oder direkt geschenkt. Je mehr die Masse der Besitzlosen zunahm, desto größer der Besitz der Kirche, desto größer die Abhängigkeit der Besitzlosen von ihr, und da diese einen immer größeren Teil des Volkes ausmachten, desto größer ihr Einfluß auf das gesamte Volk.
So wie die Schenkungen hatten auch die regelmäßigen Abgaben an die Kirche zum großen Teil den Zweck, der Armenunterstützung zu dienen. Beim Zehnten war es ausdrücklich vorgeschrieben, daß er in vier Teile zu teilen sei: einer solle dem Bischof, einer der niederen Geistlichkeit zufallen, einer für den öffentlichen Gottesdienst und einer zur Erhaltung der Armen verwendet werden.