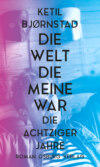Kitabı oku: «Die Welt, die meine war», sayfa 11
Aber jetzt hat sie sich zusammengezogen. Liegt das an meinem Alter, oder hat sich das Tempo gesteigert? Ich verfolge die Landung der ersten Raumfähre in der Weltgeschichte, das amerikanische Raumfahrzeug Columbia, das aussieht wie ein Flugzeug oder wie ein überdimensionaler Privatjet. Aber dem Flugzeug fehlen Motoren, die mehrere Landeversuche ermöglichen würden. Es segelt in seinem wilden Tempo durch die Atmosphäre und muss beim ersten Versuch die Landebahn treffen! Die Landebahn auf einem ausgetrockneten Salzsee in der Mojave-Wüste. Ach, Mads fehlt mir ja so sehr! Wenn wir noch immer dort stünden, an der Straßenbahnhaltestelle Smestad, würde ich ihn fragen, wieso eine Raumfähre, die hundertmal in den Raum geschossen werden kann, nicht auch Jetmotoren besitzt, die ihr bei der Landung einen etwas größeren Spielraum eröffnen würden. Warum muss es immer ein Gefahrenmoment geben? Und Mads würde antworten, mit seinen Locken und dem altklugen Gesicht, es sei eben das Leben selbst, dass es in jeder Raumfähre, in jedem Leben ein Gefahrenmoment geben muss, dass die Sowjets das hier aber jedenfalls besser geschafft hätten. Ja, dachte ich, dort in meinem Sessel auf Sandøya, an jenem Apriltag des Jahres 1981, Mads hätte vorausgesehen, wie abhängig die USA schließlich von der sowjetischen Raumfahrttechnologie werden würden, dass sie die Abschusssysteme der schrecklichen, bösen, stinkenden, alkoholisierten und lebensgefährlichen Altkommunisten verwenden müssten, an dem Tag, an dem es diese Raumfähren nicht mehr gab. Und es geschieht gerade jetzt, während ich das hier schreibe, dass Russland abermals gefährlicher ist als je zuvor. Der böse Putin, oben ohne hoch zu Ross. Der herzensgute Obama, mit dem Golfschläger auf dem Rasen.
Das Imperium schlägt zurück.
Und Mads war tot.
Aber an diesem Tag saß ich auf Sandøya und Mads lebte noch. Wir waren keine Freunde mehr. Auch keine Feinde. Wir begegneten uns nur nie. Mads war ein millionenschwerer Jurist und besuchte sicher nur die exklusivsten Restaurants. Ich selbst saß im 17. Mai-Komitee von Sandøya. Und ich konnte ihn nicht fragen, wie ich ihn in alten Tagen gefragt hatte, ob es wirklich stimmte, dass der Umlauf der Sonne um das Zentrum der Galaxis 220 Kilometer in der Sekunde betrug, also 792 000 Kilometer in der Stunde? Ob es stimmte, dass die Geschwindigkeit der Erde um die Sonne ihr eigenes Tempo von 107 200 Stundenkilometern hatte? Der pure Wahnsinn, würde ich sagen. Und aus Protest gegen diese abnormen Zahlen würde ich behaupten, mit Fug und Recht und mit meinem Hintergrund aus der Waldorfschule, die Erde sei eine Scheibe. Dass ich nicht glaubte, dass Menschen, die selbst einmal Säuglinge gewesen waren und auf einem Stuhl mit Sperren und Gittern gesessen hatten und mit Brei gefüttert worden waren, jemals erwachsen genug werden könnten, um mit voller Überzeugung behaupten zu können, dass wir alle von diesem wahnwitzigen Tempo erfasst waren, während uns die Behörden zwangen, mit dem Auto nicht mehr als 80 Stundenkilometer zu fahren. Etwas hier stimmte nicht. Und dennoch jubelte ich in einem Glücksrausch, als ich sah, dass John Young und Robert Crippen es schafften, diesen seltsamen und fast komischen Privatjet beim ersten Versuch in der Mojave-Wüste zu landen. Diese wissenschaftliche Leistung lenkte die Aufmerksamkeit von den Rassenunruhen in Brixton ab, diesem explosiven Minengelände mit vielen Schwarzen, sehr vielen Einwanderern aus Bangladesch, die fanden, für das, was sie taten, nicht ausreichend bezahlt zu werden, die nicht einmal etwas tun durften, und die zur äußersten Armut gezwungen wurden. Von Sandøya aus sah er die Welt, las er, dass François Mitterrand in Frankreich zum Präsidenten gewählt worden war, dass es in Oslo zu Straßenschlachten gekommen war, in der Nacht zum 1. Mai, dass Polizeichef Willy Haugli kein Mann der Jugend war. Er saß vor seinem guten und getreuen 22-zölligen Philips-Fernseher und sah das aufgebrachte Gesicht des Bürgermeisters Albert Nordengen, der ausrief: »Ich hätte so etwas nicht für möglich gehalten! Ich bin wirklich schockiert!« Er telefonierte mit seiner Mutter und hörte sie sagen, wie so oft: »Bitte sehr, verliert den Verstand!« Er hörte zugleich Angst in ihrer Stimme. Weil sich die Welt veränderte, sich schneller drehte. Reichte es nicht, dass Sonne und Erde ein solches verdammtes Tempo vorlegen? Sie fand es schrecklich, dass der 23 Jahre alte Rechtsextremist Mehmet Ali Ağca in vollem Ernst auf den Papst geschossen hatte in der Hoffnung, ihn zu töten. Es interessierte sie weniger, dass der Papst der Papst war, als dass er eine Vergangenheit als Lyriker hatte. »Man darf doch keinen Poeten umbringen«, sagte sie energisch, die alte Buchhandelsgehilfin.
Ich werde ins Weltgeschehen hineingesaugt, obwohl ich mich so weit davon entfernt angesiedelt habe wie überhaupt nur möglich. Ich war monatelang von dem Fall des Yorkshire Ripper besessen. Nun wird endlich der 34 Jahre alte Peter Sutcliffe für die dreizehn Morde verurteilt. Dreizehn Frauen, denke ich. Wie wahnsinnig kann man werden?
Ich jogge über die Insel. Warum jogge ich? Einige Monate zuvor wählte ich die Nummer der Polizei von Yorkshire. Sie hatten eine Tonbandaufnahme der Stimme des Mörders zugänglich gemacht. Damals wussten sie noch nicht, dass er Sutcliffe hieß. Aber selbst draußen auf Sandøya mochten die Frauen nicht allein im Dunkeln über die schmalen Wege gehen. Ich lauschte der Stimme, hoffnungslos neugierig, als ich unten in meinem Keller saß und die Andere schlafen gegangen war: »I’m Jack. I see you’re having no luck catching me. I have the greatest respect for you, George, but Lord, you’re no nearer catching me now than you were years ago, when I started.« Die gänsehauterregende Nähe in dieser Stimme, als säße er gleich neben mir. Ich dachte an die Frauen, die er ermordet hatte. Wie hießen sie überhaupt? Wilma McCann, Emily Jackson, Irene Richardson usw. Ich dachte an die unheimlichen alten Freitagskrimis im NRK. Den Schock, als ich das Gesicht eines toten Menschen sah, obwohl es doch eine Schauspielerin war, die diese Rolle spielte. Mutter, die mich trösten musste. Dieses Urbritische. Eine Frau allein auf einem dunklen Weg. Ein Mann, der sie einholt, sie niederschlägt, sie erstickt oder erwürgt.
Der Yorkshire Ripper.
Ich träume nachts von ihm. Ich lese alles, was ich in den Zeitungen über ihn finden kann. Wieso beschäftigt er mich dermaßen?
Plötzlich überkommt mich die Angst vor der Dunkelheit. Ich werde von etwas eingeholt. Aber was ist das? Ich laufe nach Hella hinaus. Es ist frühlingsdunkel. Das unheimliche Licht, das Ingmar Bergman oft verwendet hat, wenn er etwas Erschreckendes erzählen wollte. Was, wenn jetzt ein wahnsinniger Seemann mit einer Axt kommt und mich umbringen will? Diesen entsetzlichen, klavierspielenden und bücherschreibenden Menschen aus dem besten Frogner? Was wusste ich über das Leben? Was hatte ich erfahren? Verdiente ich es zu leben? Glaubte ich wirklich an diese Idylle?
Er hebt den Arm. Die Axt fällt auf mich, durch die Luft. Trifft mich an der Stirn.
Das Schlimmste von allem: Ich lebe noch.
20.
Er war seit Wochen auf Sandøya, hatte die Skizzen zu etwas geschrieben, aus dem nach und nach ein Roman werden könnte. Ole hat es wieder geschafft, ihm ein wenig Mut zu machen, nach diesem seltsamen Winter, in dem er angefangen hatte, sich vor allem zu fürchten. Die gemeinsame Tournee durch Westnorwegen, die ihnen so viele Möglichkeiten gab, miteinander über ihre Leben zu sprechen. Oles ewiger Optimismus, in seiner Welt war alles möglich. Oles Fähigkeit, alles humoristisch zu sehen, aber niemals ohne Mitgefühl oder Wut. Der wahnwitzige Auftritt draußen auf Bømlo. Der alte Mann, der bei ihrem Konzert Zeitung las. Am Ende konnte Ole es nicht mehr ertragen. Er sagte mit scharfer Stimme von der Bühne herab: »Sie, alter Mann in der hintersten Reihe. Würden Sie so freundlich sein, entweder augenblicklich Ihre Zeitung zusammenzufalten oder das Lokal zu verlassen?« Er saß auf dem Klavierhocker und sah, wie der alte Herr sich weigerte, dem Befehl nachzukommen, worauf ein junger Mann, den wir beim Soundcheck kennengelernt hatten, den Zeitungsleser am Arm packte und hinausführte. Das Konzert ging weiter, aber danach kam der Junge wütend hinter die Bühne und stauchte uns zusammen: »Wisst ihr nicht, dass ihr meinen Vater beleidigt habt? Er ist der Vorsitzende vom Musikverein und hat dieses Konzert arrangiert. Er ist fast taub. Ist euch klar, was ihr angerichtet habt?«
Aber auf Sandøya grauste ihm dann vor allem, was kommen würde. Das Dach, das heruntergerissen werden müsste, ehe sich das neue erheben könnte. Er sah die Besorgnis in den Augen von Zimmermann Harald, wenn er sich das Haus ansah und alles plante, zusammen mit Ingar. Die schweren Balken, die hochgehievt werden mussten. Die entscheidenden Wochen, wenn das alte Dach abgerissen wäre und grüne Planen ihre Habseligkeiten sichern sollten. Was, wenn gerade dann schwere Regengüsse einsetzten? Wenn der Flügel ruiniert würde. Alle Bücher und Schallplatten. Das, was er und die Andere im Laufe der Jahre gekauft und gesammelt hatten. Großer Gott!
Eine Woche darauf ging die Arbeit los. Er steht unten im Hafen am Anleger und sieht, dass die Søgne über den Fjord kommt, mit den schweren Balken, dem hohen Dach, das Ingar in seinem Architektenbüro in Tvedestrand geplant hat. Wie viel kann ein Tragbalken aushalten? Welche Spanne kann er zwischen den Stützwänden überbrücken? Auf dem Papier sah es phantastisch aus. Aber nun steht Zimmermann Harald neben ihm mit seinem gepflegten Bart und den melancholischen Augen. Er wird zwar Tore und Rune bei den schwersten Hebearbeiten zu Hilfe holen, aber ansonsten wird er dieses Dach allein bauen, und er hat schon einen wehen Rücken. Ein Zimmermann, der bereits Schmerzen hat, ehe die Arbeit überhaupt in Gang gekommen ist. Der Bjørnstad-Junge weiß nicht, was er denken soll. Er kommt sich gerade arg wie aus der Stadt vor, vom Frogner plass. Er kann nicht Traktor fahren. Er kann kein Holzboot abdichten. Aber er kann einen Roman von 300 Seiten schreiben. Die Frage ist: Ist der Roman gut genug? Die Frage an Zimmermann Harald ist viel wichtiger: Ist das Holz gut genug?
Tore und Rune kommen angefahren, jeder mit seinem Traktor. Vorläufig ist alles einfach. Die Materialien werden mit einem Kran aus dem Boot auf die Traktoranhänger gehoben. Das machen sie nicht zum ersten Mal, denkt er. Es ist fast, wie auf schwarzen und weißen Tasten Klavier zu spielen. Fast, wie ein Buch zu schreiben. Aber dann?
Am nächsten Tag wird das Dach abgerissen. Er sitzt in seinem kleinen Arbeitszimmer, das er bald verlassen muss. Er hört das Geräusch von Dachpappe und Brettern, die heruntergerissen und auf den Boden geworfen werden. Alles in ihm krampft sich zusammen. Bis jetzt war Sandøya Geborgenheit, Friede, deutliche Grenzen. Hier draußen am Meer kann die Welt so fern sein, dass man sie fast nicht sieht. Oder, ganz im Gegenteil: Die Welt umringt ihn. Sogar ein kleines Insekt kann die größte Bedeutung erlangen. Ein Licht weit draußen am Horizont. Ein Schiff, vielleicht unterwegs hinaus zum Ozean und einem anderen Erdteil.
Zimmermann Harald dort oben auf dem Dach. Der feinfühlige, noble Mann, der die großen Holzrahmen für Leonard Rickhard macht, der ein zusätzliches Gewicht für diese Melancholie beisteuert, in der Leo Meister ist, mit Titeln wie Müder Modellflugzeugbauer, Ausgestreckte Figur im Gras und Fragmentarische Figuren in Sommersonne. Harald ist von seinem ganzen Wesen her ein Poet. Er denkt an die große Reise, die sie einmal zusammen unternommen haben, bis hinunter nach Kroatien, als Tito noch lebte, als gleich über ihnen in der Luft die große Flugzeugkollision geschah und Leos Vater zu Hause in Norwegen glaubte, sein Sohn sei dabei umgekommen. Er sieht Harald vor sich und begreift nicht, dass auch Leo mittlerweile verstorben ist. Wie so viele andere in dieser Erzählung. Dass die Zeit, seine eigene Zeit, wie ein Baum ist, der wächst und seine Blätter verliert. Ein Mensch nach dem anderen fällt zu Boden. Ab und zu fragt er sich, ob er unnormal ist, weil er seinen Erinnerungen und den Menschen darin solche Liebe entgegenbringt. So viel Erinnerungsliteratur handelt von Hass und Konflikten. Wo gibt es im Moment in seinem Leben auf Sandøya Konflikte, mit den vielen alten Einwohnern und den Zugezogenen, die alle zu seinen Freunden geworden sind? Die Konflikte sind hier draußen, bei ihnen. Sie sind bei ihm.
Harald wohnt in Kilsund. Aber ehe er abends mit dem Boot nach Hause fährt, denn er arbeitet viel und lange, setzt er sich zu ihnen, spricht über die Geschehnisse des Tages, den einen Tragbalken, der fast heruntergefallen wäre und ihn erschlagen hätte. Er erzählt auf eine ruhige und zurückhaltende Weise, die dafür sorgt, dass man den Humor erst erkennt, wenn er plötzlich in Haralds Augen auffunkelt. Und dann hört man auch die Bedeutung dieses Humors, und das Lachen stellt sich ein, fast verlegen, denn weder Harald noch die Andere oder er werden gern laut.
An den ersten Tagen läuft alles sehr gut. Bald ist das Dach abgerissen ohne irgendwelche Unfälle. Und alle lächeln. Damals gab es auf Sandøya viele, die lächelten. Es war die Zeit der Neusiedler. Oder derer, die in alte Häuser einzogen und sie zu ihren eigenen machten. Darum war es auch die Zeit der Erwartungen. Ingar und seine Frau und Kollegin standen da mit ihren Zauberstäben und machten es möglich, sich ein Heim zu erschaffen, in ein ganzes Haus zu ziehen und ein Grundstück zu bekommen, oft mit Blick aufs Meer, und das zum gleichen Preis wie eine dunkle Zweizimmerwohnung in Oslos Schattengebieten. Die Zeit des Lächelns. Und die Zukunft lag vor den meisten offen und unbeschwert.
Am fünften Tag kommt der Wind. Aber jetzt ist das Dach abgerissen worden. Das Haus ist mit Planen abgedeckt. Und einigen dünnen Spanplatten. Kein anderer Schutz. Was hätte Erling Neby gesagt. Er, der uns die großartige Stereoanlage im Wohnzimmer fast geschenkt hat. Niemand weiß, wann der Regen kommen wird.
Aber der Wind fegt über die Insel. Ach, er ist so verdammt stark. Und so schnell wird er sich nicht wieder legen.
Eines Nachts liegen wir im Bett und hören ein penetrantes Geräusch.
»Das ist die Plane, die reißt«, sagt die Andere.
»Da hast du wohl recht«, sage ich.
Aber wir bleiben liegen, alle beide. Als wollten wir es nicht sehen, wollten nur da liegen und so tun, als wäre nichts geschehen. Aber das ist doch falsch, denke ich. Wir müssen nachsehen, was passiert ist.
Wir laufen hinaus, alle beide, im Schlafanzug. Es ist dieses Mai-Licht, das mich an Ingmar Bergman denken lässt. Vielleicht steht Liv Ullmann irgendwo zwischen den Bäumen, in weißem Nachthemd, und sieht uns zu.
»Großer Gott«, sagt die Andere.
Ich drehe mich zum Haus um und sehe, dass es sich in ein Boot verwandelt hat, dass die grüne Plane ein Segel ist, ein riesiges Segel, das im Wind flattert. Bewahre, was, wenn der Wind so stark ist, dass das Segel zur Tragfläche wird und das Haus zum Flugzeug und abhebt, wie Tore es in seinem schlimmsten Albtraum sieht? Warum ist dieser Gedanke so verlockend, auch wenn er beängstigend ist?
Harald kommt gegen sieben Uhr morgens. Er sieht die riesige Plane an, die gerade in die Luft ragt.
»Das sieht ja nicht so gut aus«, sagt er leise.
»Ist das gefährlich?«
»Nein, das ist nur euer Haus, das kein Dach hat.«
»Ist es gefährlich, dass es kein Dach hat?«
»Nur, wenn es anfängt zu regnen.«
»Auf den Wetterbericht können wir uns nicht verlassen.«
»Nein, niemand kann sich auf den Wetterbericht verlassen. Deshalb machen wir uns besser an die Arbeit.«
Aber wir werden nicht zusammenarbeiten. Harald wird auf dem Dach sein. Die Andere wird in der Webstube sein. Ich werde in der Kammer mit dem Schreibtisch und dem Ausblick auf das Meer sitzen. In unerwarteten Situationen kommen immer die besten Ideen. Ich sehe sie plötzlich vor mir: Rosa Nordosta. Ich kenne sie. Ja, ich kenne sie besser als irgendeinen anderen Menschen. Endlich passiert etwas in meinem Kopf. Warum habe ich es nicht früher begriffen, dass ich um sie herumgekreist bin, in all diesen Wochen mit zusammenhanglosen Skizzen, ohne eine Geschichte, ohne ein konkretes Ziel. Ich kann nicht einfach mit einem Buch anfangen, ohne zu wissen, worauf ich hinauswill. Andere Autoren behaupten, das zu können, und darüber wundere ich mich jedes Mal, wenn ich es höre. Aber hatte ich nicht gerade das Gleiche gemacht? Versucht, mich auf ein Buch einzupeilen und etwas zu finden, worüber ich schreiben könnte? Nein, ich hatte etwas, worüber ich schreiben konnte. Diese Unruhe war wie eine pochende Wunde in mir. Die langen Monate in der Welt der Musik, wo die Begegnungen mit anderen Musikern Inspiration und Schutz vor belastenden Gedanken waren, warfen mich zurück in die marternde Selbstqual an der grauen Underwood oder der Remington. Während Harald mir ein Dach über den Kopf zimmerte, schrieb ich über eine Frau auf der Flucht, die von ihrer Familie fortgelaufen war, und wie deren schlafender Sohn, Jon Blund, sie wiederfinden und in sein Leben zurückholen wollte. War unser Haus ohne Dach zu einem Symbol für etwas Unbeständiges geworden, zu einem falschen Schutz, wie der, den man oft in einem Flugzeug finden konnte, wenn man ganz still auf dem Sitz vergaß, dass man mit 900 Stundenkilometern durch die Atmosphäre fegte und der Boden zehntausend Kilometer weiter unten lag?
Er schreibt über einen Menschen, der von allem wegläuft.
Ab und zu kommt Ingar, der Architekt, und sieht sich an, wie der neue Dachboden Gestalt annimmt, lässt sich beeindrucken von Zimmermann Haralds einsamen Wanderungen dort oben auf dem Haus, dem konkreten Wissen, das sich auf die Zeichnungen stützt, die geraden Striche und Winkel, alles, was Ingar vor seinem inneren Auge längst gesehen hat, das aber er oder seine Liebste unmöglich sehen können. Er schreibt also über eine Frau auf der Flucht, während er zugleich sein Leben befestigt. Die Gebrechlichkeit des Hauses gerade in diesen Wochen gibt ihm ein seltsames Gefühl, frei zu sein, unabhängig. Obwohl er über Aufbruch und Flucht schreibt, ist es nicht die Flucht, die er sich wünscht. Eher das Gegenteil. Alle, die jetzt gerade auf ein Leben auf Sandøya setzen, sagen ihm, dass auch er bald erwachsen werden muss, um wie Harald da oben auf dem Dach etwas Bleibendes zu erschaffen, um von dem zu lernen, was er sieht, dass etwas ein Tragbalken ist, ein Querlieger, und dass etwas zwei Zoll vier ist, darüber reden alle Schreiner, die zwei Zoll dicken und vier Zoll breiten Balken sind die eigentlichen Rippen eines Hauses, wenn er das richtig verstanden hat. Ja, das alles muss er lernen, denkt er, wie er so an seinem Schreibtisch sitzt und über etwas ganz anderes schreibt, diese Frau verfolgt, die durch ganz Europa flieht, wenn er sich in ihre Situation hineindenkt, etwas zu verlassen, das ihr so unendlich lieb ist. Warum tut er das? Was ist es für ein Gefühl? Er ist zu jung, um das zu wissen. Die Erfahrungen haben ihn nicht dorthin gebracht, werden es vielleicht auch niemals tun. Dennoch muss er darüber schreiben. Ist das eine Sehnsucht oder eine Warnung?
Es ist der 5. Juni 1981. In San Francisco registrieren Ärzte und Forscher zum ersten Mal die Folgen eines Virus, das zum Versagen der Immunabwehr führt, und das sie Acquired Immune Deficiency Syndrome nennen werden.
AIDS.
Noch sind die Ursachen oder die Herkunft nicht bekannt. Später wird man feststellen, dass das HI-Virus die weißen Blutkörperchen angreift. Die CD4+-Lymphozyten, die für das Abwehrsystem entscheidend sind. Innerhalb von kurzer Zeit behandeln Ärzte in San Francisco Patienten mit Entzündungen in Lunge, Speiseröhre und Netzhaut. Sie behandeln Patienten mit Lymphkrebs, Grippe, Durchfall, Pilzinfektionen, Gürtelrose und Herpes. Viele dieser Patienten sind homosexuell, Männer aus allen Gesellschaftsschichten. Schockierender und oft schneller Krankheitsverlauf. Große persönliche Tragödien. Die Patienten sterben unter den Händen der Ärzte, die nicht wissen, was sie tun sollen. Es gibt kein wirksames Gegenmittel.
In mehreren Ländern werden Forschungsgruppen eingerichtet. Neue Fälle werden in London und danach in mehreren westeuropäischen Ländern registriert.
Aber die Welt hat noch immer keine Ahnung davon, was sich hier ankündigt.
Nachts sieht er, wie das Haus Gestalt annimmt. Er träumt sich immer dicht an das heran, was in seinem Leben passiert. Viele seiner größten Konzerte hat er mehrmals gespielt, ehe er endlich auf dem Podium steht. Einige waren peinlich. Andere waren große Erfolge. Keins jedoch war wie das Konzert, das er wirklich gegeben hat und das oft weder Erfolg noch Fiasko war.
Aber diesmal träumt er nicht davon.
Er träumt von Harald.
Dem Freund. Dem Unersetzlichen. Von dem er und die Andere jetzt abhängig sind. Der Traum ist wie ein Film von Pasolini. Diese seltsame, stillstehende Stimmung, die dieser Meister oft zu erzeugen versteht. Ja, stillstehend, auch bei Wind. Starkes Sonnenlicht. Die sich wiederholenden Bewegungen der Planen. Harald wie ein Schatten dort oben auf dem Dach, zwischen den Balken. Er versucht, einen großen Balken zu heben. Ach nein, nicht den eigentlichen Tragbalken! Den größten vom Dachfirst. Harald schafft es nicht allein. Er steht unten und versucht zu rufen. Aber dann hat er keine Stimme, nur ein heiseres, fauchendes Flüstern, wie die Seehunde, wenn man Bilder von ihnen auf dem Eis sieht, unmittelbar ehe sie totgeschlagen werden.
Harald! Aufpassen! Sonst stürzt du ab!
Aber er bringt keinen Laut heraus.
Harald stürzt ab.