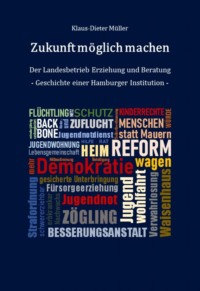Kitabı oku: «Zukunft möglich machen», sayfa 6
Talfahrt
Die Aufbruchsstimmung des Jahres 1927 bekam nach dem „schwarzen Freitag“ am 25. Oktober 1929, der die Weltwirtschaftskrise einläutete, einen deutlichen Dämpfer. Die Folgen der wirtschaftlichen und politischen Krise der Weimarer Republik erfasste alle Bereiche der Gesellschaft und des Alltagslebens, und damit auch die Jugendhilfe. Weite Teile des Außenhandels und der Industrie in der Stadt brachen zusammen. Die Zahl der Erwerbslosen in Hamburg stieg von rund 50 Tausend im Jahr 1928 auf fast 165 Tausend Ende 1932 an. Ledige und Kinderlose erhielten aus der Arbeitslosenversicherung für ein halbes Jahr nur rund 37% ihres letzten Einkommens, Familien bis zu 60%. Allerdings mussten diese Sätze immer wieder gekürzt werden, bis sie bei nur noch rund 20% lagen. Nach 6 Monaten musste die gemeindliche Armenfürsorge eintreten und das Existenzminimum sichern, das knapp bemessen war und Hunger bedeutete. Wer eine Arbeitsstelle hatte, musste erhebliche Lohneinbußen von mindestens 20 bis 30% hinnehmen.{112}
Für die öffentlichen Haushalte war die Finanzierung der sozialstaatlichen Maßnahmen eine große Herausforderung. Das Niveau der Unterstützungsleistungen musste während der Krise laufend weiter abgesenkt werden. Die Gesamtausgaben wurden zwischen 1928 und 1932 von 424 auf 355 Millionen Reichsmark gekürzt. Gleichzeitig explodierten die Ausgaben für die Wohlfahrtspflege von 49 auf 113 Millionen Reichsmark. Der Hamburger Senat kam ab 1930 nicht umhin, drastische Sparmaßnahmen zu ergreifen, von denen die öffentliche Jugendhilfe nicht ausgenommen wurde. In der Vollversammlung des Landesjugendamtes und Jugendamtes Hamburg vom 29. September 1931 wurden die „Auswirkungen der Sparmaßnahmen auf den Haushalt der Jugendbehörde“ erörtert.{113} Der Senat hatte beschlossen, alle Sachausgaben im Haushalt des aktuellen und kommenden Jahres um 10% zu kürzen. Die „Inangriffnahme von Neubauten“ wurde untersagt, Gehaltskürzungen umgesetzt, die Arbeitszeit erhöht, das Pensionsalter für die Beschäftigten der Verwaltung herabgesetzt und Einrichtungen geschlossen, um die finanziellen Belastungen zu verringern. Schließlich wurden auch die Pflegesätze für die Fürsorgeerziehung in außerhamburgischen Einrichtungen um 10% abgesenkt. „Ferner wurde der gesamte Zöglingsbestand durchgeprüft und die beschleunigte Entlassung von Kindern aus Anstalts- und Familienpflege vorgenommen, außerdem wurde die Aufnahme von Zöglingen – besonders in freiwillige Fürsorgeerziehung – stark eingeschränkt. Die Übernahme der Erziehung – auch die vorläufige – darf hinfort nur durch Oberbeamte verfügt werden.“ Ein Ergebnis der Maßnahmen war die Reduzierung der Betreuten in auswärtigen Anstalten von 606 im April 1930 auf 365 im Juli 1931 mit dem Ziel, dass die Anzahl bis zum Jahresende um weitere 120 abnehmen sollte. In der Besprechung wurde die Befürchtung geäußert, dass die Absenkung des Haushaltsansatzes für Verpflegung zu einer Verschlechterung der Ernährung der Zöglinge führen würde. Der Präses der Behörde, Senator Eisenbarth, hielt dieses Problem durch „kleine Vereinfachungen in der Bespeisung“ und gegebenenfalls Verschiebung von Geldmitteln anderer Haushaltsansätze für lösbar. Auf die Beschwerde eines Besprechungsteilnehmers, die Sparmaßnahmen seien nicht zur Zustimmung vorgelegt worden, erwiderte der Präses nur, dass die Einsparungen zwangsläufig vorgenommen werden mussten und der „nächste Haushalt (…) vermutlich noch ganz anders aussehen“ werde.
Die Sparmaßnahmen konnten die ausfallenden Einnahmen und steigenden Sozialausgaben für die Opfer der Wirtschaftskrise bei weitem nicht kompensieren, so dass seit Juni 1931 laufend der finanzielle Zusammenbruch drohte. {114} Um die Zahlungsfähigkeit zu erhalten, war Hamburg auf Kassenkredite des Deutschen Reiches angewiesen. Eine volkswirtschaftliche Abwärtsspirale war in Gang gesetzt. Dass der Staat mit seiner prozyklischen Politik diese Entwicklung verschärft hatte, war manchen der politisch Verantwortlichen zwar klar, einen Ausweg fanden die demokratischen Parteien jedoch nicht.
Mit dem wachsenden Elend stieg der Druck in der Politik. Die extremen Parteien NSDAP und KPD bekämpften sich offen und auch blutig auf der Straße. Das Vertrauen in die regierenden Parteien schwand und führte zu einer Verschiebung der politischen Kräfte im Deutschen Reich und auch in Hamburg. War die NSDAP 1928 mit nur 3 Abgeordneten in der Hamburgischen Bürgerschaft vertreten, so waren es 1931 bereits 43 und 1932 sogar 51 von insgesamt 157 Sitzen.{115} Die SPD war 1928 stärkste Fraktion mit 60 Sitzen und büßte bis 1932 rd. 20 Tausend Wählerstimmen und 11 Mandate ein. Damit fiel sie hinter die NSDAP zurück. Der von den Sozialdemokraten und der Deutschen Staatspartei gebildete Senat hatte die Regierungsgeschäfte seit der Bürgerschaftswahl vom 27. September 1931 ohne Mehrheit in der Bürgerschaft geführt. Das änderte sich auch nach der Wahl im April 1932 nicht. Der Minderheitssenat arbeitete, gestützt auf die 2. Notverordnung „zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen“ und weiterer Notverordnungen des Reichspräsidenten, weiter an der Bewältigung der Krise, die nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine ernsthafte politische Krise war. Es konnten weder in Hamburg noch auf Reichsebene mit parlamentarischen Mehrheiten ausgestattete Regierungen gebildet werden. Das war die Stunde der „Totengräber“{116}, die der Weimarer Demokratie den Todesstoß versetzten, indem sie den Reichpräsidenten dazu bewegten, den Vorsitzenden der NSDAP, Adolf Hitler, am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler zu ernennen, und damit den Nationalsozialisten die Macht in die Hände legten. Anfang Februar folgten Notverordnungen mit der Aufhebung von Grundrechten. Nach dem Reichstagsbrand in der Nacht vom 27. auf den 28. Februar wurde der Ausnahmezustand verhängt und die Verfolgung von Kommunisten aufgenommen. Für den 5. März wurde eine erneute Reichstagswahl angesetzt, die die letzte in der Weimarer Republik sein würde. Diese brachte im Reichstag Mehrheiten für das am 24. März 1933 verabschiedete „Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich“, das Ermächtigungsgesetz, das die nationalsozialistische Umgestaltung des gesamten Staatswesens ermöglichte. Und gerade das „rote“ Hamburg marschierte bei dieser Entwicklung an der Spitze.
In Hamburg wurde am 5. März 1933 nach der Schließung der Wahllokale auf Drängen der Reichsregierung der Polizeipräsident durch einen SA-Standartenführer ersetzt. Reichsweit waren zu diesem Zeitpunkt bereits Verhaftungen von kommunistischen Funktionären und Abgeordneten auf der Grundlage der „Verordnung zum Schutz von Volk und Staat“ vorgenommen worden, so dass diese ihre Mandate in den Parlamenten nicht mehr wahrnehmen konnten. Am 8. Mai wählte die Hamburgische Bürgerschaft, die nun in ihrer Mehrheit aus NSDAP- und konservativen Abgeordneten bestand, einen neuen Senat unter der Führung des parteilosen Carl Vincent Krogmann. Er war erst zum 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP geworden. Ein Foto des neuen Senats zeigt die nationalsozialistischen Senatoren in Parteiuniform, die wenigen bürgerlichen in dunklem Anzug mit Krawatte.
Noch vor der Verabschiedung des „Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ vom 7. April 1933 begannen in Hamburg die politischen Säuberungen der Verwaltung. Zu den ersten Maßnahmen gehörten die Beurlaubungen des Staatsrates der Finanzdeputation, Leo Lippmann, weil er Jude war, und des Direktors des Landesjugendamtes, Wilhelm Hertz. Auch in anderen Behörden wurden Spitzenpositionen zügig neu besetzt. Damit waren die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die nationalsozialistische Staatsideologie in der Verwaltung umgesetzt werden konnte{117}. Mit dem „vorläufigen Gesetz zur Gleichschaltung der Länder mit dem Reich“ vom 31. März 1933 wurden die Parlamente der Länder aufgelöst und anhand der für die Parteien bei der Reichstagswahl vom 5. März 1933 abgegebenen Stimmen neu gebildet. Für Hamburg bedeutete dies, dass die Mandate der KPD gestrichen und die Zahl der Sitze von 160 auf 128 verringert wurde. Die Bürgerschaft hatte durch die neue Gesetzgebung ihre bisherigen Kompetenzen verloren und war funktionslos geworden. Gesetze konnten von den Landesregierungen erlassen werden. Mit dem Gesetz gegen die Neubildung von Parteien vom 14. Juli 1933 wurde die NSDAP zur einzigen politischen Partei im Deutschen Reich erklärt. Andere Parteien waren damit illegal und aufzulösen. Die Hamburgische Bürgerschaft bestand seitdem nur noch aus Nationalsozialisten, bis sie am 28. Oktober 1933 auch formal aufgelöst wurde{118}.
Monate zuvor hatte die Reichsregierung den nationalsozialistischen Gauleiter Karl Kaufmann zum Reichsstatthalter für Hamburg bestellt. Er ernannte die Mitglieder der Landeregierung sowie Beamte und hatte den Senat zu beaufsichtigen. Im Herbst 1933 erfolgte die nationalsozialistische Umgestaltung der Verwaltung. Die Behörden und Ämter wurden auf fünf Verwaltungszweige konzentriert. Das Landesjugendamt verlor seine Eigenständigkeit und wurde in die Gesundheits- und Fürsorgebehörde integriert. In einem weiteren Schritt im Jahr 1936 setzte sich Kaufmann selbst an die Spitze der Administration und gab fortan als „Führer der Landesregierung“ Direktiven aus.{119}
Neben dieser staatlichen Gleichschaltung erfolgte auch die sehr zügige Einbindung gesellschaftlicher Institutionen und Gruppen in den nationalsozialistischen Staat, und zwar durch Gesetze, Druck und Terror, zu einem erheblichen Teil aber auch durch freiwilliges Zutun. Personen mit einer Nähe zur nationalsozialistischen Ideologie oder gar mit entsprechender Überzeugung waren in den Institutionen vertreten. Sie konnten sich nun offen äußern und an der Umgestaltung mitwirken. Die alten NSDAP-Mitglieder erwarteten außerdem, in der Partei und im Staatsdienst in Ämter zu gelangen. Mit diesem Motiv waren auch viele Parteieintritte in den ersten Wochen nach der Machtergreifung zu verzeichnen, so dass ein Aufnahmestopp ab dem 1.Mai 1933 erlassen wurde. 1935 führte die Partei in Hamburg 42170 Männer und 4316 Frauen in ihrer Mitgliederkartei. Dies entsprach 3,8% der Bevölkerung{120}. Hamburg lag damit über dem Reichsdurchschnitt.
Andere ließen sich auf die neuen Realitäten ein und wurden zu loyalen Anhängern oder „Mitläufern“, wie man sie später bezeichnen würde. Nachträglich betrachtet lässt sich ein „merkwürdiger Zwiespalt“ feststellen: Viele nahmen die Verhältnisse hin, ohne ihnen innerlich zu folgen. Die eingetretene Ordnung wurde in vielerlei Hinsicht geschätzt, die Schattenseiten des neuen Regimes zwar wahrgenommen, aber verdrängt.{121}
Dieser Zwiespalt war auch in der Jugendhilfe festzustellen. Der Allgemeine Deutsche Fürsorgeerziehungstag (AFET) war ein traditionsreicher und bedeutender Verband für die Fürsorgeerziehung. Noch 1931 hatte ihr Vorsitzender anlässlich der Skandale in Heimen und der wirtschaftlichen Restriktionen einen Aufsatz mit dem Thema „Wo stehen wir gegenwärtig in der Fürsorgeerziehung?“ verfasst. Darin sind viele Fragen und Aspekte von mehreren Seiten beleuchtet, Probleme und Lösungsoptionen benannt. Der Aufsatz wirkt wie eine Suche nach Klarheit in einer komplexen Welt, in der konservative und moderne Werte, Methoden und politische Ausrichtungen nebeneinanderstehen. Nach der nationalsozialistischen Machtergreifung ist für den AFET die Suche nach dem richtigen Weg offenbar beendet. Die klare Staatsdoktrin für die Jugendhilfe wird in einer 1933 verfassten Denkschrift begrüßt: „Die Fürsorgeerziehung (FE.) als staatliche Ersatzerziehung hat sich ihrem Wesen und Charakter nach der Zielsetzung des Führers Adolf Hitler für den nationalsozialistischen Staat und für seine Erziehungsgrundsätze einzufügen.“{122} Der AFET übersetzte diese Zielsetzung für die Jugendhilfe: Die als nicht erziehbar geltenden Jugendlichen sollten in Bewahranstalten abgeschoben werden. Die „Strafe als nicht zu entbehrendes Erziehungsmittel“ wurde von ihrem Makel der vergangenen Jahre befreit. Generell formulierte der AFET die „Eingliederung in die Volksgemeinschaft“ als oberstes Erziehungsziel. Für den AFET waren „die Aufgaben des Mannes und der Frau im Volksganzen verschieden“. Die Erziehung müsse dies berücksichtigen, so etwa bei der „körperlichen Ertüchtigung“ von Jungen im „Wehrsport“ und bei Mädchen über die „Entfaltung echter deutscher Frauenart, Dienst- und Opferbereitschaft in Familie und Volk.“{123} Im Jahr 1935 veranstaltete der AFET in Kassel eine große Mitgliederversammlung, die sich im Schwerpunkt mit der nationalsozialistischen Erziehung befasste und dessen Tagesordnung sich wie die eines Parteitags liest. So sprach zum Beispiel der Reichsschulungsbeauftragte der NS-Volkswohlfahrt, Franz Maierhofer, zum Thema „Erziehungsaufgaben des Nationalsozialismus“.{124}
Der AFET hatte sich 1933 sehr schnell gleichgeschaltet. Er war damit offenbar auch einem inneren Bedürfnis nachgekommen, dem Widerstreit der konkurrierenden Erziehungsansätze der 1920er Jahre ein Ende zu setzen. Rückblickend bemerkt der AFET in seiner Jubiläumsbroschüre, dass er „Anschluss“ an die „‚neuen‘ Ideen und Machthaber“ gesucht habe. Andererseits hält er sich zugute, sich der weitergehenden organisatorischen Anpassung durch geschicktes Hinauszögern widersetzt zu haben. Auch habe er sich im Krieg – wenn auch erfolglos – für die Verbesserung der Ernährung der Zöglinge in der Fürsorgeerziehung eingesetzt. Eine schwache Bilanz.
Auch in Hamburg stießen die „neuen Ideen und Machthaber“ auf breite Zustimmung. Immerhin wurden härtere Erziehungsmethoden nicht mehr kritisiert und Unerziehbare nach und nach aus den Heimen ausgesondert. Der nationalsozialistische Heimalltag bot auch neue Erlebnisse, wie ein Beispiel aus dem Mädchenheim Feuerbergstraße zeigt: Die Direktorin des Mädchenheimes hatte im August 1933 für 25 Mark von der „Radiofirma Brunken“ ein „Radio mit Lautsprecher geliehen“, um die Radio-Übertragung vom NSDAP-Parteitag in Nürnberg ins Heim zu holen. Vom 30. August bis zum 3. September hockten die Erzieherinnen und die Mädchen vor dem Radio und lauschten den Reden des ‚Parteitages des Sieges‘. Die Übertragung war am Freitag, dem ersten Tag, unbefriedigend, „Sonnabend u. Sonntag sehr gut“, notierte die Direktorin und ergänzte: „Begeisterung bes. am Sonnabend groß.“{125} Man hat in der Feuerbergstraße wohl gefallen an Radioübertragungen solcher Veranstaltungen gefunden. Für den 24. und 25. Februar 1934 sind zwei Zeitungsausschnitte aus den Unterlagen des Heimes vorhanden, die die Übertragung der „Parteigründungsfeier in der Musik-Halle“ und die „Vereidigung der Pl. Leiter und HJ-Führer“ in Hamburg ankündigten.
Am 2. August 1934 starb Reichspräsident Hindenburg. Bereits einen Tag zuvor hatte die Reichsregierung das „Gesetz über das Staatsoberhaupt des Deutschen Reiches“ erlassen, das Hitler durch die Übertragung der Befugnisse des Amtes des Reichspräsidenten auf das des Reichkanzlers auf Lebenszeit zum unumschränkten Diktator gemacht hatte. Hitler ordnete für diesen Schritt eine Bestätigung durch das Volk an. Das Plebiszit wurde für den 19. August 1934 anberaumt.{126} Hitler begab sich am 17. August nach Hamburg zu einem Staatsbesuch, auf dem er in einer reichsweit ausgestrahlten Rede auch für die bevorstehende Volksbefragung warb. Der Besuch Hitlers war für die Hamburger Nationalsozialisten ein besonderes Ereignis. Man wollte dem Führer einen fulminanten Empfang bereiten und damit die Treue des nationalsozialistischen Hamburgs unter Beweis stellen. Viele Menschen wurden mobilisiert, um an der langen Strecke vom Flughafen zum Rathaus Spalier zu stehen und dem „Führer“ zuzujubeln. Der Direktor des Jugendamtes ließ der Direktorin Cornils ausrichten, dass sie am Freitag, den 17. August, um 12:30 Uhr mit den Mädchen ihres Heimes an der Alsterkrugchaussee Aufstellung nehmen möge: „Spalier wird in 3er Reihe gebildet. Das Mädchenheim Feuerbergstrasse schiebt sich an geeigneter Stelle zwischen die dort stehenden Schulen ein.“ Es klappte alles gut, wie auf dem Dokument vermerkt wurde: „Das ganze Haus mit Ausnahme von 3 G.-Kranken und 5 Neuaufnahmen geht zum Empfang des Führers. Abends hören wir durch das Radio von 8.30 - 10.30 den Führer – unerhört eindrucksvoll! Mädchen gehen fein mit.“ {127}
Ausgestoßen, benutzt und vernichtet
Der 14. November 1989 war ein kühler, regnerischer Tag, an dem die 72‑jährige Liese-Lotte M. und ihr 81‑jähriger Ehemann Wilhelm beim Notar Dr. Ekkehard Nümann in der Spitalerstraße erschienen, um „letztwillige Verfügungen“ zu beurkunden. Sie bestimmten sich zu gegenseitigen Alleinerben. Sollten jedoch beide irgendwann verstorben sein, sollten ihre Ersparnisse der Freien und Hansestadt Hamburg zufließen, und zwar für die Pflege und Unterstützung von Waisen in dem Waisenheim Averhoffstraße 7. Nach der Verlesung des Testaments setzten die beiden ihre Unterschriften unter das Dokument und verließen das Notariat.
Die Ehe der Liese-Lotte M. war kinderlos geblieben, obwohl sie sicherlich gerne Kinder gehabt hätte. Um zu verstehen, dass sie mit ihrem Mann keine Familie gründen konnte, muss man in ihre Jugend zurückblicken. Liese-Lotte wurde im November 1918 in einfachen Verhältnissen und in einer schweren Zeit geboren. Die Ehe ihrer Eltern war unglücklich. Ihr Vater misshandelte seine Frau, sorgte sich wenig um die Familie und ging keinerlei Arbeit nach, wie sich Liese-Lotte Jahrzehnte später erinnerte. Ihre Mutter war daher gezwungen, arbeiten zu gehen, um für sich und ihr Kind den Lebensunterhalt zu sichern. Die Ehe wurde schließlich 1923 geschieden. Ihr Vater als ihr gesetzlicher Vertreter sorgte dafür, dass seine damals sechsjährige Tochter im Waisenhaus in der Averhoffstraße aufgenommen wurde. Liese-Lotte war ein wenig gefördertes Kind, das in ihrer Entwicklung zurückblieb. Sie wurde vermutlich aus diesem Grund 1929 in die Alsterdorfer Anstalten überwiesen, wo sie bis zu ihrer Volljährigkeit im Jahr 1939 bleiben musste. Ein Arzt befand während dieser Zeit, dass sie und ihre möglichen Kinder für das deutsche Volk in der Zukunft wenig nützlich seien, und erwirkte, dass sie 1936 oder 1937, sie selbst erinnerte es nicht genau, im Universitäts-Krankenhaus Eppendorf zwangssterilisiert wurde. Ihre Kindheit, und vor allem dieser Einschnitt in ihr Leben, hat ihr ein lebenslanges Leiden bereitet, und dazu bewogen, ihr Erbe Kindern zu widmen, die ohne elterliche Nähe aufwachsen müssen und Schutz und Zuwendung benötigen. Nach ihrer Entlassung aus der Anstalt im Jahr 1939 war sie für 3 Jahre zur Arbeit im Krankenhaus Jerusalem zwangsverpflichtet. „Anschließend war ich ein freier Mensch“, schilderte sie 1991 rückblickend. 1954 heiratete sie ihren Mann Wilhelm, mit dem sie bis zu ihrem Tod im Januar 1993 ihr Leben verbrachte{128}.
Liese-Lotte war Opfer der von der Rassenkunde geprägten nationalsozialistischen Bevölkerungspolitik. Zum deutschen Volk sollten nur rassisch hochwertige Menschen gehören. Neben den Juden, die aus dieser Sicht erklärte Rassenfeinde waren, weitete sich der Blick auch auf diejenigen Bevölkerungsgruppen aus, die durch geringeres Leistungsvermögen, unheilbare Krankheit oder Behinderung für die Gesellschaft eine Last darstellten.
Bereits im Juli 1933 beschloss das nationalsozialistische Regime das „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“, das zum 1. Januar 1934 in Kraft trat. Es ermöglichte die Unfruchtbarmachung von Menschen, deren Kinder mit „großer Wahrscheinlichkeit“ an „schweren körperlichen und geistigen Erbschäden leiden werden.“ Das Gesetz beschrieb neun Gruppen von Erbkrankheiten, die aber zum Teil für eine weite Auslegung geöffnet waren. Außerdem konnte “unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet“. Der Kreis derjenigen, die eine Unfruchtbarmachung beantragen konnten, umfasste neben den betroffenen Personen oder deren gesetzlichen Vertretern auch beamtete Ärzte oder Leiter von Kranken, Heil- oder Pflegeanstalten. Das Erbgesundheitsgericht entschied über die Anträge auf Basis eines ärztlichen Gutachtens. Wurde die Zwangssterilisation beschlossen, konnte sie auch mit Mitteln des Zwangs durchgesetzt werden.{129}
Das war die Stunde der Ärzte, die sich schon seit Längerem der Rassenkunde gewidmet hatten und nun zur Tat schreiten konnten. Und das auch in der Jugendhilfe. Der Psychiater der Hamburger Jugendbehörde, Werner Villinger, hatte den Boden für die Umsetzung des Gesetzes im Bereich der Jugendhilfe bereitet, indem er erste Maßstäbe für die erbbiologische Begutachtung aufstellte. Er wechselte 1934 als Chefarzt zur Anstalt in Bethel, so dass er das Gesetz in Hamburg nicht mehr praktisch umsetzen konnte. Sein Nachfolger, der Neurologe Heinrich Lottig, setzte die erbbiologische Ideologie in der Jugendhilfe mit voller Kraft um.
Der im Jahr 1900 geborene Heinrich Lottig stammte aus einer sozialdemokratisch geprägten Familie, wählte aber, anders als sein Vater, der zu den Reformpädagogen seiner Zeit gehörte, den Beruf des Arztes. In den 1920er Jahren war er im Krankenhaus Hamburg-Eppendorf tätig und widmete sich der Zwillingsforschung an der von Max Nonne bis 1933 geleiteten Neurologischen Klinik. Der in die Jahre gekommene Nonne war über seine Entlassung 1933 hinaus als Fachmann und Gutachter tätig und bekannte sich zur Zwangssterilisation und Euthanasie. Lottig bildete seine ärztlichen Sichtweisen in einem in Hamburg und reichsweit sich ausbreitenden Klima einer rassenbiologischen Medizin aus. 1933 unterzeichnete er das Bekenntnis der deutschen Professoren zu Adolf Hitler. Er trat 1934 Villingers Nachfolge als Leitender Oberarzt des Hamburger Jugendamtes an.
Lottig führte die rassenbiologische Ideologie sehr früh unter dem Deckmantel der Wissenschaft in die Fürsorgeerziehung ein. In den Hamburger Nachrichten vom 2. Juli1933 wurde unter dem Titel „Das schwer erziehbare Kind - die Notwendigkeit rassehygienischer Maßnahmen“{130} über einen Vortrag von ihm berichtet: „Die Unterwertigkeit der Erbmasse, deren schrankenlose Weiterverbreitung eine dringende Gefahr für den Bestand unseres Volkes ausmacht, stellt die Ursache der schweren Fälle von Schwererziehbarkeit dar.“ Unter Bezug auf seine Zwillingsstudien stellte Lottig den für ihn wissenschaftlich gesicherten Zusammenhang zwischen „intellektuellem und moralischem Schwachsinn erblicher Herkunft“ und „asozialem oder kriminellem Entarten der Persönlichkeit“ her.
Lottig schritt ab 1934 als leitender Psychiater des Jugendamtes auch zur Tat. Er war oberster Gutachter für Sterilisationsanträge für junge Menschen und ging in seinen Einschätzungen über das Gesetz sogar hinaus, indem er unter dem Begriff des Schwachsinns auch den „moralischen Schwachsinn“ fasste, der auch als „moralisch minderwertig“ klassifizierte Menschen in den Kreis des Eingriffs hineinzog. Damit konnten auch Kleinkriminelle, Obdachlose und Unangepasste unter das Messer kommen. Im April 1934 hatten Lottig und seine Mitarbeiter bereits 89 Fälle bearbeitet, von denen nur 35 als nicht sterilisierungsbedürftig befunden wurden.{131} Das weitere Verfahren nach der ärztlichen Stellungnahme betrieb dann das Gesundheitsamt. In dem Bericht, in dem Lottig diese Bilanz präsentierte, lobte er die großen Anstrengungen seiner Abteilung und klagte über die schleppende Mitwirkung von Eltern und Vormündern. Außerdem seien die Ärzte des Jugendamtes mit anderweitiger gutachterlicher Tätigkeit befasst, die „an Dringlichkeit die Sterilisierungsfälle“ überträfen. Gemeint waren vermutlich auch die Untersuchungen in der Aufnahmestation des Waisenhauses in der Averhoffstraße, das zu einem „Aufnahmeheim und Ausleseheim für männliche Jugendliche, Beobachtungsheim“{132} entwickelt worden war. Hier wurde bereits eine erbbiologische Klassifizierung der neu aufgenommenen Kinder und Jugendlichen vorgenommen, um deren weitere Unterbringung festzulegen oder sie gleich als nicht „erbwertig“ und unerziehbar aus der Jugendhilfe fern zu halten und in „Bewahranstalten“ zu überweisen.
Für die Entwicklung des Klassifikations- und Ausleseschemas wurden zunächst Fürsorgezöglinge des Mädchenheimes Feuerbergstraße nach anlage- und umweltbedingten Ursachen für die Verwahrlosung beurteilt. Das Schema wurde von Lottig bis 1936 als „Einteilung der Zöglinge nach ihrem biologischen Wert“{133} weiterentwickelt. Es war Grundlage des Ausleseprozesses. Die sechsstufige Klassifikation reichte von „wertvolle geistige und charakterliche Qualität“ über „leichte geistige und charakterliche Unterwertigkeit“ bis zu „nicht erziehungsfähig“.
Die Hamburger Erziehungsheime wurden nach diesem Schema neu organisiert, so dass „eine sorgfältige Differenzierung der Zöglingstypen möglich war“. Das Waisenhaus war in diesem Zuge in die Jugendheime Volksdorf, Reinbek und Niendorf aufgeteilt worden. In einer Darstellung des Hamburger Landesjugendamtes aus dem Jahr 1939 wird das Selektionsprinzip wie folgt dargestellt:
„A Kinder von normaler Anlage und normaler geistiger und charakterlicher Wertigkeit.
1) Kinder von normaler Anlage und normaler geistiger und charakterlicher Wertigkeit (über Durchschnitt der öffentlichen Volksschulen),
2) Ausreichende geistige und charakterliche Qualität (guter Durchschnitt)
B Kinder, die geistig oder charakterlich leicht oder schwer unterwertig, aber noch erziehbar sind mit Aussicht darauf, dass sie später keiner Anstaltsbetreuung mehr bedürfen und sich ihren Lebensunterhalt selber erarbeiten werden.
3) Leichte geistige und charakterliche Unterwertigkeit (schwacher Durchschnitt)
4) Mittlere geistige und charakterliche Unterwertigkeit (hierzu gehört der Hilfsschultyp)
C Kinder, die infolge schweren geistigen oder charakterlichen Tiefstandes eine Gefahr für die Volksgemeinschaft darstellen und daher frühzeitig abgesondert und in sparsamer Weise verwahrt werden müssen.
5) starke geistige und charakterliche Unterwertigkeit (noch gewisse Erziehungs- und Anleitemöglichkeiten; voraussichtlich aber dauernd außerstande, sich im freien Leben zu halten)
6) Hochgradig abwegige, Nichterziehungsfähige.“
Die Begutachtung und Etikettierung der jungen Menschen nach ihrem erbbiologischen Wert konnten nur ein erster Schritt sein, da man sie auch praktisch in diesen Gruppen zusammenbringen wollte. An die „erbbiologisch Minderwertigen“ wollte man keine Mühe verschwenden und sie an Orte aussondern, an denen man sie verwahren konnte. Die „Erbwertigen“ sollten jedoch in den Genuss einer Förderung an einem schönen Ort kommen. Der Hamburger Gauleiter initiierte daher Ende April 1934 das Vorhaben, die „Staatskrankenanstalt Friedrichberg mit ihren schönen Parkanlagen künftig nicht geisteskranken Menschen zur Verfügung zu halten, sondern sie solchen Volksgenossen zu öffnen, die einen geistigen und körperlichen Gewinn von einem Aufenthalt in diesen schönen Anlagen haben würden“.{134} Die künftigen Bewohner sollten verdiente, alte Menschen und erbbiologisch wertvolle Fürsorgezöglinge sein. Hierfür mussten die etwa 1800 in der Anstalt lebenden Menschen bis auf die 300 als „heilbar“ geltenden in andere Einrichtungen verlegt werden. Dies erfolgte innerhalb von nur 9 Monaten.
Zugleich waren in Jugendheimen diejenigen ausfindig zu machen, die als „erziehbar“ galten und in die neue Musteranstalt „Eilbecktal“ umziehen sollten. Der Umzug aus diversen Heimen erfolgte ab Juni 1935. Am Jahresende befanden sich 480 Kinder am neuen Ort. Gleichzeitig wurde in diesem Ringtausch das Waisenhaus an der Averhoffstraße, das als alt und nicht mehr geeignet betrachtet wurde, bis auf die ärztliche Abteilung geräumt.{135} Das Ergebnis der Großaktion war unbefriedigend, da es nicht genug „erbwertige“ Kinder gab, um die große Platzkapazität auf dem Gelände in Eilbek auszuschöpfen. Man erwog, Kinder aus Pflegefamilien auf das Heimgelände zu holen, verwarf den Plan aber wieder als nicht sinnvoll und nicht umsetzbar. Der Gauleiter ordnete an, die entstandene Situation wieder aufzulösen, wobei allerdings in der Öffentlichkeit nicht der Eindruck der Planlosigkeit entstehen sollte. Eine Rückverlagerung des Waisenhauses zum Standort Averhoffstraße Nr. 5 war damit ausgeschlossen. Das Johannes-Petersen-Heim, das ebenfalls am Standort Averhoffstraße (Haus Nr. 7) platziert war, wurde hingegen zurückverlegt. Für das Waisenhaus wurde ein Neubau in einem Außenbezirk erwogen, und zwar auf dem Grundstück Schemmannstraße 56 in Volksdorf, auf dem die Behörde eine „Wohlfahrtsanstalt … für behinderte und sieche alte Frauen“ betrieb. Im Zuge der Planung wurde vom Behördenleiter Oskar Martini die Frage aufgeworfen, ob denn die Waisenhauszöglinge überhaupt eines Neubaus Wert seien. Lottig wurde beauftragt, eine Bewertung der 366 Zöglinge vorzunehmen. Das Ergebnis legte er im Oktober 1936 vor. Danach waren 44,5 % der Kinder als „normal“ zu bezeichnen. Der Gauleiter war mit dem Ergebnis offenbar nicht zufrieden und gab eine Überprüfung durch den Vizepräsidenten der Gesundheitsbehörde in Auftrag. Das Ergebnis entsprach den Erwartungen der politischen Spitze mehr: nur noch 28,5% der Kinder galten als „erbbiologisch ausreichend“. Lottig empfand die Beauftragung eines überprüfenden Gutachtens als Vertrauensbruch und gab seine Stelle beim Landesjugendamt in Hamburg zum Jahresende 1936 auf.{136} Er hinterließ Verfahren und Zuständigkeiten, mit denen sein Amtsnachfolger, Otto Hülsemann{137}, die Ausgrenzung erbbiologisch unerwünschter Menschen aus der Jugendhilfe nahtlos fortsetzen konnte.
Die zweite Begutachtung führte zur Entscheidung, dass in Volksdorf zum bestehenden Gebäude nur noch kostengünstige Baracken errichtet werden sollten. Der Plan zur Räumung der Anstalt „Eilbecktal“ hatte damit an Kontur gewonnen, so dass der Gauleiter die erneute Verschiebung der Kinder bis zum Dezember 1938 anordnete. Dies war keine leichte Aufgabe, da sich die Unterbringungssituation durch die Eingemeindung von Altona, Harburg und Wandsbek in das Stadtgebiet Hamburgs zum 1. April 1937 und dem damit verbundenen Bevölkerungszuwachs noch verschärft hatte.{138} Die Verwaltung machte sich dennoch mit Eifer erneut ans Werk und setzte auch diese Weisung um: Das alte Forsthaus in Reinbek wurde zum Jugendheim umfunktioniert und konnte 120 Kinder aufnehmen. Weitere 150 konnten vor der Fertigstellung der Baracken nach Volksdorf umziehen, womit das Heim heillos überbelegt war und die Schulräume in Schlafsäle umgewandelt werden mussten. Hier wie in anderen Heimen, war dann kein Unterricht mehr möglich. Es sollte versucht werden, den Kindern den Besuch der benachbarten Volksschulen zu ermöglichen. „60 Jungen zogen nach Niendorf in ein ehemaliges Altersheim.“{139} Für „obdachlose Mädchen“ und Lehrlingsmädchen wurde die an der Alster gelegene Villa Schwanenwik 38 angekauft, hergerichtet und im Mai 1939 als Durchgangs- und Lehrlingsheim mit 50 Betten in Betrieb genommen.{140}