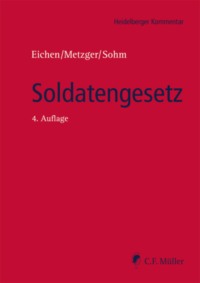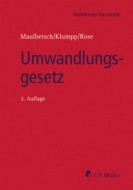Kitabı oku: «Soldatengesetz», sayfa 34
cc) Beachtung der Regeln des Völkerrechts
79
Hierunter sind grds. alle einschlägigen völkerrechtl. Best. und Vorgaben zu verstehen, wobei in erster Linie die Regeln des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten (früher: Kriegsvölkerrecht) von Bedeutung sind. Ein Großteil dieser Regelungen ist gem. Art. 59 Abs. 2 GG in deutsches Recht transformiert worden, weist also zusätzlich Gesetzesqualität auf. Ebenso verhält es sich mit den Regelungen des VStGB.
80
Die wichtigsten Regelungen sind:
| – | I. GA vom 12.8.1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der SK im Felde,[173] |
| – | II. GA vom 12.8.1949 zur Verbesserung des Loses der Verwundeten, Kranken und Schiffbrüchigen der SK zur See,[174] |
| – | III. GA vom 12.8.1949 über die Behandlung der Kriegsgefangenen,[175] |
| – | IV. GA vom 12.8.1949 zum Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten,[176] |
| – | ZP I und ZP II, |
| – | Abkommen vom 18.10.1907 betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (IV. Haager Abkommen) mit Anl. Ordnung der Gesetze und Gebräuche des Landkriegs (Haager Landkriegsordnung),[177] |
| – | Übereinkommen vom 10.10.1980 über das Verbot oder die Beschränkung des Einsatzes bestimmter konventioneller Waffen, die übermäßige Leiden verursachen oder unterschiedslos wirken können.[178] |
81
Auch völkergewohnheitsrechtl. Grds. sowie allg. Regeln des Völkerrechts, die über Art. 25 GG geltendes Recht sind, werden von Abs. 4 erfasst. Friedensvölkerrechtl. Regelungen, insbes. der VN-Charta, dürfte im Rahmen des mil. Befehlsrechts eine geringere praktische Relevanz zukommen.
82
Angesichts der grds. völkerrechtl. Unterscheidung zwischen ius in bello und ius ad bellum[179] könnte die Frage aufgeworfen werden, ob und inwieweit ein nach „Kriegsvölkerrecht“ an sich zulässiger Befehl den Regeln des Völkerrechts i.S.v. Abs. 4 widersprechen kann, sofern er im Rahmen eines Einsatzes erteilt wird, der im Widerspruch zu friedensvölkerrechtl. Vorgaben steht. Es spricht einiges dafür, die völkerrechtl. Differenzierung für das nationale Befehlsrecht zu übernehmen und einen Verstoß gegen das Friedensvölkerrecht nicht auf den Befehl „durchschlagen“ zu lassen.
Auch die Rechtsgrundlagen des völkerrechtl. Menschenrechtsschutzes (z.B. der Internationale Pakt über bürgerliche und polit. Rechte,[180] Europ. Menschenrechtskonvention[181]) sind Regeln des Völkerrechts i.S.v. Abs. 4. Hier stellt sich in erster Linie die Frage, ob und ggf. inwieweit diese Best. in mil. Einsätzen anwendbar sind. Jedenfalls in bewaffneten Konflikten stellt nach h.A. das humanitäre Völkerrecht die lex specialis dar.[182] Darüber hinaus sollen menschenrechtl. Regelungswerke bei Auslandseinsätzen nur dann unmittelbare Anwendung finden, wenn die SK in dem betreffenden Gebiet über ein Mindestmaß an Hoheitsgewalt (jurisdiction) verfügen.[183]
dd) Gesetze
83
Unter Gesetzen sind sämtliche Rechtsnormen mit Außenwirkung zu verstehen, von RVO über einfache Gesetze bis hin zu den Best. des GG.[184] Ob ein Befehl gegen ein Gesetz verstößt, ist nach dem jew. einschlägigen Gesetz zu bestimmen. Abs. 4 stellt insoweit keinen eigenständigen rechtl. Maßstab auf, sondern verweist auf die gesamte nationale Rechtsordnung. Inwieweit für einen Befehl eine besondere gesetzl. Eingriffsermächtigung gegeben sein muss, folgt ebenfalls aus der jew. Sach- und Rechtsmaterie und nicht aus Abs. 4. Führt der Befehl zu Grundrechtseinschränkungen der Untergebenen, dürften als formelle gesetzl. Grundlage die allg. Gehorsamspflicht sowie die im SG normierten soldatischen Einzelpflichten ausreichen. Materieller Prüfungsmaßstab sind das einschlägige Grundrecht und seine ausdrücklichen oder immanenten Beschränkungsmöglichkeiten.[185] Zu den Gesetzen gehört auch der aus dem Rechtsstaatsprinzip abzuleitende Grds. der Verhältnismäßigkeit. Befehle, die über das erforderliche Maß in die Freiheitssphäre des Untergebenen eingreifen, sind danach rechtswidrig.[186] Die Verhältnismäßigkeit spielt insbes. bei Präventivbefehlen eine Rolle.[187]
ee) Dienstvorschriften
84
Dienstvorschriften sind allg. Weisungen und AO des BMVg. Rechtsdogmatisch gehören sie dem staatl. Innenrecht an, entfalten also keine Außenwirkung. Sie sind daher vergleichbar mit AVV für den mil. Bereich.[188] Da in Dienstvorschriften auch Befehle enthalten sein können, begründet Abs. 4 insoweit eine Hierarchie zwischen Befehlen. Befehle, die in Dienstvorschriften enthalten sind, schränken die Befehlsbefugnis des einzelnen Vorg. ein.
d) Rechtsschutz gegen Befehle
85
Da Befehle keine Außenwirkung haben, kommen unmittelbare Rechtsschutzmöglichkeiten nur für Soldaten in Betracht, denen ein Befehl erteilt wurde. Sind mit einem Befehl nachteilige Wirkungen für Dritte, insbes. für Personen außerhalb der Bw, verbunden, können diese nicht gegen den Befehl selbst vorgehen. Ihnen stehen vielmehr die allg. Rechtschutzmöglichkeiten gegenüber der ihnen nachteiligen Maßnahme zur Verfügung (Dienstaufsichtsbeschwerde, Feststellungs- und Unterlassungsklage, Folgenbeseitigungsanspruch u.a.).
86
Befehle sind ausnahmslos truppendienstl. Natur. Fühlt sich ein Soldat durch einen Befehl unrichtig behandelt, kann er hiergegen Beschwerde einlegen. Im Rahmen des Beschwerdeverfahrens wird nicht allein die Rechtmäßigkeit des Befehls, sondern auch seine Zweckmäßigkeit geprüft, vgl. § 13 Abs. 1 Satz 2 WBO.[189]
87
Bleiben die Beschwerde und die weitere Beschwerde (§ 16 WBO) erfolglos, kann Antrag auf Entsch. des TDG gestellt werden. Das TDG ist lediglich zu einer Rechtskontrolle befugt (§ 17 Abs. 3 WBO). Dem entspr. ist ein Antrag auf truppendienstgerichtl. Entsch. nur zulässig, sofern der betroffene Soldat geltend macht, in eigenen Rechten verletzt zu sein, oder wenn seine Beschwerde eine Verletzung der Pflichten eines Vorg. ihm gegenüber zum Gegenstand hat, die im Zweiten Unterabschnitt des Ersten Abschnitts des SG geregelt sind (§ 17 Abs. 1 WBO). Die Vorgesetztenpflichten des Abs. 4 fallen hierunter. Ob damit eine Entsch. des TDG bei jeder Verletzung des Abs. 4 beantragt werden kann, ist dennoch fraglich. Vorgesetztenpflichten bestehen zunächst gegenüber dem Dienstherrn. Nicht jeder Verstoß eines Befehls gegen eine der Rechtmäßigkeitsvoraussetzungen des Abs. 4 muss gleichzeitig eine Pflichtverletzung gegenüber den Untergebenen darstellen. So mag der Befehl, Teilnehmer einer Mahnwache außerhalb des Kasernengeländes zu fotografieren, rechtswidrig sein.[190] Er verletzt aber nicht den Soldaten, dem der Befehl erteilt wird, in seinen Rechten. Vielmehr ist gesondert zu prüfen, ob die bei der Befehlsgebung missachteten Gesetze oder Dienstvorschriften ihrerseits subjektive Rechte des Soldaten begründen oder wenigstens in seinem Interesse ergangen sind (z.B. Sicherheitsbest.). Auch wenn Befehle verfassungsrechtl. Best. oder völkerrechtl. Grds. zuwiderlaufen, begründet dies nicht zwingend eine Verletzung subjektiver Rechte des Soldaten.[191]
7. Absatz 5
a) Satz 1
88
Satz 1 macht Vorg. für die von ihnen erteilten Befehle verantwortlich. Für Befehle anderer, insbes. höherer Vorg., können sie nach dem eindeutigen Wortlaut („seine“) nicht verantwortlich gemacht werden.
89
Satz 1 konstituiert keine Pflicht, deren vorsätzliche oder fahrlässige Verletzung ein Dienstvergehen darstellen könnte[192], sondern hat nur Klarstellungsfunktion.
90
Die Pflicht, nur rechtmäßige Befehle zu erteilen, ergibt sich bereits umfassend aus Abs. 4.[193] Dieser ist insoweit lex specialis und verpflichtet Vorg. hins. der Rechtmäßigkeit der Diensthandlung Befehl ebenso persönlich, wie dies bei Beamten gem. § 63 Abs. 1 BBG für die Rechtmäßigkeit ihrer dienstl. Handlungen gilt. Satz 1 kann dies allenfalls klarstellend ergänzen.
91
Satz 1 soll den Dienstherrn nicht in die Lage versetzen, bloße Schlechtleistungen der Vorg. durch unzweckmäßige Befehle als Dienstvergehen zu ahnden. Selbstverständlich sind Vorg. auch für die Zweckmäßigkeit ihrer Befehle verantwortlich. Unzweckmäßige Befehle sind aber erst dann ein Pflichtverstoß, wenn auch andere, dann vorrangige Pflichten (neben § 10 Abs. 3 oder § 12 insbes. die Pflicht aus § 7, dienstl. Material und Personal zum Wohle des Dienstherrn einzusetzen) berührt sind. Fälle, in denen bei einem Verstoß gegen anderweitige Pflichten noch die Rechtmäßigkeit und lediglich eine Unzweckmäßigkeit des Befehls angenommen werden kann, sind kaum denkbar.
Nur die zu weit gehende Annahme einer eigenständigen Dienstpflicht führt dazu, dass in der Lit.[194] mit Hinw. auf die den Vorg. abverlangte „Tatfreudigkeit“ und Entschlusskraft ein Pflichtverstoß verneint werden muss, wenn Vorg. ihre nachträglich als falsch erkannten Entschlüsse in der Lage, in der sie sich befunden haben, für zweckmäßig halten durften. Richtigerweise müsste dann der objektive Pflichtverstoß angenommen und nur das für ein Dienstvergehen erforderliche Tatbestandsmerkmal des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit verneint werden. Verantwortung setzt jedoch schon tatbestandlich Vorwerfbarkeit voraus, so dass im vorgenannten Fall und damit generell die Möglichkeit der Pflichtverletzung ausgeschlossen werden muss.
92
Satz 1 stellt klar, dass Vorg. für die ordnungsgemäße – also auch zweckmäßige – Ausübung ihres Ermessen bei der Befehlsgebung persönlich einstehen müssen. Denn soweit Vorg. nicht durch Gesetz, Befehle oder bindende Anweisungen höherer Vorg. gebunden sind, liegt es in ihrem Ermessen, ob, in welcher Weise und mit welchem Inhalt sie das Führungsmittel des Befehls einsetzen. Wie sie dies tun, ist von besonderer Bedeutung im Hinblick auf die ihnen zukünftig zu übertragenden oder zu entziehenden Aufgaben, bei Verwendungsentscheidungen und insbes. für dienstl. Beurteilungen.
93
Satz 1 stellt ferner klar, dass der Gehorsamspflicht der Untergebenen aus § 11 Abs. 1 und 2 die Verantwortung der einen Befehl erteilenden Vorg. entspricht. Schließlich wird mit der Ausführung von Befehlen bewirkt, was Vorg. mit Anspruch auf Gehorsam erreichen wollen. Satz 1 bezieht sich ausdrücklich nur auf Befehle. Hins. der Verantwortung für AO, die keinen Befehl darstellen, gelten nach § 11 Abs. 3 beamtenrechtl. Vorschriften (§ 62 Abs. 1, § 63 BBG). Die Zurechnung der Befehlsausführung ist die notwendige Folge. Soweit Untergebene einen rechtswidrigen Befehl erhalten, den sie nicht ausführen müssen oder nicht ausführen dürfen und dennoch ausführen, können Vorg. sich hierauf nicht berufen und die Verantwortung – auch nicht teilweise – auf die Untergebenen abwälzen. Dies gilt auch dann, wenn die Untergebenen die Unverbindlichkeit des Befehls erkennen konnten oder erkannt haben. Insoweit sind die Vorg. wie Anstifter zu einer Straftat (vgl. § 26 StGB) als Täter eines Dienstvergehens für die Folgen ihrer Befehle zu belangen. Dies würde jedoch auch ohne die Regelung in Satz 1 gelten.
94
Wenn ein Befehl nur die konsequente Umsetzung eines bindenden Befehls eines höherrangigen Vorg. ist, hat der höhere Vorg. die Verantwortung zu tragen. Soweit ein Befehlsbefugter eine AO eines allg. Vorg. ohne Befehlsbefugnis umsetzten soll, sind § 11 Abs. 3 SG sowie § 62 Abs. 1 und § 63 BBG zu beachten. Danach trägt der die AO umsetzende Befehlsgeber nach Satz 1 uneingeschränkt die Verantwortung für die Rechtmäßigkeit seines Handelns (Befehlens) persönlich, wenn er sich nicht über eine Remonstration exkulpiert (§ 11 Abs. 3 SG i.V.m. § 63 Abs. 2 Satz 3 BBG).[195]
95
Begehen Untergebene eine Straftat auf Befehl, handeln sie gem. § 5 WStG nur dann schuldhaft, wenn sie erkennen, dass es sich um eine rechtswidrige Tat handelt oder dies nach den ihnen bekannten Umständen offensichtlich ist.
96
Auch unterhalb der Schwelle kriminellen Unrechts sind der Einsatz dienstl. Personals und Materials für nichtdienstl. Zwecke untersagt und Befehle hierzu nach § 11 Abs. 1 unverbindlich. Wird ein solcher unverbindlicher Befehl erteilt, ist den ausführenden Untergebenen trotz des Abs. 5 Satz 1 eine Berufung auf die Verantwortung des Vorg. verwehrt, auch wenn der Vorg. ihnen versichert, er werde die Verantwortung übernehmen. Die Pflicht zum treuen Dienen gebietet es, pflichtwidrige Handlungen zu unterlassen, zu denen man nicht gezwungen ist. Wer also einen Befehl erhält, der unterhalb der Straftat ein Tun verlangt, das gegen eine soldatische Pflicht verstößt, der darf einen unverbindlichen Befehl nicht befolgen. Tut ein Untergebener es dennoch, haftet er (mit), soweit er nicht in entspr. Anwendung des § 5 WStG schuldlos handelt. Ergänzend ist die Regelung des § 11 Abs. 3 zu beachten.
97
Soldaten, die außerhalb der SK verwendet werden und in Führungsfunktionen eingesetzt sind, in denen sie dienstl. Anordnungsbefugnisse haben, führen nicht per Befehl. Damit ist Satz 1 nicht anwendbar. Für die Rechtmäßigkeit ihrer AO tragen sie nach § 11 Abs. 3 SG i.V.m. § 63 Abs. 1 BBG die volle persönliche Verantwortung.
b) Satz 2
aa) Allgemeines
98
Satz 2 knüpft an § 10 Abs. 2 an. Vorg. müssen Gefährdungen der Disziplin und Verstößen von Soldaten gegen ihre Dienstpflichten durch den Einsatz ihrer Befehlsautorität begegnen. Dazu gehört zunächst, ihre eigenen Befehle in der den Umständen angemessenen Weise durchzusetzen.[196] Wäre diese Pflicht aber auf die eigenen Befehle beschränkt, wäre eine lückenlose Dienstaufsicht nicht gewährleistet. Zudem müsste der Wortlaut des Satzes 2, an Satz 1 („seine Befehle“) anknüpfend, mit einem bestimmten Artikel („Diese“ bzw. „Die“) beginnen, was gerade nicht der Fall ist. Deshalb erstreckt sich die Pflicht zur Durchsetzung von Befehlen auch auf Befehle, die andere Vorg. erteilt haben,[197] insbes. solche, die in den die mil. Ordnung regelnden Dienstvorschriften enthalten sind. Soweit Dienstvorschriften wegen fehlender Befehlsbefugnis des Erlassgebers keine Befehlsqualität haben, aber bindende AO enthalten, besteht die Pflicht aller Vorg. nach § 7, die in der Vorschrift enthaltene Anweisung durchzusetzen (vgl. auch § 11 Abs. 3 i.V.m. § 62 Abs. 1 Satz 2 BBG).
99
Mit der Formulierung „in der den Umständen angemessenen Weise“ entspricht der Gesetzgeber deklaratorisch dem aus dem Rechtsstaatsprinzip (Art. 20 Abs. 3 GG) abgeleiteten Gebot, auch bei der Befehlsdurchsetzung den Grds. der Verhältnismäßigkeit der Mittel zu wahren. Danach muss das eingesetzte Mittel geeignet und erforderlich sein, um den angestrebten Zweck zu erreichen. Von mehreren geeigneten Mitteln ist dasjenige anzuwenden, das die Betroffenen am wenigsten beeinträchtigt. Schließlich muss die Maßnahme in einem angemessenen Verhältnis zur Bedeutung des Befehls für die Erfüllung des mil. Auftrags oder die Aufrechterhaltung der Disziplin stehen.[198] Befehlsdurchsetzung ist somit nicht in jedem Fall und nicht um jeden Preis geboten. Auch § 6 Abs. 1 VorgV sieht die Erklärung zum Vorg. nur vor, wenn zur Aufrechterhaltung der Disziplin ein sofortiges Eingreifen für „unerlässlich“ gehalten wird. Die Festnahmebefugnis gem. § 21 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a WDO besteht nur, wenn die Festnahme zur Aufrechterhaltung der Disziplin geboten ist. Insbes. in der Öffentlichkeit wird die Gefahr eines offenen Streits oder gar einer tätlichen Auseinandersetzung regelmäßig das Gegenteil gebieten.
bb) Befugnisse
100
Satz 2 stellt ein Gebot zur Befehlsdurchsetzung dar und hat daher den Charakter einer Aufgabennorm. Zweifelhaft ist, ob es sich darüber hinaus um eine Befugnisnorm handelt, die Eingriffsrechte in Grundrechte der Untergebenen vermittelt.
101
Der REntw.[199] nannte als Mittel zur Durchsetzung von Befehlen die Überwachung der Befehlsausübung („unmittelbare Dienstaufsicht“), die Möglichkeit, sich die Ausführung des Befehls melden zu lassen und, sofern der Vorg. sich anders nicht durchsetzen könne, ein Einschreiten mit Mitteln des Disziplinarrechts oder die Veranlassung einer strafrechtl. Verfolgung. Ferner wurde angenommen, Vorg. hätten in krit. Lagen im Falle äußerster Not ein Notstandsrecht. Es erlaube ihnen, den Gehorsam selbst mit der Waffe zu erzwingen. Inwieweit der Gesetzgeber sich diese Auffassung zu eigen gemacht hat, ist unklar, obwohl die damals zeitliche Nähe zum 2. Weltkrieg diese Annahme nahe legen mag.[200] Die Formulierung der Begr. lässt jedoch auch die Deutung zu, dass dieses Notstandsrecht nicht durch die spätere Regelung des heutigen Satzes 2 begründet werden sollte, sondern allenfalls ein außerhalb der gesetzl. Regelung stehendes Notstandsrecht angenommen wurde.[201] Da es sich beim SG um nachkonstitutionelles Recht handelt, sind an die Formulierung einer Vorschrift, die Eingriffe in Grundrechte, insbes. in Art. 2 Abs. 2 Satz 1 und 2 GG, vorsieht, rechtsstaatl. Maßstäbe anzulegen. Daran gemessen hat ein solcher Wille des Gesetzgebers – selbst wenn man ihn unterstellt – keinen Niederschlag im SG gefunden.[202] Er wäre ohnehin verfassungskonform nicht realisierbar (vgl. insb. Art. 102 GG).
102
Es besteht keine Befugnis zur Anwendung unmittelbaren Zwanges[203] durch körperliche Gewalt, ihre Hilfsmittel und durch Waffen. Eine solche kann Satz 2, der nicht annähernd vergleichbar mit im Polizeirecht als Auffangnorm bestehenden Generalklauseln formuliert ist, nicht entnommen werden.[204] Der Gesetzgeber hat mit den §§ 10 ff. UZwGBw eine abschließende Regelung geschaffen, die mangels Analogiefähigkeit keine Grundlage für eine allg. Befehlsdurchsetzung darstellen kann.
103
Wollte man Satz 2 ein Recht zu Eingriffen in das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit durch Anwendung unmittelbaren Zwanges entnehmen, wäre die Vorschrift mangels Beachtung des Zitiergebots des Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG nichtig. Mit dem SG hat der Gesetzgeber neue Grundlagen für die SK geschaffen und nicht nur vorkonstitutionelles Recht geringfügig modifiziert in Kraft gesetzt. Körperliche Einflussnahme kann gleichwohl zur Durchsetzung eines Befehls eingesetzt werden, sofern die Schwelle zum Eingriff in die körperliche Unversehrtheit und damit in den Schutzbereich des Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG nicht überschritten wird.[205] Das BVerwG vertritt in st. Rspr. einerseits, dass Vorg. ihre Untergebenen niemals anfassen dürfen; andererseits soll dies zulässig sein, wenn zur Durchsetzung eines Befehls kein anderes Mittel bleibt.[206] Die These des Verbots jeglichen Anfassens ist damit widerlegt und überdies in dieser Striktheit unnötig, da in den relevanten Fallgruppen einzelfallbezogene Verbote des Anfassens über entgegenstehende Pflichten (insbes. § 10 Abs. 3, § 12, § 17 Abs. 2) unschwer festgestellt werden können.[207]
104
Aus Satz 2 lässt sich keine Befugnis zur präventiven Durchsuchung durch Feldjäger zu deren Eigensicherung ableiten.[208] Mit §§ 7 und 8 UZwGBw sowie § 20 WDO hat der Gesetzgeber spezielle Normen für streitkräftebezogene Durchsuchungsrechte geschaffen, die einen Rückgriff auf eine allg. Norm zur Befehlsdurchsetzung ausschließen.
105
Den Vorg. stehen zur Durchsetzung von Befehlen z.B. die Mittel des Erl. „Erzieherische Maßnahmen“ (ZDv A-2160/6 Nr. 1.2.31) zur Verfügung.[209] Dieser Erl. unterscheidet zwischen allg. erzieherischen Maßnahmen, zu deren Anwendung alle Vorg. berechtigt sind (Belehrung, Zurechtweisung, Warnung oder Verlängerung eines einzelnen Teilabschnitts des Dienstes/der Ausbildung), zusätzlichen erzieherischen Maßnahmen, die dort näher bestimmten Vorg., und schließlich besonderen erzieherischen Maßnahmen, die DiszVorg. vorbehalten sind (Versagen von Nachtausgang an Tagen, auf die ein Dienst für den betroffenen Soldaten folgt; diese Maßnahme ist nur gegen Mannschaften während der allg. Grundausbildung zulässig; ferner können DiszVorg. die Befugnisse eines Vorg. zur selbstständigen Anwendung einzelner erzieherischer Maßnahmen einschränken).
106
Vorg. können einen Befehl wiederholen und auf die Strafbarkeit der Nichtbefolgung gem. § 20 WStG hinweisen.
107
Androhung und Durchführung einer vorläufigen Festnahme nach § 21 WDO kommen ebenfalls in Betracht, selbst wenn im Fall der tatsächlichen Festnahme die Befehlsdurchsetzung zumindest nicht unmittelbar erfolgt. Sie kann gleichwohl die Bereitschaft zur Befehlsbefolgung bewirken. In diesem Fall sind Festgenommene nach § 21 Abs. 4 WDO auf freien Fuß zu setzen, sofern die Festnahme dann nicht mehr aus anderen Gründen zur Aufrechterhaltung der Disziplin erforderlich ist.[210]
108
Schließlich bestehen die Möglichkeiten der disziplinaren Ahndung von Pflichtverletzungen mit den Mitteln der WDO sowie der Abgabe an die Staatsanwaltschaft zur Verfolgung krimineller Pflichtverletzungen Untergebener.