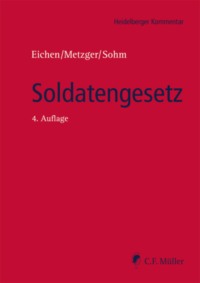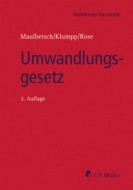Kitabı oku: «Soldatengesetz», sayfa 37
I. Allgemeines
1. Zweck der Vorschrift
1
§ 11 begründet die Gehorsamspflicht des Soldaten gegenüber Befehlen und legt gleichzeitig deren Grenzen fest. Gesetzessystematisch handelt es sich bei der Best. um eine Komplementärnorm zu § 10 Abs. 4. Während diese Vorschrift Verpflichtungen des mil. Vorg. bei der Erteilung von Befehlen aufstellt[1], regelt § 11 die Verpflichtung des Untergebenen und ihre Reichweite gegenüber Befehlen. Die zentrale Pflicht des Soldaten, Befehle zu befolgen, und damit das mil. Prinzip von Befehl und Gehorsam werden mit dieser Best. auf eine ausdrückliche gesetzl. Grundlage gestellt. Damit ist § 11 ein Ausdruck des mit der Aufstellung der Bw verbundenen Konzepts der Inneren Führung und des Leitbildes vom Staatsbürger in Uniform[2], wonach auch Soldaten Grundrechtsträger sind (vgl. Art. 17a GG) und die ggf. mit mil. Befehlen verbundenen Einschränkungen ihrer Rechte auf einer gesetzl. Grundlage beruhen müssen. Weiterhin wird mit den ausdrücklich normierten Gründen für die Unverbindlichkeit von Befehlen – insoweit konsequent – auch der Kategorie eines „unbedingten Gehorsams“ eine Absage erteilt.[3]
2. Entstehung der Vorschrift
2
In der deutschen Wehrrechtsentwicklung stellt § 11 insoweit ein Novum dar, als damit die Gehorsamspflicht erstmals im soldatischen Dienstrecht[4] geregelt wurde. Früh. Wehrgesetze, insbes. das WG 1921 und das WG 1935, enthielten keine ausdrückliche Bestimmung über die Gehorsamspflicht, sondern setzten diese im Grunde voraus. Ausdrücklich war die Pflicht zum Gehorsam nur in Art. 6 Abs. 2 der „Berufspflichten des deutschen Soldaten“[5] verankert, denen eher der Charakter einer VO zukam. Gesetzl. waren allein die Folgen von Gehorsamsverstößen in § 47 MStGB normiert.
3
Trotz Fehlens einer dienstrechtl. Regelung in früh. deutschen SK haben bereits das RMG und das Reichskriegsgericht zahlreiche Entsch. über Umfang und Grenzen der Befehlsbefugnis bis 1945 getroffen. Diese stehen zwar sicherlich nicht durchgehend mit heutigen Wertvorstellungen in Einklang, haben aber doch eine so ausgewogene Judikatur begründet, dass der REntw. darauf – i.V.m. Vergleichen zu Wehrrechtsordnungen anderer Staaten – aufbauen konnte.[6]
4
Der REntw.[7] sah als § 9 folgende Vorschrift vor:
(1) Der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle nach besten Kräften, gewissenhaft, vollständig und unverzüglich auszuführen.
(2) Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde. Befolgt der Untergebene den Befehl dennoch, so ist seine Schuld ausgeschlossen, wenn er nicht erkennt und wenn es nach den ihm bekannten Umständen auch nicht offensichtlich ist, dass dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird.
5
Aus der ungewöhnlich umfangreichen Begr.[8] sind, da für die heutige Interpretation noch von Bedeutung, folgende Aussagen erwähnenswert:
| – | Das „Führungsmittel“ des Befehls sei das Kennzeichen jeder „Wehrmacht“. |
| – | Der Untergebene könne Gegenvorstellungen erheben, wenn er sich hierzu „aus ernsthaften Gründen“ genötigt sehe. Eine solche Pflicht werde jedoch nicht begründet. |
| – | Der Untergebene habe Befehle, die auszuführen unmöglich sei, zu melden. |
| – | Eine strafrechtl. Norm sei stets „stärker“ als der mil. Befehl. |
| – | „Übertretungen“ (heute – überwiegend –: Ordnungswidrigkeiten) seien auszuführen. |
| – | Mit Abs. 2 Satz 2 des REntw. werde – vor dem Hintergrund der Erfahrungen des 2. Weltkriegs – der Schritt von der sog. Gesinnungsethik zur sog. Verantwortungsethik vollzogen. Der Untergebene habe aber keine „Prüfungspflicht“. |
6
In seiner Stellungnahme forderte der BR[9], Abs. 1 Satz 1 um den Zusatz „in dienstlichen Angelegenheiten“ zu ergänzen. Gegen Abs. 2 Satz 2 erhob der BR Bedenken. Der dort vorgesehene Verbotsirrtum bedürfe „einer angemessenen Einengung“.
7
Die BReg schlug in ihrer Gegenäußerung[10] vor, Abs. 1 um folgenden Satz 3 zu ergänzen:
Die irrige Annahme, der Befehl betreffe keine dienstliche Angelegenheit, befreit ihn nicht von der Verantwortung.
Zu Abs. 2 Satz 2 des REntw. hielt die BReg an ihrer Formulierung fest; eine weitere Einengung gefährde die „reibungslose Befehlsgebung“.
8
Die Regelung des Abs. 2 wurde auch während der 1. Lesung des REntw. im BT krit. angesprochen. Der Abg. Merten (SPD)[11] meinte, die Bedeutung des „verbrecherischen Befehls“ sei in dem Entw. nicht gebührend gewürdigt worden. Konkrete Formulierungsvorschläge sind den Debattenbeiträge nicht zu entnehmen, allenfalls ein gewisses „Unbehagen“ gegenüber der vorgesehenen gesetzgeberischen Lösung dieses Grundsatzproblems.
9
Der Rechtsausschuss des BT folgte in seiner Sitzung vom 18.11.1955[12] zunächst der vom BMVg vorgeschlagenen Ergänzung des Abs. 1 Satz 1. Nach einer ausführlichen Aussprache zu Abs. 2 Satz 2 beschloss der Ausschuss folgende Neufassung:
Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen wird.
10
Der VertA ergänzte Abs. 1 um Satz 3 mit der Begr., damit sollten der „schikanöse Befehl“ und Befehle in privaten Angelegenheiten „getroffen“ werden. Es seien Grenzen zu setzen, „wo Grundwerte verletzt oder Forderungen gestellt werden, die nichts mit der eigentlichen Aufgabe zu tun haben“. Außerdem setzte sich der VertA eingehend mit Abs. 2 auseinander und formulierte diesen sprachlich nochmals um.[13]
11
In der Erstfassung lautete der dann so bezifferte § 11 wie folgt:
(1) Der Soldat muss seinen Vorgesetzten gehorchen. Er hat ihre Befehle nach besten Kräften vollständig, gewissenhaft und unverzüglich auszuführen. Ungehorsam liegt nicht vor, wenn ein Befehl nicht befolgt wird, der die Menschenwürde verletzt oder der nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist; die irrige Annahme, es handele sich um einen solchen Befehl, befreit nicht von der Verantwortung.
(2) Ein Befehl darf nicht befolgt werden, wenn dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde. Befolgt der Untergebene den Befehl trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch ein Verbrechen oder Vergehen begangen würde.
3. Änderungen der Vorschrift
12
§ 11 ist wie folgt geändert worden:
13
Art. 154 Nr. 1 des G vom 2.3.1974[14] fasste Abs. 1 Satz 3 Halbs. 2 neu; in Abs. 2 wurden die Begriffe „Verbrechen oder Vergehen“ durch „Straftat“ ersetzt. Auslöser für diese Änd. waren die Reformen des StGB der 60er und 70er Jahre des letzten Jh., hier insbes. der Irrtumstatbestände (§§ 16, 17 StGB).[15]
14
Mit der Neubekanntmachung des SG v. 14.2.2001[16] wurde die Best. an die neue Rechtschreibung angepasst.
15
Bedeutsamer ist die Anfügung des neuen Abs. 3 durch Art. 9 Nr. 4 des BwRefBeglG. Mit dieser Regelung wurde der zwar grds. nicht neuen, aber durch die Bundeswehrreform verstärkt auftretenden Entwicklung Rechnung getragen, dass Soldaten nicht nur dem Befehl mil. Vorg., sondern auch anordnungsbefugten sonstigen Vorg. unterstehen können. Aus Gründen der Rechtssicherheit sollten die Pflicht, dienstl. AO, die keine Befehle sind, auszuführen, und die Übernahme der Verantwortung hierfür, wie sie auch ein Beamter zu tragen hat, durch einen Verweis auf die entspr. Vorschriften des BBG klargestellt werden.[17] Zu den verfassungsrechtl. Aspekten dieser Regelung s. die nachstehende Komm. (Rn. 17 ff.).
4. Verfassungs- und staatsorganisationsrechtliche Bedeutung
a) Allgemeines
16
Neben ihrer rein mil.-funktionalen Bedeutung ist die Gehorsamspflicht ein zentrales Element, um die – verfassungsrechtl. notwendige – hierarchische Struktur der SK zu begründen. Nur über die Weisungs- bzw. Befehlsbindung ihrer Angehörigen ist die Vorgabe der demokratischen Legitimation aller Staatsgewalt (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG) für die SK zu gewährleisten. Einerseits lassen sich hierüber die polit. Vorgaben von Parlament und BReg in den SK umsetzen, andererseits ist nur über eine lückenlose Hierarchie die parlamentarisch-polit. Verantwortlichkeit der BReg für die SK gegeben (Legitimationskette).[18] Dies ist allerdings keine spezifische Vorgabe für die SK, sondern gilt grds. für die gesamte Struktur der vollziehenden Gewalt.[19] Die Notwendigkeit besonderer parlamentarischer Legitimation und Einbindung wird allerdings hins. der Bw durch ausdrückliche Best. des GG besonders zum Ausdruck gebracht (vgl. insbes. Art. 45a Abs. 2, Art. 45b, Art. 65a, Art. 87a Abs. 1 Satz 2 GG), was vorrangig historisch zu erklären ist.
b) Gehorsamspflicht und Befehls- und Kommandogewalt gem. Art. 65a GG
17
Z.T. wurde und wird die Ausgestaltung des Befehlsrechts mit seinen truppendienstl. Unterstellungsverhältnissen als unmittelbarer Ausfluss der Befehls- und Kommandogewalt des BMVg angesehen. Ohne eine gesonderte truppendienstl. und mil. (und damit befehlsrechtl.) Unterstellung von Soldaten i.S.d. §§ 1 Abs. 3, 10 Abs. 4, 11 Abs. 1 sei die in Art. 65a GG verfassungsrechtl. vorgegebene Befehls- und Kommandogewalt nicht lückenlos gewährleistet. Eine Herauslösung von Soldaten aus der durchgängigen Befehlskette der SK[20] sei verfassungsrechtl. problematisch, weil ohne förmliche Befehlsbefugnis die für notwendig erachtete ununterbrochene Befehlskette i.S.d. VorgV vom Min. bis zu jedem einzelnen Soldaten nicht sicherzustellen wäre.[21]
18
Diese Sichtweise würde den Gestaltungsspielraum des einfachen Gesetzgebers sowie die OrgGewalt über die Bw verengen. Der verfassungsrechtl. Begriff der Befehls- und Kommandogewalt ist nicht mit dem einfachgesetzl. ausgestalteten Befehlsrecht bzw. dem mil. Vorgesetztenverhältnis gleichzusetzen.
Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt gem. Art. 65a GG zu sein, ist eine verfassungsrechtl. Stellung. Die Befehls- und Kommandogewalt selbst ist eine aus dieser Stellung folgende verfassungsrechtl. Kompetenz. Sie gibt keine bestimmte Ausgestaltung der einfachgesetzl. zu regelnden Vorgesetzten- und Unterstellungsverhältnisse sowie des Befehlsrechts vor. Als die – auf die SK bezogene – Ressortleitungskompetenz des BMVg[22] unterscheidet sich die Befehls- und Kommandogewalt nicht kategorial von der allg. Ressortleitungskompetenz gem. Art. 65 GG.[23] Ihre Funktion besteht darin, die verfassungsrechtl. für alle staatl. Gewalt zwingende demokratische Legitimation speziell für die SK zu vermitteln. Zwingend ist damit allein, dass das Handeln der SK immer rückführbar auf den Min. sein muss, der insoweit seinerseits unmittelbar parlamentarisch verantwortlich ist und der Richtlinienkompetenz des BK unterliegt. Allein dies ist durch einfachgesetzl. Regelungen und die organisatorische Struktur der SK zu gewährleisten.
19
Aus verfassungsrechtl. Sicht ist somit eine truppendienstl. bzw. befehlsrechtl. Unterstellung von Soldaten nicht zwingend geboten. Entscheidend ist vielmehr, dass die Soldaten in das hierarchische Gesamtgefüge des Staates eingebunden sind und eine lückenlose Kette bis hin zum Min. besteht, um demokratische Legitimation und parlamentarische Kontrolle zu gewährleisten. Dies kann durch ein förmliches Befehlsrecht, aber auch durch ein dem Beamtenrecht vergleichbares Weisungsrecht ziv. „Vorgesetzter“ bewirkt werden. Die Befehls- und Kommandogewalt des BMVg wird dadurch in keiner Weise beeinträchtigt.
20
Darüber hinaus bezieht sich die Befehls- und Kommandogewalt gem. Art. 65a GG nur auf die SK als OrgBereich und nicht auf andere Dienststellen (z.B. der BwVerw).[24] Wenn Soldaten somit außerhalb der SK Dienst leisten, wäre daher ein spezifisch befehlsrechtl. Unterstellungsverhältnis ohnehin nicht erforderlich.[25] Die demokratische Legitimation wird dann – auch für die dort beschäftigten Soldaten – durch die allg. Ressortleitungsbefugnis gem. Art. 65 GG gewährleistet. Umgekehrt wird die Befehls- und Kommandogewalt des Art. 65a GG nicht dadurch beeinträchtigt, dass in der Org der SK in großem Umfang Zivilpersonal eingesetzt ist, das nicht befehlsrechtl. unterstellt ist. Diesem Personal gegenüber kann der BMVg seine (verfassungsrechtl. verstandene) Befehls- und Kommandogewalt durch das beamtenrechtl. Weisungs- bzw. das arbeitsrechtl. Direktionsrecht ausüben.
21
Selbst wenn man die Befehls- und Kommandogewalt statusspezifisch in dem Sinne interpretiert, dass sie sich auf alle Soldaten erstreckt,[26] muss deshalb nicht jeder Soldat in ein mil. Vorgesetztenverhältnis i.S.d. VorgV eingebunden sein. Der Min. könnte jedem Soldaten unmittelbar auf der Grundlage des Art. 65a GG Befehle erteilen, ansonsten kann er seine Befehls- und Kommandogewalt auch über nicht-mil. Hierarchieebenen – ohne auf das förmliche Befehlsrecht zurückzugreifen zu müssen – ausüben.
Gegen die Anfügung des Abs. 3, der für Soldaten, die außerhalb mil. Vorgesetztenverhältnisse eingesetzt sind, hins. der Folgepflicht und der Verantwortung auf die entspr. Regelungen des Beamtenrechts verweist, bestehen daher keinerlei rechtl. Bedenken.[27] Ebenfalls rechtl. unproblematisch erscheint es, Soldaten aus der Befehlskette der SK herauszulösen, wenn sie in anderen OrgBereichen tätig werden sollen, ohne dass ihr Status wechselt.[28] Zu den im Rahmen der Neuausrichtung der Bw erlassenen Grundsätze[n] für die Spitzengliederung, Unterstellungsverhältnisse und Führungsorganisation im BMVg und der Bw vom 21.3.2012 (sog. Dresdner Erlass)[29] und ihren verfassungsrechtl. Aspekten s. die Komm. zu § 10 Rn. 54 f.
5. Bezüge zu anderen Rechtsvorschriften
a) Beamtenrecht
22
Der soldatischen Gehorsamspflicht entspricht die Folgepflicht bzw. Weisungsgebundenheit der Beamten gem. § 62 BBG, § 35 BeamtStG. Die beamtenrechtl. Regelungen sind insbes. hins. der Verantwortlichkeit (§ 63 BBG, § 36 BeamtStG) anders ausgestaltet. Vereinfacht lässt sich sagen, dass das mil. Befehlsrecht den Vorg. stärker in die Pflicht nimmt (vgl. § 10 Abs. 5 Satz 1) und den Befehlsempfänger von Verantwortlichkeiten entlastet, während das Beamtenrecht die Verantwortlichkeit des Beamten, auch wenn er auf Weisung handelt, grds. nicht einschränkt.
23
Bei allen rechtl. Unterschieden zwischen beamtenrechtl. Folgepflicht und soldatischer Gehorsamspflicht bleibt jedoch festzustellen, dass sich die praktischen Auswirkungen in aller Regel eher in Grenzen halten dürften. Die faktische Art und Weise der Führung dürfte im soldatischen wie im beamtenrechtl. Bereich weniger von den rechtl. Rahmenbedingungen bestimmt sein, als durch die konkrete Struktur und Aufgabenwahrnehmung. So ist bei Sondereinheiten der Polizei eine straffere Führung angezeigt als z.B. in einer mil. Dienststelle, die vorwiegend administrative oder wissenschaftliche Aufgaben zu erledigen hat. Abgesehen davon sieht auch das Beamtenrecht in besonderen Fällen des Vollzugs unmittelbaren Zwanges Regelungen vor, die abweichend von den allg. beamtenrechtl. Vorschriften an das Soldatenrecht angelehnt sind (vgl. § 7 UZwG[30]; § 97 Abs. 2 StVollzG)[31].
24
Der Soldat ist bei einem Handeln auf Befehl grds. nur verantwortlich für Straftaten. Im Übrigen wird er schadensersatzrechtl. (vgl. § 24), disziplinar- und ordnungswidrigkeitenrechtl. freigestellt. Auch eine Amtspflichtverletzung (§ 839 BGB) ist bei einem Handeln auf Befehl nicht gegeben.[32] Der Befehl hat insoweit den Charakter eines Rechtfertigungsgrundes,[33] während bei der Begehung einer Straftat auf Befehl der Soldat unter den Bedingungen der § 11 Abs. 2 Satz 2 SG und § 5 Abs. 1 WStG lediglich entschuldigt ist.[34]
25
Dem gegenüber unterliegt der Beamte regelmäßig einer umfassenden Verantwortlichkeit, von der er nur nach erfolgloser Remonstration bei seinem nächsten und nächsthöheren Vorg. befreit wird. Eine Befreiung von der Verantwortlichkeit für Ordnungswidrigkeiten ist bei Beamten – anders als bei Soldaten – grds. ausgeschlossen. Ausnahmen von der Remonstrationspflicht und der ordnungswidrigkeitenrechtl. Haftung bestehen für Beamte allerdings in den Fällen der o. g. (Rn. 23) Sonderregelungen.
26
Die gelockerte Verantwortlichkeit der Soldaten ist für die Auftragsdurchführung der SK im mil. Einsatz unabdingbar. Es bleibt dann keine Zeit, über die Rechtmäßigkeit von Befehlen zu diskutieren oder ein Remonstrationsverfahren vorzuschalten. Dennoch darf diese Befreiung von Verantwortung nicht zu einem unkrit. Gehorsam führen,[35] was aber rechtl. auch durch die Grenzen der Gehorsamspflicht gewährleistet ist.
27
Die auch für Soldaten grds. geltende Pflicht zur Gegenvorstellung gegen Befehle[36] ist systematisch nicht vergleichbar mit der Remonstrationspflicht der Beamten nach § 63 Abs. 2 Satz 1 BBG.[37] Während letztere eine quasi verfahrensrechtl. Voraussetzung dafür ist, um den Beamten unter bestimmten Voraussetzungen von seiner Verantwortlichkeit zu entlasten, stellt die soldatische Pflicht zur Gegenvorstellung, die sich nicht nur auf rechtswidrige, sondern in erster Linie auf undurchführbare oder sinnwidrige Befehle bezieht, eine eigenständige materielle Pflicht dar, die im Grunde aus der Verpflichtung zum treuen Dienen und der Pflicht zur Gewissenhaftigkeit bei der Befehlsausführung folgt.[38] Die in der Gesetzesbegr. zum SG enthaltene Formulierung, dass eine „Pflicht zur Gegenvorstellung nicht begründet werden“ soll,[39], ist insoweit missverständlich. Mit dieser Formulierung dürfte vielmehr gemeint gewesen sein, dass der Soldat nicht erst remonstrieren muss, um von der Verantwortlichkeit bei einem Handeln auf Befehl freigestellt zu werden.
b) Strafrecht
28
Vor der gesetzl. Verankerung der mil. Gehorsamspflicht im soldatischen Dienstrecht fanden sich gesetzl. Regelungen zum mil. Befehl ausschließlich im MStGB[40]. Auch heute noch bezieht sich ein hoher Anteil nationaler wie internationaler befehlsrechtl. Lit. und Rspr. auf strafrechtl. Aspekte.
Befehlsrecht und Strafrecht weisen in zweierlei Hinsicht enge Verbindungen auf. Anders als im Beamtenrecht kann der Ungehorsam gegenüber einem mil. Befehl eine Straftat begründen. Dies setzt spezifische (wehr-)strafrechtl. Regelungen voraus, die an den Befehl anknüpfen (s. §§ 19, 20, 21, 22 WStG).
29
Andererseits soll das Handeln auf Befehl auch eine entlastende Wirkung für den Soldaten zur Folge haben, was spezifische Regelungen über die strafrechtl. Folgen bedingt, wenn die Straftat auf Befehl begangen wurde (§ 5 WStG). Dies ist keine Besonderheit der deutschen Rechtsordnung, sondern eine in allen Wehrrechtsordnungen sowie im Völkerstrafrecht seit langem erörterte Problematik. Dem entspr. wurde bereits bei der Erarbeitung des aktuellen Befehlsrechts in ungewöhnlich hohem Maße auf Rechtsvergleiche insbes. zu den wehrstrafrechtl. Regelungen anderer Staaten abgestellt.[41] Dabei dürfte sich inzwischen trotz aller noch bestehenden unterschiedlichen rechtspolit. Vorstellungen über das Verhältnis von Befehl und strafrechtl. Verantwortlichkeit[42] die Auffassung als vorherrschend erwiesen haben, dass eine generelle Straflosigkeit auch bei einem Handeln auf Befehl nicht in Frage kommt und insbes. bei schweren, offenkundigen Straftaten ausscheiden muss. Andererseits hat sich die sog. „strict liability“-Rule, die Befehle als grds. unbeachtlich qualifiziert, nicht durchgesetzt. Sie lag zwar dem Nürnberger Internationalen Militärtribunal (IMT)[43] sowie den Ad-hoc-Tribunalen für das ehem. Jugoslawien[44] und für Ruanda[45] zu Grunde. In Art. 33 des Rom-Statuts zum Internationalen Strafgerichtshof[46] wurde jedoch eine ausgewogenere Kompromisslösung gefunden.
30
Im nationalen deutschen Wehrstrafrecht sind § 5 WStG und § 3 VStGB die einschlägigen Vorschriften. Sie geben rechtssystematisch konsequent die dienstrechtl. Regelung des § 11 Abs. 2 Satz 2 wieder und begründen einen besonderen Verbotsirrtum, der Soldaten gegenüber der allg. Regelung des § 17 StGB privilegiert.[47]