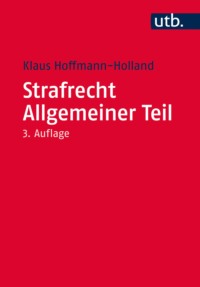Kitabı oku: «Strafrecht Allgemeiner Teil», sayfa 4
6. Begehungs- und Unterlassungsdelikte
53Begehungsdelikte sind Straftaten, die durch ein aktives Tun verwirklicht werden, während der Tatbestand von Unterlassungsdelikten durch Untätigbleiben erfüllt wird. Innerhalb der Unterlassungsdelikte ist zu unterscheiden zwischen sog. echten Unterlassungsdelikten, bei denen das strafbare Unterlassen im Besonderen Teil tatbestandlich speziell beschrieben ist (z.B. §§ 123 Abs. 1 Var. 2, 138, 323c StGB) und sog. unechten Unterlassungsdelikten. Das strafbare Unterlassen bei unechten Unterlassungsdelikten ist gesetzlich nicht speziell festgelegt, sondern in § 13 Abs. 1 StGB allgemein geregelt. Wenn jemand nicht verhindert, dass ein tatbestandlicher Erfolg eintritt, ist er nach § 13 Abs. 1 StGB hierfür nur dann strafbar, wenn er rechtlich dafür einzustehen hat, dass der Erfolg ausbleibt. Um Täter zu sein, muss ihn also eine besondere Pflicht, die sog. Garantenpflicht treffen. Eine solche hat bspw. ein Vater im Hinblick auf seine Kinder inne, so dass er nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB wegen Totschlags durch Unterlassen schuldig ist, wenn er seinen Sohn nicht vor dem Ertrinken rettet, obwohl ihm dies möglich wäre.
|18|7. Vollendetes Delikt, versuchtes Delikt und Unternehmensdelikt
54Bei vollendeten Delikten erfüllt der Täter alle objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale. Beim versuchten Delikt liegt der subjektive Tatbestand (der beim Versuch als Tatentschluss bezeichnet wird) vollständig vor, während es an einem objektiven Tatbestandsmerkmal fehlt, insoweit also keine Vollendung eingetreten ist. Versucht (und nicht bloß vorbereitet) ist die Tat gem. § 22 StGB nur, wenn der Täter nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestands unmittelbar angesetzt hat.
55Unternehmensdelikte[49] sind Straftaten, bei denen nach der Legaldefinition des § 11 Abs. 1 Nr. 6 StGB Versuch und Vollendung gleichgestellt sind. Echte Unternehmensdelikte enthalten schon im gesetzlichen Tatbestand den Begriff „unternehmen“. Bei unechten Unternehmensdelikten fehlt dieser Begriff zwar, aber aus der Tatbestandsformulierung ergibt sich, dass die Vollendung schon bei Vornahme der Tathandlung gegeben sein kann, z.B. bei der Jagdwilderei gem. § 292 Abs. 1 Nr. 1 Var. 1 StGB, die voraussetzt, dass dem Wilde nachgestellt wird (ohne dass es gefangen oder erlegt werden muss).
8. Allgemeindelikte und Sonderdelikte
56Bei der Einteilung der Delikte kann auch hinsichtlich des potenziellen Täterkreises unterschieden werden. Die meisten Delikte des StGB können von „jedermann“ verwirklicht werden und stellen daher Allgemeindelikte dar. Daneben existiert aber auch eine Reihe von Tatbeständen, deren Begehung von vornherein nur einem ganz bestimmten Täterkreis möglich ist, die sog. Sonderdelikte. So kann bspw. eine Körperverletzung im Amt (§ 340 StGB) nur ein Amtsträger begehen und eine Verletzung von Privatgeheimnissen nur durch eine der in § 203 Abs. 1, 2 StGB ausdrücklich genannten Personen verwirklicht werden.
9. Dauer- und Zustandsdelikte
57Im Strafrecht kann zeitlich zwischen der (grundsätzlich straflosen) Vorbereitungshandlung, dem Versuch, der Vollendung und der Beendigung unterschieden werden (hierzu noch Rn. 611ff.). Diese Unterscheidung wirkt sich bei den Dauer- und Zustandsdelikten aus. Bei den Zustandsdelikten ist mit der Vollendung, d.h. der Erfüllung sämtlicher Tatbestandsmerkmale, grundsätzlich auch die Beendigung eingetreten. Bsp. für ein Zustandsdelikt ist die Körperverletzung nach § 223 Abs. 1 StGB. Dort kommt es mit Vornahme der Tathandlung zum Verletzungserfolg, die Tat ist gleichzeitig vollendet und beendet. Anders ist dies bei den Dauerdelikten. Dort fallen die Zeitpunkte der Vollendung und Beendigung auseinander. Der Täter hält den rechtswidrigen Zustand aufrecht und lässt dadurch den von ihm herbeigeführten Erfolg fortdauern. Ein Bsp. |19|für ein Dauerdelikt ist die Freiheitsberaubung nach § 239 StGB. Dort tritt mit der Tathandlung ebenfalls ein rechtwidriger Zustand (der Verlust der Freiheit) ein, dieser kann aber vom Täter aufrechterhalten werden. Beendet ist die Freiheitsberaubung daher erst dann, wenn das Opfer seine Freiheit wieder erlangt.[50]
10. Eigenhändige Delikte
58Einzelne Tatbestände im Besonderen Teil des StGB können nur durch eigenhändige Ausführung der Tathandlung durch den Täter erfüllt werden. Dazu gehören bspw. die Aussagedelikte nach §§ 153ff. StGB. Derjenige, der die Tathandlung nicht selbst ausführt, kann nicht Täter des eigenhändigen Delikts, sondern allenfalls Teilnehmer sein.[51]
VI. Geltungsbereich des deutschen Strafrechts
59Die §§ 3–7 StGB regeln das sog. internationale Strafrecht.[52] Diese Bezeichnung ist insofern irreführend, als die Vorschriften nie die Anwendung ausländischen Strafrechts bestimmen, vielmehr diejenigen Prinzipien enthalten, aus denen sich die räumliche und personelle Geltung des deutschen Strafrechts ergibt. Die Funktion der §§ 3ff. StGB liegt somit in der Festlegung des Anwendungsbereichs des deutschen materiellen Strafrechts, so dass die Bezeichnung „deutsches Strafanwendungsrecht“[53] insgesamt treffender erscheint. In der Fallbearbeitung ist darauf nur dann einzugehen, wenn eine im Sachverhalt geschilderte Tat einen Bezug zum Ausland hat, also insbesondere dann, wenn die Tathandlung im Ausland vorgenommen wird und/oder der Taterfolg im Ausland eintritt.[54] Ist dies der Fall, ist noch vor der Prüfung der einzelnen Strafbarkeitsvoraussetzungen gesondert festzustellen, ob das deutsche Strafrecht überhaupt Anwendung findet.
60Auf der Grundlage des im StGB normierten Strafanwendungsrechts findet deutsches Strafrecht in erster Linie Anwendung, wenn eine Straftat innerhalb des Staatsgebiets der BRD begangen wurde. Nach den §§ 4ff. StGB fallen aber auch bestimmte Straftaten unter die deutsche Strafgewalt, die im Ausland begangen wurden, so dass das deutsche Strafanwendungsrecht insgesamt als partiell erweitertes Territorialitätsprinzip charakterisiert werden kann.[55]
|20|1. Grundprinzip: Territorialitätsprinzip
61Im Ausgangspunkt ist der Geltungsbereich des deutschen Strafrechts nach dem in § 3 StGB niedergelegten Territorialitätsprinzip zu bestimmen. Danach gilt deutsches Strafrecht für alle Taten, die im Inland begangen werden, bei denen also der Tatort (oder bei mehreren Tatorten mindestens einer) im Inland liegt. Zum Inland gehören in erster Linie das gesamte Staatsgebiet der BRD mit seinen Eigen- und Küstengewässern sowie der über diesen Flächen befindliche Luftraum und das Erdinnere.[56] Ob der Tatort im Inland liegt, ist auf der Grundlage von § 9 StGB zu ermitteln. Nach § 9 Abs. 1 StGB ist die Tat sowohl am Handlungsort als auch an dem Ort begangen, an dem der tatbestandliche Erfolg eingetreten ist oder nach der Vorstellung des Täters eintreten sollte. Zu beachten ist, dass Handlungsort i.S.v. § 9 Abs. 1 StGB nur derjenige Ort ist, an dem der Täter die seine Strafbarkeit begründende Handlung vorgenommen hat. Orte der Deliktsvorbereitung, an denen der Täter sich auf Handlungen beschränkt hat, welche die spätere Deliktsbegehung lediglich vorbereiten sollen, die aber selbst kein tatbestandliches Unrecht verwirklichen, bleiben außer Betracht. Ebenso liegt der Erfolgsort grundsätzlich nur dort, wo der gesetzlich umschrieben Erfolg eingetreten ist. Der Eintritt eines außertatbestandlichen Erfolges, welcher sich nicht auf die strafrechtliche Beurteilung des Geschehens auswirkt, begründet daher keinen zusätzlichen Erfolgsort.[57]
62Zusammenfassend ergibt sich aus der Gesamtschau von § 3 und § 9 Abs. 1 StGB, dass deutsches Strafrecht regelmäßig dann Anwendung findet, wenn der Täter die zum Erfolg führende Handlung im Inland vorgenommen hat und/oder der tatbestandliche Erfolg im Inland eingetreten ist.
a) Anwendung des Territorialitätsprinzips bei einzelnen Deliktsgruppen
63Unproblematisch gestaltet sich die Anwendung der §§ 3, 9 Abs. 1 StGB in der Regel bei vollendeten Begehungs- und schlichen Tätigkeitsdelikten.[58] Während hinsichtlich Ersterer deutsches Strafrecht Anwendung findet, wenn der Täter im Inland gehandelt hat und/oder der Erfolg im Inland eingetreten ist, ist für Letztere allein entscheidend, ob der Täter im Inland gehandelt hat. Bleibt die Tat im Versuchsstadium stecken, findet deutsches Strafrecht Anwendung, wenn der Täter die seine Strafbarkeit begründende Handlung im deutschen Inland vorgenommen hat und/oder der Erfolg nach der Vorstellung des Täters in selbigem eintreten sollte. Bei Unterlassungsdelikten erfolgt die Prüfung des deutschen Strafanwendungsrechts grundsätzlich parallel zu den Begehungsdelikten, jedoch liegt der Handlungsort hier nicht an dem Ort, an dem der |21|Täter gehandelt hat, sondern an demjenigen, an dem er hätte handeln müssen.[59] Ein zusätzlicher Erfolgsort wird bei den erfolgsqualifizierten Delikten durch den Ort begründet, an dem die besondere Folge eintritt.
64Schwierigkeiten bereitet die Anwendung des § 9 Abs. 1 StGB auf Gefährdungsdelikte. Unproblematisch anwendbar ist deutsches Strafrecht auch bei diesen, wenn der Handlungsort im Inland liegt, also bspw. ein PKW-Fahrer mit einer BAK von 1,4 ‰ durch Berlin fährt und hierdurch den objektiven Tatbestand von § 316 Abs. 1 StGB erfüllt. Für die Frage, ob die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts auch unter Anknüpfung an den Erfolgsort begründet werden kann, ist demgegenüber entscheidend, ob ein konkretes oder abstraktes Gefährdungsdelikt vorliegt. Die konkreten Gefährdungsdelikte setzen für die Tatbestandsverwirklichung voraus, dass es tatsächlich zum Eintritt einer konkreten Gefahr kommt. Da sie mithin einen Erfolgsort vorsehen, kann deutsches Strafrecht über § 3 i.V.m. § 9 Abs. 1 StGB auch dadurch zur Anwendung gelangen, dass der Gefährdungserfolg im deutschen Staatsgebiet eintritt. Demgegenüber knüpfen die abstrakten Gefährdungsdelikte die Strafbarkeit allein an die Vornahme einer gefährlichen Handlung, unabhängig davon, ob es tatsächlich zu einer gefährlichen Situation gekommen ist. Dementsprechend wird teilweise vertreten, dass abstrakte Gefährdungsdelikte über keinen Erfolgsort i.S.v. § 9 Abs. 1 StGB verfügen und der Tatort somit allein durch den Handlungsort bestimmt wird.[60] Demgegenüber verweist die Gegenauffassung zutreffend darauf, dass auch die abstrakten Gefährdungsdelikte eine Erfolgskomponente aufweisen, nämlich das potenzielle Umschlagen in eine konkrete Gefahr oder eine Rechtsgutsverletzung.[61] Somit ist auch bei den abstrakten Gefährdungsdelikten der Tatort nicht nur am Handlungsort begründet, sondern auch an denjenigen Orten, an denen die Gefahr mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in eine nachteilige Veränderung des geschützten Rechtsgutes umschlagen kann. Keinerlei Schwierigkeiten entstehen dementsprechend auch bei den abstrakt-konkreten Gefährdungsdelikten, die eine bestimmte Eignung einer an sich abstrakten Gefahr voraussetzen (vgl. etwa § 130 Abs. 1 StGB: Eignung zur Gefährdung des öffentlichen Friedens). Der Erfolgsort ist hier an jedem Ort begründet, an dem die vom Tatbestand geforderte Eignung festgestellt werden kann.[62]
b) Sonderprobleme
65Erhebliche Probleme kann die Bestimmung von Handlungs- und Erfolgsort bei einer Deliktsbegehung übers Internet bereiten.[63] Überwiegend wird der Handlungsort nach dem Aufenthaltsort des Täters im Zeitpunkt der Tatbegehung|22| bestimmt, also danach, an welchem Ort er strafrechtlich relevante Inhalte auf einer Website einstellt bzw. abruft.[64] Kontrovers diskutiert wird demgegenüber, unter welchen Voraussetzungen der Erfolgsort einer Internetstraftat im Inland liegt. Die vereinzelt in Betracht gezogene Begründung eines innerdeutschen Erfolgsortes für jeden Internetinhalt, der in Deutschland abgerufen werden kann[65], wird überwiegend abgelehnt, da dies eine völkerrechtlich nicht zu legitimierende Anwendbarkeit des deutschen Strafrechts auf praktisch sämtliche Inhalte des Internets zur Folge hätte.[66] Überwiegend wird daher gefordert, dass der betroffene Internetinhalt eine über die bloße Möglichkeit der Abrufbarkeit hinausgehende Beziehung zu Deutschland aufweist. Wie diese Beziehung ausgestaltet sein muss, ist indes weitgehend unklar. Während einige einen objektiv-territorialen Bezug fordern, der etwa in der Verwendung der deutschen Sprache oder der deutschen Staatsangehörigkeit des Handelnden gesehen werden könne, fordern andere ein Abstellen auf subjektive Kriterien: Dem Täter soll es gerade darauf ankommen müssen, dass die betroffenen Inhalte in Deutschland abgerufen werden.[67]
66Der BGH hat sich zu den Einzelheiten der Tatortbestimmung bei Internettaten noch nicht eindeutig geäußert, vielmehr stellt er für die Frage nach der Anwendbarkeit deutschen Strafrechts auf im Internet begangene Taten primär auf die Deliktsstruktur der jeweils einschlägigen Strafnorm ab.[68]
67Keine Anwendung findet deutsches Strafrecht in der Regel auf sog. Transitdelikte. Diese stellen Distanzdelikte dar, bei den das Tatobjekt auf dem Weg von einem ausländischen Handlungsort zu einem ausländischen Erfolgsort das deutsche Territorium lediglich durchquert.[69] Da etwa für den Fall, dass ein im Staat X abgesandter Brief, der eine Beleidigung enthält, durch Deutschland transportiert und schließlich im Staat Y geöffnet wird, weder Handlungs- noch Erfolgsort in Deutschland liegen, sind die Voraussetzungen der §§ 3, 9 Abs. 1 StGB nicht erfüllt.[70] Anders ist allerdings zu entscheiden, wenn der Transport selbst einen gesetzlichen Tatbestand erfüllt, was regelmäßig bei der unerlaubten Durchfuhr von Betäubungsmitteln der Fall ist.
68Unterschiedlich beurteilt wird zuletzt, ob der Erfolgsort auch dann im deutschen Inland liegt, wenn es dort lediglich zum Eintritt einer objektiven Bedingung der Strafbarkeit (z.B. der Eintritt der schweren Folge in § 231 StGB; vgl. hierzu noch Rn. 205) gekommen ist. Die überwiegende Auffassung bejaht dies, da die in § 9 Abs. 1 StGB gebrauchte Formulierung „zum Tatbestand gehörender|23| Erfolg“ nicht technisch zu verstehen sei, sondern nur solche Erfolge ausschließen solle, denen für die strafrechtliche Würdigung des Geschehens keine Bedeutung zukommt (vgl. bereits Rn. 61). Eine beachtliche Gegenauffassung führt demgegenüber an, dass es sich bei objektiven Bedingungen der Strafbarkeit um täterbegünstigende, da strafbarkeitsbegrenzende Merkmale handle, die als Anknüpfungspunkt für die Anwendung deutschen Strafrechts nicht in Betracht kämen.[71]
c) Anwendung des Territorialitätsprinzips bei mehreren Tatbeteiligten
69Auch im Fall der Tatbeteiligung von mehreren Personen ist die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts im Ausgangspunkt nach den §§ 3, 9 Abs. 1 StGB zu prüfen.[72] Im Fall der Mittäterschaft legt die überzeugende h.M. eine Zurechnungslösung zugrunde, wonach jeder Ort, an dem auch nur einer der Mittäter gehandelt hat, einen tatortbegründenden Handlungsort darstellt. Ebenso liegt für den mittelbaren Täter der Handlungsort nicht nur dort, wo er selbst gehandelt hat, sondern auch an dem Ort, an dem der von ihm eingesetzte Tatmittler tätig geworden ist. Ist im konkreten Fall die Frage nach der Anwendbarkeit deutschen Strafrechts für einen Teilnehmer zu prüfen, so ist die Regelung in § 9 Abs. 2 StGB zu beachten, wonach sich der Tatort für den Teilnehmer nach dem Tatort der Haupttat und dem Ort der Teilnahmehandlung bestimmt. Die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts kann für einen Anstifter oder Gehilfen somit sowohl durch seinen eigenen Handlungsort als auch durch sämtliche Tatorte des Haupttäters begründet werden.
2. Ausnahmen vom Territorialitätsprinzip
70Über die §§ 4–7 StGB kann deutsches Strafrecht in bestimmten Konstellationen auch dann Anwendung finden, wenn weder Handlungs- noch Erfolgsort im Inland liegen und daher der nach dem Territorialitätsprinzip erforderliche Anknüpfungspunkt fehlt.[73] § 4 StGB enthält das sog. Flaggenprinzip, wonach deutsches Strafrecht für alle Taten gilt, die auf Schiffen oder Luftfahrzeugen begangen werden, die berechtigt sind, die Bundesflagge oder das Staatszugehörigkeitszeichen der BRD zu führen.
71Die §§ 5 und 6 StGB enthalten jeweils einen Katalog von Straftaten, auf die deutsches Strafrecht auch dann Anwendung findet, wenn Sie im Ausland begangen werden. Die Erweiterung des Anwendungsbereichs durch § 5 StGB beruht auf dem Staatsschutz-, dem Individualschutz-, dem aktiven Personalitäts- sowie dem Domizilprinzip. Zum Schutz bestimmter inländischer |24|Kollektiv- bzw. Individualrechtsgüter bzw. im Hinblick auf die deutsche Staatsangehörigkeit des Täters oder den innerdeutschen Wohnsitz des Täters bzw. des Opfers soll deutsches Strafrecht für bestimmte Straftaten unabhängig davon Anwendung finden, ob der Tatort im In- oder Ausland begründet ist. Unerheblich für die Anwendung von § 5 StGB ist ferner, ob die Tat nach dem Recht des Tatorts unter Strafe steht. Demgegenüber ist § 6 StGB Ausdruck des Weltrechtsprinzips. Anknüpfungspunkt für die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts ist hier, dass sich die benannten Taten gegen international anerkannte Werte richten, so dass die Strafverfolgung im Interesse der gesamten Staatengemeinschaft liegt.
72§ 7 StGB ist Ausdruck des aktiven und passiven Personalitätsprinzips sowie des Prinzips der stellvertretenden Strafrechtspflege. Mindestvoraussetzung für die einzelnen Varianten des § 7 StGB ist, dass die Auslandstat am Tatort mit Strafe bedroht ist oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt. § 7 Abs. 1 StGB bringt das passive Personalitätsprinzip zum Ausdruck, wonach deutsches Strafrecht auf im Ausland begangene Taten Anwendung findet, die sich gegen einen Deutschen richten. § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB sieht im Sinne eines eingeschränkten aktiven Personalitätsprinzips die Geltung des deutschen Strafrechts auch für Auslandstaten vor, wenn der Täter zur Zeit der Tat Deutscher war oder es nach der Tat geworden ist. § 7 Abs. 2 Nr. 2 StGB erfasst im Rahmen stellvertretender Strafrechtspflege Fälle der Nicht-Auslieferung von Ausländern.
3. Leitentscheidungen
73BGHNJW1991, 2498; Anwendung der §§ 3, 9 StGB bei Mittätern, Gehilfen und Nebentätern: Ein Generalmajor des Ministeriums für Staatsicherheit (MfS) der DDR bewirkt zusammen mit zwei Mitarbeitern des BND, dass in den Jahren 1974–1988 die jährlich vom BND herausgegebenen militärischen Lageberichte Ost an die Führung der DDR weitergeleitet werden. Der Generalmajor wird hierbei nur innerhalb des Staatsgebiets der DDR tätig, während die Mitarbeiter des BND auch innerhalb der BRD aktiv werden. – Unabhängig davon, ob der Generalmajor als Mittäter, Nebentäter oder lediglich als Gehilfe zur Tat nach § 94 Abs. 1 Nr. 1 StGB (Landesverrat) anzusehen ist, findet auf sein Verhalten bundesdeutsches Strafrecht nach §§ 3, 9 StGB Anwendung. Auch dem außerhalb der BRD handelnden Mittäter wird das Verhalten der im Inland agierenden Tatbeteiligten zugerechnet, so dass der durch das Tätigwerden der Mitarbeiter des BND begründete innerdeutsche Handlungsort auch dem Generalmajor zugerechnet werden kann. Im Fall der Beihilfe würde sich die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts aus § 9 Abs. 2 StGB ergeben, wonach die Teilnahme auch am Begehungsort der Haupttat begangen ist. Ist der Generalmajor als Nebentäter anzusehen, ergibt sich die Anwendbarkeit deutschen Strafrechts daraus, dass es sich bei § 94 StGB um ein konkretes Gefährdungsdelikt handelt und die konkrete Gefahr eines schweren Nachteils für die BRD im Inland eingetreten und daher der Erfolgsort i.S.v. § 9 Abs. 1 StGB im Inland begründet ist.
74|25|BGHSt 42, 275, 276f.; Aktives Personalitätsprinzip (§ 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB): Ein Westberliner Bürger erklärt sich im Jahr 1978 dazu bereit, für das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR zu arbeiten. Als er 1982 erfährt, dass ein bekannter Athlet aus der DDR fliehen möchte, meldet er dies beim MfS, woraufhin der Athlet festgenommen und wegen „Vorbereitung zum ungesetzlichen Grenzübertritt im schweren Fall“ zu einer Freiheitsstrafe verurteilt wird. – Auf das Verhalten des Westberliner Bürgers findet deutsches Strafrecht über § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB Anwendung, so dass dieser aufgrund der Informierung des MfS und der anschließenden Inhaftierung des Athleten als „Täter hinter dem Täter“ wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft (§§ 239, 25 Abs. 1 Var. 2 StGB) bestraft werden kann. § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB fordert neben der deutschen Staatsangehörigkeit des Täters, dass die Tat auch am Tatort unter Strafe steht oder der Tatort keiner Strafgewalt unterliegt. Zwar setzte eine strafbare mittelbare Täterschaft nach § 22 Abs. 1 StGB-DDR zwingend den Einsatz eines „selbst nicht verantwortlich“ Handelnden voraus, so dass der Westberliner Bürger nach DDR-Strafrecht nicht als „Täter hinter dem Täter“ bestraft werden könnte. Für § 7 Abs. 2 Nr. 1 StGB reicht es jedoch aus, dass das Tatortrecht unter irgendeinem rechtlichen Gesichtspunkt eine Bestrafung für die Tat vorsieht, was in § 131 StGB-DDR für die Freiheitsberaubung der Fall war.
75BGHSt 46, 212, 220ff.; Erfolgsort bei abstrakt-konkreten Gefährungsdelikten: Ein australischer Staatsbürger stellt von Australien aus wiederholt Artikel ins Internet, in denen er den Holocaust leugnet. – Der BGH wendet deutsches Strafrecht nach § 3 i.V.m. § 9 StGB an. Der Eintritt des Erfolges im Sinne des § 9 StGB erfolge bei abstrakt-konkreten Gefährdungsdelikten dort, wo die Tat ihre Gefährlichkeit im Hinblick auf das im Tatbestand umschriebene Rechtsgut entfalten kann. Bei § 130 Abs. 1 und Abs. 3 StGB käme es insoweit auf die konkrete Eignung zur Friedensstörung in der BRD an, die bei Verbreitung der den Holocaust leugnenden Inhalte übers Internet zu bejahen sei.