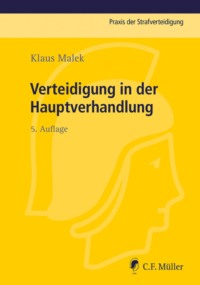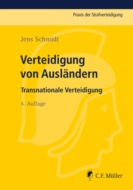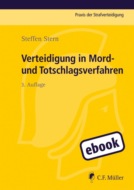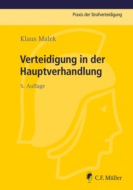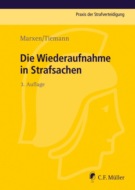Kitabı oku: «Verteidigung in der Hauptverhandlung», sayfa 6
Anmerkungen
[1]
Ausführliche Darstellungen finden sich z.B. bei Barton § 4 Rn. 2 ff.; Salditt in: MAH Strafverteidigung § 1 und Beulke/Ruhmannseder Rn. 10 ff.; s.a. Beulke StV 2007, 261; Dornach S. 32 ff.; ders. NStZ 1995, 57.
[2]
BVerfGE 38, 105, 119; 53, 207, 214; BGH 9, 20, 22; 15, 326; Augstein NStZ 1981, 52; Beulke Strafprozessrecht Rn. 163 ff., 200; ders. Der Verteidiger im Strafverfahren, S. 163 ff., 200; Hellmann Strafprozessrecht § 6 Rn. 6; Roxin/Schünemann § 19 A II 3; Rückel NStZ 1987, 297, 299; Meyer-Goßner/Schmitt vor § 137 Rn. 1; Fischer StGB § 258 Rn. 7.
[3]
BVerfGE 34, 239, 302.
[4]
BGH 13, 337, 343; Hammerstein NStZ 1990, 261, 264.
[5]
Krekeler NStZ 1989, 146; Liemersdorf MDR 1989, 204.
[6]
Ostendorf NJW 1978, 1345 ff.; Gatzweiler StV 1985, 248 ff.; Lüderssen FS Dünnebier S. 263 ff.; LR-Lüderssen/Jahn vor § 137 Rn. 33 ff.
[7]
Völlig zurecht weisen Beulke/Ruhmannseder Rn. 10, darauf hin, dass die Rechtsstellung des Strafverteidigers nicht Ausgangspunkt, sondern Ergebnis der Analyse des Prozessrechts sein müsse. Dem ist beizupflichten.
[8]
Vgl. LR-Lüderssen/Jahn vor § 137 Rn. 77 unter Berufung auf Dahs NJW 1975, 1387.
[9]
BGH StV 1999, 153 ff.; dagegen Gillmeister FS Schiller, S. 184, der das Verbot auf die „Beratung zur Lüge“ begrenzen will.
[10]
Kleine-Cosack AnwBl. 2009, 495; dagegen fragt Gillmeister FS Schiller, S. 186 zu Recht, wer den „rechtsstaatlich vertretbaren Zweck“ definieren soll.
[11]
Z.B. Dahs StraFo 2000, 181; Krekeler NStZ 1989; Salditt StV 1999, 64.
[12]
Gillmeister FS Schiller, S. 187.
[13]
Gillmeister FS Schiller, S. 187.
[14]
OLG Nürnberg StV 1995, 287 m. Anm. Barton StV 1995, 290.
[15]
Vgl. Kohlmann FS Peters, S. 311 ff.; kritisch Steiner S. 204.
[16]
Im Einzelnen hierzu Kohlmann FS Peters, S. 320.
[17]
So beispielsweise Geipel Handbuch der Beweiswürdigung, der meint, es handele sich um eine in unsere Gesellschaft mitgeschleppte „Lebenslüge“ der Staatsanwaltschaft.
[18]
Carsten/Rautenberg S. 144 machen den späteren Generalstaatsanwalt Hugo Isenbiel dafür verantwortlich, der den Begriff in einem Plädoyer im Dezember 1900 verwendet haben soll.
[19]
„Ich gebe eines zu: die Parteistellung der Staatsanwaltschaft ist allerdings durch unsere Prozeßordnung besonders verdunkelt worden. Durch die Aufstellung des Legalitätsprinzips, durch die dem Staatsanwalt auferlegte Verpflichtung, in gleicher Weise Entlastungs- wie Belastungsmomente zu prüfen, durch das ihm eingeräumte Recht, Rechtsmittel zugunsten des Beschuldigten einzulegen, usw. könnte ein bloßer Ziviljurist zu der Annahme verleitet werden, als wäre die Staatsanwaltschaft nicht Partei, sondern die objektivste Behörde der Welt. Ein Blick in das Gesetz aber reicht aus, um diese Entgleisung als solche zu erkennen“ (v. Liszt DJZ 1901, 179, Wiederabdruck in: Berliner Anwaltsblatt 2001, 159).
[20]
Sieht man einmal von einer mündlichen Bemerkung des Bundesanwalts Schneider im Revisionsverfahren 5 StR 181/06 (Fall Hoyzer) ab, der dieses Prädikat tatsächlich für die Staatsanwaltschaft reklamiert und beim Senatsvorsitzenden Basdorf sogar Zustimmung gefunden hat (Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.12.2006).
[21]
Zum Umgangston des Verteidigers vgl. Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung, §2 Rn. 99.
[22]
Womit wahrscheinlich vielen Richtern Unrecht getan wird.
[23]
Föhrig Kleines Strafrichterbrevier, S. 52; die übrigen Kennzeichen sind sinnloses Gebrülle, Provokation der Richter, Einschüchterung der Belastungszeugen und filibusterhafte Befragungen; im Gewande des Lehrbuchs für Richter und Staatsanwälte finden sich ähnliche Ausführungen bei Heinrich Konfliktverteidigung im Strafprozess, 2013.
[24]
Föhrig S. 53.
[25]
Föhrig S. 53; die Anwaltskammer veranlasse natürlich nichts, da der Anwalt so lange sakrosankt sei, bis er sich an Mandantengeldern vergreife.
[26]
Hierzu Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung, § 2 Rn. 103, der eindrucksvoll die „Strafprozessuale Landschaft“ in Deutschland beschreibt: „Der Verteidiger muss wissen, wo er verteidigt.“ Ich neige dazu, dies zu relativieren. Dem Verfasser scheint insgesamt doch wichtiger, bei wem er verteidigt, als wo.
[27]
Auch hierzu sehr lesenswert die Ausführungen von Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung, Rn. 30 ff., der sich ausführlich mit den vor allem von Verteidigern geäußerten Ansichten auseinander setzt
[28]
Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung, Rn. 38.
[29]
Der Begriff des Vertrauensverhältnisses darf nicht in dem Sinne missverstanden werden, dass der Verteidiger seinem Mandanten stets vertrauen müsste, um ihn bestmöglich verteidigen zu können. In manchen Fällen verbieten schon die Fakten eine solche Hinwendung. Falsche Kumpanei, die vermutlich eigene Unsicherheiten des Verteidigers überdecken oder den Mandanten binden soll, ist immer schädlich. In der Regel spürt dies der Mandant und reagiert entsprechend. Es muss nicht immer so schlimm ausgehen, wie in dem in BGH NJW 2009, 2690 entschiedenen Fall der Richterbeleidigung durch den Verteidiger im Mandantengespräch, vgl. hierzu Ruhmannseder NJW 2009, 2647.
[30]
Eine sehr rigorose Haltung vertritt hierzu Dahs (Handbuch Rn. 161), der sich von einem Mandanten trennen will, wenn dieser in seiner Einlassung zur Sache verbohrt und eigensinnig ist, und bestreitet, obwohl ihn der Verteidiger für hoffnungslos überführt hält.
[31]
Gillmeister FS Schiller, S. 183.
[32]
So auch Gillmeister FS Schiller, S. 178.
[33]
Ausführlich hierzu Pfordte/Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung § 17.
[34]
Das auch heute noch lesenswerte Referat ist abgedruckt in NJW 1993, 2152-2157.
[35]
Ausnahmen stellen Schlothauer Vorbereitung der Hauptverhandlung Rn. 28 ff. und Beulke/Ruhmannseder Rn. 82 ff. dar.
[36]
Dünnebier, Generalstaatsanwalt a.D., stellt in FS Pfeiffer, 1988, S. 265 ff. zu dieser 1974 durchgeführten Gesetzesänderung Folgendes fest: „Das waren Überlegungen, die während dreier Menschenalter niemandem eingefallen waren. Von Rechtsprechung und Schrifttum waren sie nicht angeregt worden … Der wahre Grund der Änderung lag im Baader-Meinhof-Verfahren, wenn auch der auslösende Anlass im Dunkeln geblieben ist.“
[37]
Richter II NJW 1993, 2152, 2153.
[38]
BGH 20, 298, 300; Richter II NJW 1993, 2152, 2153; Pfordte/Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung § 17 Rn. 16.
[39]
Vgl. OLG Frankfurt NStZ 1981, 144.
[40]
So auch Pfordte/Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung § 17 Rn. 19.
[41]
OLG Frankfurt NStZ 1981, 144. Dies ist keine Frage der Zurückschneidung der Einlassung des Mandanten „auf das Vermittelbare“, wie Richter II NJW 1993, 2152, 2155 meint; die Empfehlung an den Mandanten „lassen Sie es doch weg“ ist unproblematisch zulässig, bedenklich wird es erst bei dem Rat an den Mandanten, es doch mit dem Gegenteil seiner Erinnerung zu versuchen. Richters Definition eines Wahrheitsbegriffs als „Entwicklungsprozess“ versucht das Problem (vergeblich) zu umschiffen; viele Gerichte sind altmodisch und realistisch genug, eine objektive Realität außerhalb des Strafprozesses anzunehmen und dies den Angeklagten spüren zu lassen; zur Raterteilung durch den Verteidiger sehr ausführlich Krekeler FS Friebertshäuser, S. 53 ff.
[42]
OLG Karlsruhe NStZ 1999, 212 m. abl. Anm. Stark NStZ 1999, 213; vgl. hierzu auch Kleine-Cosack StraFo 1998, 149 ff., wonach § 3 Abs. 2 BORA im Strafverfahren unanwendbar und eine Sozietätserstreckungsregelung bei einem offenen Interessenkonflikt ohnehin nicht notwendig sei, da der Mandant das Mandat jederzeit kündigen könne; a.A. Eylmann StraFo 1998, 145 ff.
[43]
Vgl. BVerfGE 45, 272, 295 ff.; LG Regensburg NJW 2005, 2245.
[44]
Vgl. Strafrechtsausschuss der BRAK, „Thesen zur Strafverteidigung“, Schriftenreihe der BRAK, Bd. 8, 1992, These 13; bei einer Sockelverteidigung im Unternehmensstrafrecht gilt nichts Anderes, vgl. Berndt/Theile Rn. 513.
[45]
Vgl. Richter II NJW 1993, 2152, 2156.
[46]
Nach Richter II NJW 1993, 2152, 2156 ist Sockelverteidigung immer eine „Verabredung auf Zeit“; vgl. dazu auch Pfordte/Tsambikakis in: MAH Strafverteidigung § 17 Rn. 36 ff.
[47]
Richter II NJW 1993, 2152, 2156.
[48]
Gollwitzer JR 1993, 215.
[49]
OLG Stuttgart B. v. 22.9.2016, 2 Ws 140/16.
[50]
BVerfG NJW 2008, 977, wonach die öffentliche Kontrolle von Gerichtsverhandlungen durch die Anwesenheit der Medien und deren Berichterstattung grundsätzlich gefördert würde, so dass es auch im Interesse der Justiz läge, mit ihren Verfahren und Entscheidungen öffentlich wahrgenommen zu werden, und zwar auch im Hinblick auf die Durchführung mündlicher Verhandlungen. Krit. hierzu etwa Schäfer JR 2008, 119; Linder StV 2008, 210, Ernst JR 2007, 392 ff. denen diese Auffassung im Hinblick auf die Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten zu weit geht.
[51]
Zum Ganzen Meyer-Goßner/Schmitt § 169 GVG Rn. 1 m.w.N.
[52]
Dazu gehören jedenfalls BVerfGE 87, 334; 91, 125; 103, 44; BVerfG NJW 2008, 977; NJW 2012, 2178; NJW 2014, 3013.
[53]
BVerfGE 103, 44.
[54]
So auch Lehr in: MAH Strafverteidigung § 21 Rn. 55.
[55]
Burhoff Hauptverhandlung Rn. 2671.
[56]
Hierzu Lehr in: MAH Strafverteidigung § 21 Rn. 64 f.
[57]
Hierzu Lehr in: MAH Strafverteidigung § 21 Rn. 66 ff.
[58]
Hierzu Lehr in: MAH Strafverteidigung § 21 Rn. 56 f.
[59]
Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt § 176 GVG Rn. 15 m.w.N.
[60]
BVerfG NJW 2012, 2176
[61]
BVerfGE 119, 309, 328 f.
[62]
Vgl. BVerfGE 103, 44, 68. Nach BVerwG Urt. v. 1.10.2014, 6 C 35.13, NJW-Spezial 2015, 57 f. ist der Presse auf Anfrage hin der Name des Verteidigers mitzuteilen.
[63]
BVerfG NJW 2014, 3013.
[64]
So ist es nicht unüblich, dass die Bildberichterstatter vor Eröffnung der Hauptverhandlung und in Abwesenheit des Angeklagten Bilder aus dem Gerichtssaal fertigen können, auch von dem scheinbar zur Eröffnung der Hauptverhandlung „eintretenden Gericht“. Nach Beendigung der Aufnahmen entfernt sich das Gericht wieder, um dann erneut und dieses Mal in Anwesenheit des Angeklagten den Saal zu betreten.
[65]
Hierzu Krause in: MAH Strafverteidigung, § 7 Rn. 11.
[66]
vgl. BVerfG NJW 2009, 350; OLG Düsseldorf StV 2013, 200.
[67]
KG NStZ 2011, 120; OLG Hamm NStZ-RR 2012, 118; a.A. SK-Velten § 176 GVG Rn. 17 f.
[68]
Meyer-Goßner/Schmitt § 176 Rn. 16; a.A. Breyer/Endler/Schroth Kap. 1 Rn. 377, der weder die Beschwerde noch die Anrufung des Gerichts nach § 238 Abs. 2, sondern nur die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts für möglich hält.
[69]
OLG Stuttgart NJW 2011, 2899; LG Ravensburg NStZ-RR 2007, 348.
[70]
OLG Hamburg B. v. 5.4.2012, 3-14/12 (Rev) = openJur 2012, 663.
[71]
Vgl. Murmann S. 6; dies gilt für alle Medien, nicht nur für das berüchtigte Blatt mit den vier Buchstaben, das ohnehin mit dem Begriff „Tatwaffe“ treffender beschrieben wäre.
[72]
Bei Sommer 3. Kap. Rn. 560 heißt es treffend: „Chefredakteure fühlen sich nicht einem funktionierenden Rechtsstaat verpflichtet, sondern der Höhe ihrer Auflage.“
[73]
Lehr in: MAH Strafverteidigung, § 21 Rn. 3.
[74]
Vgl. Hamm Strafverteidigung im Rechtsstaat S.139, 141: „In der Normwelt des Journalisten gibt es keine Verwertungsverbote, keine Belehrungspflichten, kein Verbot, aus dem Schweigen eines Verdächtigen Schlüsse zu seinen Lasten zu ziehen und nicht einmal die Unschuldsvermutung.“
[75]
Sommer 3. Kap. Rn. 560.
[76]
Hamm Strafverteidigung im Rechtsstaat S. 142.
[77]
Höbermann S. 227.
[78]
Lesenswert hierzu Lehr in: MAH Strafverteidigung, § 21 Rn. 79 ff.
[79]
Zum Narzissmus und Werbebedürfnis der Verteidiger bei solchen Gelegenheiten vgl. Hamm Strafverteidigung im Rechtsstaat S. 144 f.; bei Heinrich Konfliktverteidigung im Strafprozess, liest sich das so: „Selbst bei überregional bedeutsamen Verhandlungen besteht meist nur am ersten (und letzten) Hauptverhandlungstag ein Medieninteresse. Diese Chance will aus Sicht der Verteidigung genutzt sein, um sich eindringlich ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen“ (Kap. 4 Rn. 1).
[80]
Lehr in: MAH Strafverteidigung, § 21 Rn. 76 ff.
Teil 2 Allgemeines › V. Verteidigungsziele – Strategie und Taktik in der Hauptverhandlung
V. Verteidigungsziele – Strategie und Taktik in der Hauptverhandlung
| Die wesentliche Aufgabe der Vertheidigung liegt in derwirkungsvollen Geltendmachung des Vertheidigungsstoffes(Vargha Die Vertheidigung in Strafsachen, 1879, § 329) |
Teil 2 Allgemeines › V. Verteidigungsziele – Strategie und Taktik in der Hauptverhandlung › 1. Verteidigungsziele
1. Verteidigungsziele
48
Allgemein formuliert bezeichnet das Verteidigungsziel das von der Verteidigung anzustrebende Ergebnis bei Abschluss des Strafprozesses. In der Sache geht es regelmäßig darum, die negativen Auswirkungen des Verfahrens, die in strafrechtlichen, aber auch in außerstrafrechtlichen Nachteilen bestehen können, so gering wie möglich zu halten.
49
Die Verteidigungsziele orientieren sich selbstverständlich am Interesse des Angeklagten und nicht des Verteidigers. Ob dieser die Ziele seines Mandanten mittragen kann, sollte möglichst frühzeitig geklärt werden. Ist dies nicht der Fall, so ist das Mandat zu beenden. Schon die Frage, was das Interesse des Mandanten sei, birgt Konfliktpotential, etwa dann, wenn der Verteidiger die Möglichkeit eines Freispruches sieht, weil sich der Tatvorwurf bei streitiger Verhandlung wahrscheinlich nicht beweisen lässt, der Mandant selbst aber unbedingt ein Geständnis ablegen will. Auf welchen Motiven[1] dieser Wunsch auch beruhen mag: Der Verteidiger hat ihn zu respektieren und sich darauf zu beschränken, seinem Mandanten die prozessuale Situation und die sich daraus ergebenden Möglichkeiten realistisch zu erläutern.
50
Verteidigungsziele haben sich realistischerweise am konkreten Verfahrensstand und den sich daraus ergebenden prozessualen Möglichkeiten zu orientieren. Eine der undankbarsten Aufgaben des Verteidigers liegt darin, die manchmal utopischen Vorstellungen des Mandanten von dem prozessual Machbaren auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Dem Angeklagten muss auch vermittelt werden, dass es in der Hauptverhandlung schädlich ist, die anzustrebenden Ziele so hoch zu stecken, dass deren Realisierung vom Gericht nicht ernsthaft in Betracht gezogen wird. Wer sich auf diese Weise einmal lächerlich gemacht hat, wird auch Schwierigkeiten haben, mit ernsthaften Anliegen durchzudringen.
51
Verteidiger und Angeklagter müssen sich auch darüber im Klaren sein, dass Verteidigungsziele keine unveränderlichen Größen sind. Dies gilt mehr denn je seit der gesetzlichen Regelung der strafprozessualen Verständigung. Die Ziele müssen den jeweiligen Möglichkeiten des Verfahrens angepasst werden. Viele unterschiedliche Faktoren können ihre Realisierung positiv oder negativ beeinflussen: Diese reichen von der Gerichtsbesetzung über die Person des Sitzungsvertreters der Staatsanwaltschaft (der z.B. einer Verfahrenseinstellung zustimmen muss oder gegenüber dem Sachbearbeiter ganz andere Vorstellungen vom Strafmaß hat) bis hin zum Gang der Beweisaufnahme (z.B. wenn der als gefährlichstes Beweismittel erwartete Belastungszeuge überraschend von einem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch macht). Entsprechend diesen sich ändernden Bedingungen sind dann die Verteidigungsziele neu zu definieren; dies kann in der Hauptverhandlung z.B. den Antrag des Verteidigers notwendig machen, das Verfahren für eine Besprechung mit dem Angeklagten zu unterbrechen.
52
Unter den Verteidigungszielen in der Hauptverhandlung sind zunächst die verfahrensbeendenden Alternativen ins Auge zu fassen. Ein Freispruch ist anzustreben, wenn der objektive Tatbestand nicht gegeben oder nicht nachzuweisen ist. Allerdings wird sich der Verteidiger fragen müssen, wie es unter diesen Umständen überhaupt zu einer Anklageerhebung und zur Eröffnung des Hauptverfahrens kommen konnte.[2] Wurden bereits im Vorverfahren Einwendungen erhoben, die die Staatsanwaltschaft und das Gericht nicht überzeugt haben, so darf der Verteidiger nicht darauf vertrauen, dass dies in der Hauptverhandlung ohne wesentliche Änderung der Umstände anders gesehen wird.
53
In Betracht zu ziehen sind insbesondere auch die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, zum einen die gesamte Verfahrenseinstellung etwa aufgrund eines Prozesshindernisses (z.B. Verjährung oder dauernde Verhandlungsunfähigkeit), zum anderen die Einstellung nach den Vorschriften der §§ 153 Abs. 2, 153a Abs. 2, 153b Abs. 2, 153c Abs. 3 sowie § 154 Abs. 2 (zu den Einstellungsmöglichkeiten und -anträgen vgl. im Einzelnen Rn. 184 ff.).
54
Die Festlegung des Verteidigungsziels kann auch, wenn eine Verurteilung nicht zu vermeiden ist, die Rechtsfolgen betreffen. Wichtige Gesichtspunkte sind hier: die Verhängung von Geldstrafe statt Freiheitsstrafe; bei nicht zu vermeidender Freiheitsstrafe deren Aussetzung zur Bewährung; die Vermeidung einschneidender Nebenfolgen: z.B. Führerscheinentzug, Berufsverbot u.Ä. Die Einzelheiten sind hier stets vom konkreten Fall abhängig.
Teil 2 Allgemeines › V. Verteidigungsziele – Strategie und Taktik in der Hauptverhandlung › 2. Verteidigungsstrategie
2. Verteidigungsstrategie
55
Die Verteidigungsziele bestimmen die Verteidigungsstrategie. Das aus dem Griechischen stammende Wort Strategie bedeutete ursprünglich die Kunst der Kriegsführung (während die Taktik die Kunst umschrieb, ein bestimmtes Gefecht zu führen). Gewisse Analogien zur Situation in der Hauptverhandlung sind nicht zu übersehen.
56
So wie es in der Kriegsführung nützlich ist, über Truppenstärke und Waffenzahl der beteiligten Heere informiert zu sein, das Gelände zu kennen, in dem der Kampf stattfinden wird, und den Charakter der gegnerischen Generale richtig einzuschätzen, so muss auch der Verteidiger bei der Entwicklung seiner Verteidigungsstrategie, d. h. des Gesamtplanes zur Verwirklichung der Verteidigungsziele, die unterschiedlichsten Faktoren berücksichtigen und in seine Erwägungen einbeziehen.
57
Dies ist zunächst und in erster Linie das in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht zu würdigende Ergebnis der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen, wie es Eingang in die Anklageschrift gefunden hat. Ohne profunde Aktenkenntnis kann auch der erfahrenste Strafverteidiger keinen Verteidigungsplan entwickeln. Zu prüfen ist hierbei vor allem die Qualität der Beweismittel, sowohl der belastenden wie der entlastenden. Der Verteidiger darf bei der Bewertung dieser Beweismittel allerdings nicht vergessen, dass das Gericht bei der Eröffnung des Hauptverfahrens diese Prüfung ebenfalls vorzunehmen hatte (und oft auch vorgenommen hat) und die belastenden Beweismittel für hinreichend gewichtig gehalten hat, die Eröffnung des Hauptverfahrens zu beschließen. Zu prüfen ist daher weiter, ob und mit welchen Aussichten der Beschuldigte weiteres Entlastungsmaterial ins Feld führen kann. Entlastend können z.B. weitere Beweismittel sein, aber auch eine besonders geschickte – wahre oder nicht zu widerlegende – Einlassung des Mandanten.
Hinweis
Ein weiterer nicht unwesentlicher Faktor ist die Frage, vor welchem Gericht und mit welchen Richtern verhandelt wird.[3] Gegen Urteile des Landgerichts und des Oberlandesgerichts steht nur noch das Rechtsmittel der Revision zur Verfügung, weshalb prozessrechtliche Fragen hier größere Aufmerksamkeit beanspruchen als beim Schöffengericht oder beim Strafrichter. Kennt der Verteidiger die zuständigen Richter oder kann er ausreichend zuverlässige Informationen über sie einholen, so sind auch deren Eigenarten, insbesondere ihre Verhandlungsführung und Spruchpraxis, in die Überlegungen zur Verteidigungsstrategie einzubeziehen.
Teil 2 Allgemeines › V. Verteidigungsziele – Strategie und Taktik in der Hauptverhandlung › 3. Verteidigungstaktik