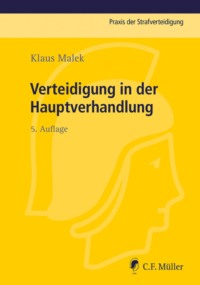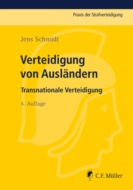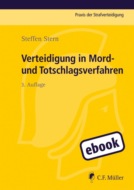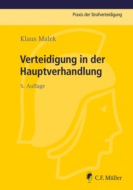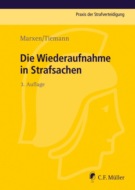Kitabı oku: «Verteidigung in der Hauptverhandlung», sayfa 8
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › II. Verspätung des Verteidigers
II. Verspätung des Verteidigers
70
Die Verspätung des Verteidigers sollte sich selbstverständlich auf unverschuldete Fälle beschränken. Nicht nur das Gericht, sondern auch der Mandant wird Unpünktlichkeit in der Regel nicht schätzen. Unverschuldete Verspätung kann z.B. vorliegen bei einer unerwarteten Verzögerung eines vorangegangenen Termins oder bei einem nicht vorhersehbaren Verkehrsstau.[1] In jedem Fall sollte der Verteidiger versuchen, das Gericht durch einen Telefonanruf über die Verspätung zu benachrichtigen. Dies gilt auch dann, wenn das Gericht im Fall einer notwendigen Verteidigung mit der Verhandlung nicht ohne Verteidiger beginnen kann. Berechtigte Verärgerungen des Gerichts muss der Verteidiger schon im Interesse des Mandanten tunlichst vermeiden. Liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung nicht vor, so ist das Gericht verpflichtet, bei Verhinderung des Verteidigers so lange auf dessen Erscheinen zu warten, wie dies mit dem Interesse an der Einhaltung der Tagesordnung vereinbar ist,[2] wobei die Dauer der Wartepflicht sich nach den Umständen des Einzelfalles richtet. Normalerweise dürfte ein Zuwarten von 15–20 Minuten ausreichend sein. Weiß das Gericht jedoch, dass der Verteidiger kurzfristig zum Termin erscheinen wird, so hat es mit dem Beginn der Hauptverhandlung erforderlichenfalls auch länger zuzuwarten.[3] Dies gilt gerade dann, wenn der Vorsitzende ausrichten lässt, der noch nicht erschienene Verteidiger solle auf jeden Fall noch zum Termin kommen.[4] Ein Verstoß gegen die Wartepflicht verletzt das Rechtsstaatsgebot und führt auf entsprechende Verfahrensrüge zur Aufhebung des Urteils.[5]
71
Es ist kein objektiver Grund ersichtlich, warum die vorgenannten Grundsätze zur Verspätung des Verteidigers nicht ebenfalls gelten sollen, wenn das Gericht zur festgesetzten Terminstunde nicht erscheint. Dem Verteidiger sollte jedenfalls keine längere Wartezeit als dem Gericht zugemutet werden, wenn ihm weder der Grund für das Ausbleiben des Gerichts bekannt ist, noch für ihn unschwer erkennbar oder feststellbar ist, ob die angesetzte Verhandlung überhaupt stattfinden wird.[6] Kann die Verhandlung wegen Verhinderung des Gerichts erst verspätet beginnen, so ist es zur Terminverlegung verpflichtet, falls nunmehr der Verteidiger aufgrund der Verzögerung verhindert ist.[7]
Anmerkungen
[1]
Vgl. hierzu allerdings BVerfG StV 1994, 113, wonach der Verteidiger bei allgemein bekannter Staugefahr einen „Sicherheitszuschlag“ einkalkulieren muss, um ein Verschulden auszuschließen.
[2]
Dahs Handbuch Rn. 501.
[3]
OLG Düsseldorf StV 1995, 454; Dahs Handbuch, Rn. 501 spricht von bis zu 30 Minuten.
[4]
Burhoff Hauptverhandlung, Rn. 985; für den Angeklagten: OLG Köln StraFo 2004, 143.
[5]
OLG Düsseldorf StV 1995, 454.
[6]
OLG Düsseldorf AnwBl. 1983, 233.
[7]
BayObLG StV 1984,13; Meyer-Goßner/Schmitt § 228 Rn. 12.
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › III. Einlasskontrollen
III. Einlasskontrollen
72
Beim Betreten des Gerichtsgebäudes oder des Sitzungssaales kann der Verteidiger mit dem Problem konfrontiert werden, dass die Zuschauer, sein Mandant oder gar er selbst einer Durchsuchung unterzogen werden. Eine derartige sitzungspolizeiliche Anordnung findet ihre Grundlage in § 176 GVG. Sie ist nicht generell unzulässig.[1] Soweit die Maßnahme auf den Verteidiger erstreckt wird, soll sich der Schutz der Berufsausübung auf die Abwehr übermäßiger und unzumutbarer Belastungen beschränken.[2] Allerdings genießt der Verteidiger als Organ der Rechtspflege einen „staatlichen Vertrauensvorschuss“, der grundsätzlich die Darlegung eines die Anordnung rechtfertigenden sachlichen Grundes erforderlich macht.[3] Ein solcher kann z.B. gegeben sein, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Verteidiger zur Hilfe bei der Befreiung seines Mandanten, etwa durch das Einschmuggeln von Gegenständen, genötigt werden soll.[4] Unter diesen Umständen soll sich die Durchsuchung nicht auf den Einsatz eines so genannten Detektionsrahmens beschränken müssen, vielmehr dürfen auch die Kleider durchsucht werden. Allerdings gilt der Grundsatz, dass gegen den Verteidiger nur unumgänglich erscheinende Maßnahmen angeordnet werden dürfen.[5] Die Kontrolle des Verteidigers auf dem Weg zur Hauptverhandlung muss daher eine absolute Ausnahme darstellen.
Anmerkungen
[1]
BGH NJW 1995, 3196.
[2]
Vgl. BVerfGE 7, 377, 405; 30, 1, 32 f.
[3]
BGH NJW 2006, 1500, 1501.
[4]
BGH NJW 2006, 1500, 1501.
[5]
BVerfG NJW 1998, 296, 298.
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › IV. Sitzordnung
IV. Sitzordnung
73
Der Verteidiger sollte den Sitzungssaal, soweit möglich, grundsätzlich gemeinsam mit seinem Mandanten betreten, schon um gegenüber den übrigen Verfahrensbeteiligten Geschlossenheit in der Sache zu zeigen. Der Verteidiger hat einen Anspruch auf einen Platz im Sitzungssaal, der einerseits seiner Stellung gerecht wird und darüber hinaus keine tatsächliche Einschränkung der Verteidigungsmöglichkeiten mit sich bringt. In praktischer Hinsicht bedeutet dies, dass ausreichend Platz vorhanden sein muss, die Verteidigungsunterlagen (Akten, Kommentare, Schreibutensilien u.Ä.) vor sich auszubreiten, einzusehen und zu benutzen. Eine Platzzuweisung, die diese Kriterien nicht erfüllt, kann eine unzulässige Beschränkung der Verteidigung i.S.d. § 338 Nr. 8 darstellen und die Revision begründen.[1]
74
Auch der Angeklagte hat einen Anspruch auf einen Platz im Sitzungssaal, der seiner Würde und seinem Anspruch auf Gleichbehandlung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten entspricht.[2] Ein solcher Platz befindet sich nicht in der Mitte des Saales vor der Richterbank, sondern neben dem Verteidiger, von wo aus der ungehinderte Kontakt zu diesem möglich ist. Der Angeklagte hat auch das Recht, Verteidigungsunterlagen zu benutzen und – unabhängig vom Umfang des Prozessstoffs – Aufzeichnungen anzufertigen,[3] was ihm verwehrt wird, wenn ihm lediglich ein Stuhl ohne Tisch zur Verfügung steht. Ein Verstoß gegen diese Grundsätze kann ebenfalls die Revision wegen eines Verstoßes gegen § 338 Nr. 8 begründen.[4]
75
Entspricht die Situation im Gerichtssaal nicht den genannten Grundsätzen, so sollte der Verteidiger zunächst versuchen, mit dem Gericht eine einvernehmliche Änderung der Situation herbeizuführen.[5] Ist eine Einigung nicht möglich, so empfiehlt sich ein schriftlich formulierter Antrag auf Zuweisung eines angemessenen Sitzplatzes. Weist der Vorsitzende diesen Antrag zurück, so ist eine Gerichtsentscheidung gemäß § 238 Abs. 2 herbeizuführen. Zur Sachleitung im Sinne dieser Vorschrift gehören nach richtiger Auffassung auch sitzungspolizeiliche Maßnahmen.[6] Bestätigt das Gericht die Anordnung des Vorsitzenden, so bleibt dem Verteidiger nichts anderes übrig, als die Sitzordnung jeweils durch entsprechende Protokollierungsanträge aktenkundig zu machen und im Bedarfsfall (etwa nach einer Zeugenaussage) einen Unterbrechungsantrag für ein ungehindertes Gespräch mit dem Mandanten zu stellen.[7] Der Antrag ist bei mehrtägigen Sitzungen zu Beginn eines jeden Sitzungstages zu wiederholen.[8]
76
Muster 1 Antrag auf Zuweisung eines angemessenen Sitzplatzes für den Angeklagten
An das
Landgericht
…
In der Strafsache gegen…
beantrage ich, dem Angeklagten einen Platz neben mir zuzuweisen und dafür Sorge zu tragen, dass es ihm möglich ist, die von ihm mitgebrachten Verteidigungsunterlagen, u.a. Kopien aus den Ermittlungsakten, vor sich auszubreiten und zu benutzen.
Begründung:
Dem Angeklagten wurde für die heutige Hauptverhandlung ein Platz auf der Bank hinter dem Verteidiger zugewiesen. Es besteht weder Sichtkontakt zwischen mir und meinem Mandanten, noch hat dieser die Möglichkeit, seine Verteidigungsunterlagen vor sich auszubreiten oder Notizen über den Gang der Hauptverhandlung zu machen. Diese Anordnung, die angeblich der Üblichkeit am hiesigen Landgericht entsprechen soll, verletzt den Anspruch des Angeklagten auf Gleichbehandlung mit den übrigen Verfahrensbeteiligten und stellt eine Behinderung der Verteidigung i.S.v. § 338 Nr. 8 StPO dar (vgl. OLG Köln NJW 1980, 302 und BayObLG StraFo 1996, 47). Es ist ohne weiteres möglich, einen zweiten Tisch und einen Stuhl an der Seite des Verteidigers aufzustellen, um dem gerügten Mangel abzuhelfen.
Anmerkungen
[1]
OLG Köln NJW 1961, 1127.
[2]
OLG Köln NJW 1980, 302; BayObLG StraFo 1996, 47.
[3]
BayObLG StraFo 1996, 47.
[4]
OLG Köln NJW 1980, 302, 303.
[5]
Vgl. hierzu Münchhalffen StraFo 1996, 18; Stern StraFo 1996, 47.
[6]
Pfeiffer § 238 Rn. 2.
[7]
So die empfehlenswerten Vorschläge bei Münchhalffen StraFo 1996, 18 ff.
[8]
Burhoff Hauptverhandlung, Rn. 2525.
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › V. Fesselung des in Haft befindlichen Angeklagten
V. Fesselung des in Haft befindlichen Angeklagten
77
| Es macht einen überaus peinlichen Eindruck,wenn man…einen Angeklagten,dessen Schuld bis zur Beendigung derHauptverhandlung immer noch zweifelhaft sein muss,schon beim Beginne derselben… wie eingefährliches wildes Thier bewacht und behandelt sieht(Vargha Die Vertheidigung in Strafsachen, 1879, § 226) |
Gemäß § 119 Abs. 5 S. 2 a.F. ist der Angeklagte in der Hauptverhandlung in der Regel ungefesselt. Dieser Grundsatz entspricht immer noch der Würde der Angeklagten,[1] gerade auch unter dem Gesichtspunkt der Unschuldsvermutung. Durch das am 1.1.2010 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des Untersuchungshaftrechts vom 29.7.2009[2] ist diese Regelung entfallen. Beschränkungen zur Abwehr einer Flucht-, Verdunkelungs- oder Wiederholungsgefahr richten sich jetzt nach § 119 Abs. 1. Dieser enthält keine generelle Regelung der Fesselung; sie fällt auch nicht unter die Regelbeispiele des S. 2. Die Maßnahme ist daher unter Beachtung der Tatsache, dass es sich bei der Fesselung um einen gewichtigen Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht handelt[3] auf ihre konkrete Erforderlichkeit zu prüfen und im Einzelnen zu begründen.[4] Dabei erscheinen die in § 119 Abs. 5 S. 1 a.F. genannten Kriterien für die Anordnung der Fesselung brauchbar, wonach diese bei Gefahr der Gewaltanwendung oder des Widerstandes (Nr. 1), bei Fluchtgefahr oder Gefahr der Befreiung aus dem Gewahrsam (Nr. 2) sowie bei Suizidgefahr oder Gefahr der Selbstschädigung (Nr. 3) als zulässig erachtet wurde. Allerdings ist die „Fluchtgefahr“, die für eine Fesselung erforderlich ist, nicht gleichzusetzen mit der Fluchtgefahr i.S.d. § 112 Abs. 2 Nr. 2. Anderenfalls würde jeder wegen Fluchtgefahr erlassene Haftbefehl die Fesselung rechtfertigen.
78
Der Fesselungsgrund muss auf konkreten Tatsachen beruhen[5] und zur Beseitigung oder Verringerung der in § 119 Abs. 5 S. 1 a.F. genannten Gefahren notwendig sein.[6] Die Anordnung für lediglich denkbare künftige Ereignisse reicht nicht aus. Aus der Anordnungskompetenz des Richters ergibt sich, dass dieser die Maßnahme in eigener Verantwortung und nach eigener Prüfung der Sachlage trifft. Es genügt nicht, dass er sich auf die Anordnungen der Haftanstalt beruft, die für den Transport des Angeklagten aus der Haft in die Hauptverhandlung verantwortlich ist. Die Kriterien, die für den Transport gelten, können nicht unbedingt für die Hauptverhandlung Geltung beanspruchen. Hier ist insbesondere zu berücksichtigen, dass der aus der Haft in die Hauptverhandlung verbrachte Angeklagte dort regelmäßig besonders bewacht wird. Zwei vor dem einzigen Ausgang des Verhandlungssaales postierte Polizeibeamte dürften die Fluchtgefahr im Normalfall auf ein Minimum reduzieren. Etwas anderes mag bei einem Verfahren im Bereich der organisierten Kriminalität gelten, wobei in diesem Fall aber auch die sonstigen Sicherungsmaßnahmen der möglichen Gefahr angepasst sein dürften, so dass es auch hier letztlich nicht auf die (Hand-)Fesselung des Angeklagten ankommen wird.
79
Auch die Art der Fesselung hat sich an der Notwendigkeit der Maßnahme zu orientieren.[7] Danach ist nur die Fesselung an den Händen oder an den Füßen zulässig. Einer etwa noch bestehenden Fluchtgefahr dürfte in der Regel die Fußfesselung ausreichend entgegen wirken. Sie lässt dem Angeklagten zumindest auch die Möglichkeit, schriftliche Unterlagen zu benutzen und sich Notizen über den Prozess zu machen. Der Vorsitzende, der dies untersagt, riskiert bei entsprechendem Widerspruch des Verteidigers den Revisionsgrund des § 338 Nr. 8.
Hinweis
Hält der Verteidiger die Voraussetzungen einer Fesselung nicht für gegeben und macht das Gericht zu Beginn der Hauptverhandlung keine Anstalten, die Abnahme der Fesseln anzuordnen, so ist es angebracht, den Vorsitzenden zunächst hieran zu erinnern. Weigert sich dieser, so ist hiergegen gemäß § 238 Abs. 2 ein Gerichtsbeschluss herbeizuführen, da die Anordnung der Fesselung während der Hauptverhandlung eine Maßnahme der Verhandlungsleitung darstellt. Da die Fesselung nicht nur eine Entwürdigung des Angeklagten darstellt, sondern diesen auch in seinen Verteidigungsmöglichkeiten beschränken kann, sollte der Verteidiger diese Gesichtspunkte in die Begründung seines Widerspruchs aufnehmen und, je nach der Begründung der Gerichtsentscheidung, auch die Ablehnung wegen Befangenheit in Erwägung ziehen.
Anmerkungen
[1]
Burhoff Hauptverhandlung, Rn. 1520.
[2]
BGBl. I, 2274.
[3]
BVerfG B. v. 3.8.2011, HRRS 2011, Nr. 983.
[4]
BT-Drucks. 16/11644, S. 24.
[5]
Meyer-Goßner/Schmitt § 119 Rn. 23; OLG Dresden NStZ 2007, 479.
[6]
Vgl. Hoffmann/Wissmann StV 2001, 706.
[7]
OLG Koblenz StV 1989, 467.
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › VI. Probleme mit der Amtstracht des Verteidigers
VI. Probleme mit der Amtstracht des Verteidigers
80
| Suaviter in modo, fortiter in re!Es gilt zähe Ausdauer mit gefälliger Form zu verbinden.(Jaques Ueber die Aufgabe der Vertheidigung in Strafsachen, 1873, S. 17) |
Gemäß § 20 BORA hat der Verteidiger vor Gericht die Amtstracht zu tragen. Weigert er sich, riskiert er nach herrschender Meinung in Anwendung des § 176 GVG für die betreffende Sitzung als Verteidiger zurückgewiesen zu werden.[1] Zur Amtstracht gehört zwar die schwarze Robe,[2] nicht jedoch der berühmte „weiße Quer- oder Längsbinder“,[3] da dieser in der Berufsordnung keine Erwähnung findet. Die Ableitung der Krawattenpflicht des Verteidigers aus einem angeblichen bundeseinheitlichen Gewohnheitsrecht[4] dürfte, nachdem der Gesetzgeber die Regelung der Berufstracht in § 59b BRAO der Satzungsversammlung der Rechtsanwälte überantwortet hat, nicht mehr vertretbar sein.[5] Allerdings hat das Bundesverfassungsgericht die Verfassungsbeschwerde eines Verteidigers gegen die auf das Nichttragen einer Krawatte gestützte gerichtliche Zurückweisung in der Hauptverhandlung mit der Begründung zurückgewiesen, der behaupteten Grundrechtsverletzung (Verstoß gegen Art. 12 Abs. 1 GG) komme kein besonderes Gewicht zu. Um zukünftig Ähnliches zu vermeiden, möge er einfach eine Krawatte anlegen.[6] Dass farbige Krawatten und Hemden in der Hauptverhandlung zum Stein des Anstoßes werden, ist heute selten.[7] In „dezenter Ausführung“ gewählt, werden diese selbst vom OLG München mittlerweile als angemessen angesehen.[8] Mit der Stellung eines Verteidigers „vor bayrischen Strafgerichten“ soll es jedoch nicht vereinbar sein, wenn der Rechtsanwalt mit weißem T-Shirt unter offener Robe auftritt; dieser könne daher nach § 176 GVG zurückgewiesen werden.[9] Dem tritt Weihrauch zu Recht und mit durchgreifenden Argumenten entgegen, gibt allerdings gleichzeitig zu bedenken, ob ein Verteidiger ohne Hemd, der zu Lasten seines Mandanten sein Ausscheiden aus dem Verfahren in Kauf nimmt, sich auch angemessen und klug verhält.[10] Ob man so streng sein muss, dem Verteidiger die von manchem Richter und Staatsanwalt gepflegte „Unsitte“ des Tragens von Jeans (die es durchaus in hochwertiger Qualität gibt) zu verbieten und nur den Anzug (oder Sakko) für den Herrn und das Kostüm für die Dame zuzulassen,[11] ist jedenfalls nicht zwingend. Am Ende dürfte es aber doch eher im Interesse des Mandanten liegen, sich lieber in Modefragen konziliant zu zeigen und in der Sache hart zu verhandeln, als umgekehrt. Wer in Formfragen nachgibt, „wenn's der Wahrheitsfindung dient“, geht allemal zumindest als moralischer Sieger vom Feld.
Anmerkungen
[1]
Vgl. Meyer-Goßner/Schmitt § 176 GVG Rn. 11 m.w.N.
[2]
So auch schon BVerfGE 28, 21.
[3]
A.A. jedoch OLG München StV 2007, 27 und Dahs Handbuch, Rn. 502, der den Kolleginnen alternativ ein weißes Halstuch gestatten will; zweifelnd Burhoff Hauptverhandlung, Rn. 865, der darauf hinweist, dass die Berufsordnung diese nicht vorschreibt.
[4]
So OLG München StV 2007, 27.
[5]
So zu Recht Weihrauch StV 2007, 28; bereits OLG Zweibrücken NStZ 1988, 144 hatte die Zurückweisung des ohne Krawatte auftretenden Verteidigers als unzulässig angesehen; vgl. auch Beulke FS Hamm, S. 21 ff.; Burhoff Hauptverhandlung, Rn. 2683.
[6]
BVerfG NJW 2012, 2570; zustimmend Barton Einführung in die Strafverteidigung § 5 Rn. 36.
[7]
Dahs Handbuch, Rn. 502 hält ein kariertes Hemd vor dem BGH jedenfalls für unter dem einzuhaltenden Niveau.
[8]
OLG München StV 2007, 27.
[9]
OLG München StV 2007, 27.
[10]
Weihrauch StV 2007, 28, 29; ebenso Beulke FS Hamm, S. 21 ff.
[11]
So jedenfalls Klemke/Elbs Rn. 796.
Teil 3 Beginn der Hauptverhandlung › VII. Einwendungen gegen das Verfahren insgesamt
VII. Einwendungen gegen das Verfahren insgesamt
81
Prozesshindernisse sollte der Verteidiger so früh wie möglich geltend machen. Dies vermeidet nicht nur unnötigen Zeit- und Geldaufwand, sondern erspart dem Mandanten überflüssige Belastungen, die mit einem Strafverfahren stets verbunden sind. Hatte der Verteidiger bis zum Beginn der Hauptverhandlung z.B. wegen später Mandatierung keine Gelegenheit, die Einwendungen vorzutragen, oder sind Prozesshindernisse erst kurz vor der Hauptverhandlung eingetreten, so sollte er diese auch in der Hauptverhandlung so bald wie möglich geltend machen, ggf. bereits nach Aufruf der Sache und der Feststellung der Förmlichkeiten nach § 243 Abs. 1.
82
Bei einer Prozessvoraussetzung (das Prozesshindernis ist lediglich das negative Gegenstück hierzu) handelt es sich um einen Umstand, der nach dem ausdrücklich erklärten oder aus dem Zusammenhang ersichtlichen Willen des Gesetzes so schwer wiegt, dass von seinem Vorhandensein oder Nichtvorhandensein die Zulässigkeit des Verfahrens im Ganzen abhängig gemacht werden muss.[1] Prozesshindernisse sind von Amts wegen und in jeder Lage des Verfahrens zu prüfen,[2] so dass ein entsprechender Einwand der Verteidigung zu keinem Zeitpunkt verspätet sein kann.
83
Die wichtigsten Verfahrenshindernisse sind: Die absolute Schuldunfähigkeit des Angeklagten nach § 19 StGB, das Fehlen der deutschen Gerichtsbarkeit (§§ 18–20 GVG, Art. VII Nato-Truppenstatut), anderweitige innerstaatliche Rechtshängigkeit oder rechtskräftige Erledigung der Sache (Art. 103 Abs. 3 GG),[3] die Einstellung nach § 153 Abs. 2 oder die endgültige Einstellung nach § 153a Abs. 1, 2, die Strafverfolgungsverjährung (§ 78 StGB), Beschränkungen in den Auslieferungsbedingungen nach dem Grundsatz der Spezialität,[4] das Fehlen eines wirksamen Strafantrags, das Fehlen eines wirksamen, schriftlich abgesetzten[5] Eröffnungsbeschlusses (§§ 203, 207, 383 Abs. 1), dauernde Verhandlungsunfähigkeit des Angeklagten u.a.
84
Liegt ein Prozesshindernis vor, so ist das Verfahren in der Hauptverhandlung nach § 260 Abs. 3 durch Urteil einzustellen. Es handelt sich um ein Prozessurteil, das nicht in Rechtskraft erwächst und daher grundsätzlich auch nicht die Strafklage verbraucht. Ist daher das Verfahrenshindernis behebbar, kann der Sachverhalt neu angeklagt werden.[6] Ist das Prozesshindernis dagegen endgültig, z.B. bei Ablauf der Strafantragsfrist, kommt das Urteil einem strafklageverbrauchenden Sachurteil gleich.[7] Keine Verfahrenseinstellung, sondern Freispruch hat zu erfolgen, wenn der Sachverhalt bei Bekanntwerden des Prozesshindernisses bereits so weit geklärt ist, dass sich der Angeklagte keiner Straftat schuldig gemacht hat,[8] oder wenn bei Zusammentreffen eines schwereren und eines leichteren Tatvorwurfs der schwerere nicht nachzuweisen und der leichtere wegen eines nicht nur vorübergehenden Verfahrenshindernisses nicht mehr verfolgbar ist.[9] Kann der Verteidiger daher absehen, dass der Sachverhalt in der Hauptverhandlung so weit geklärt werden wird, dass ein Freispruch erfolgen muss, so sollte er sich mit dem Einwand eines Verfahrenshindernisses zurückhalten.
85
Muster 2 Einstellungsantrag wegen fehlender Prozessvoraussetzung
An das
Amtsgericht
…
In der Strafsache
gegen…
wegen Verdachts der Beleidigung
beantrage ich, das Verfahren durch Urteil gemäß § 260 Abs. 3 StPO einzustellen.
Mein Mandant wird beschuldigt, am 3.1.2017 seine Vermieterin, die zur heutigen Hauptverhandlung als Zeugin geladene Gerda Müller, als „ausgemolkene Ziege“ bezeichnet zu haben. Die Zeugin Müller hat zwar am 4.1.2017 Strafantrag gegen meinen Mandanten gestellt. Sie hat jedoch, wie der Verfahrensakte zu entnehmen ist, nachdem sie die Ladung zur Zeugenvernehmung vor dem Amtsgericht erhalten hat, die schriftliche Erklärung zur Akte gegeben, dass sie sich mit dem Angeklagten versöhnt habe und daher keinen Wert mehr auf eine Bestrafung lege. Hierin liegt die Rücknahme des Strafantrags gemäß § 77d Abs. 1 StGB. Da ein zurückgenommener Antrag nicht nochmals gestellt werden kann, liegt mangels wirksamen Strafantrags ein Verfahrenshindernis vor, das zur Einstellung der Sache führen muss.