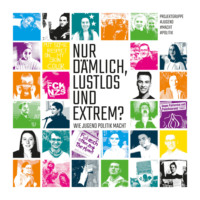Kitabı oku: «Nur dämlich, lustlos und extrem?», sayfa 2
JUGEND UND POLITIK – EMPIRISCHES WISSEN AUS QUANTITATIVEN UNTERSUCHUNGEN
Die sozialwissenschaftliche Jugendforschung in Deutschland führt seit Jahrzehnten immer wieder Untersuchungen durch, die das politische Interesse, die von ihnen als dringlich zu lösenden Probleme, die politischen Einstellungen und verschiedene Aspekte des politischen Agierens junger Leute zum Thema haben. Jüngere empirische Studien zeichnen zum gegenwärtigen Stand das folgende Bild:
POLITISCHES INTERESSE
Nach der aktuellen Shell-Studie geben 2019 45 % der 15- bis 24-Jährigen an, »politisch interessiert« zu sein. Der Prozentwert liegt damit ziemlich genau im Mittel der letzten neun Repräsentativbefragungen, die finanziert von Shell seit 1984 durchgeführt wurden und deren Werte in einer Marge zwischen 57 % (1991) und 34 % (2002) liegen (Shell 2019, 49). Während der Vorsprung der männlichen 12- bis 25-Jährigen gegenüber den gleichaltrigen weiblichen über die Jahre hinweg deutlich schmilzt und nur noch 7 Prozentpunkte beträgt (44 % Zustimmung zu 38 %), zeigen sich entsprechend dem oben ausgegebenen Motto »Die Jugend gibt es nicht« erhebliche Unterschiede je nach Bildungsniveau: Während 2/3 der Studierenden sich politisch interessiert zeigen, gilt dies nur für rund ein Viertel der 12- bis 25-Jährigen mit Hauptschulabschluss (ebd., 52 f.).
POLITISCHE THEMEN
Angstbesetzte politische Probleme sieht diese Altersgruppierung mehrheitlich in Umweltverschmutzung (71 %), Terroranschlägen (66 %), Klimawandel (65 %), einer wachsenden Feindlichkeit zwischen Menschen mit unterschiedlichen Meinungen (56 %), der wirtschaftlichen Lage und steigender Armut sowie Ausländerfeindlichkeit (beide 52 %), wogegen Probleme mit der Zuwanderung nur für 33 % mit Ängsten verbunden sind (ebd., 56). Während bei den genannten Themen Ost-West-Unterschiede kaum eine Rolle spielen, ist die Sorge um Arbeits- und Ausbildungsplätze umso größer, je geringer das formale Bildungsniveau ist, steigt mit Letzterem aber die Furcht vor dem Klimawandel. Eher noch deutlichere soziale Differenzierungen zeigen sich im Hinblick auf die Betrachtung von Zuwanderung und Ausländerfeindlichkeit: Liegt die Angst vor Zuwanderung bei Personen mit Hauptschulabschluss (56 %) bzw. Mittlerer Reife (40 %) deutlich vor denen mit Hochschulreife (25 %), so steigt umgekehrt die Sorge vor Ausländerfeindlichkeit mit dem formalen Bildungslevel an (von 41 % bei Hauptschulabsolvent*innen über 47 % bei jungen Leuten mit mittlerem Bildungsabschluss auf 56 % bei (Fach-)Abiturient*innen; ebd., 60). Soziale Unterschiede im Sinne von Schichtfaktoren bestimmen auch die Beurteilung der Existenz sozialer Gerechtigkeit in Deutschland. Die Einschätzung, dass es hierzulande eher oder gar nicht gerecht zugeht, wird in der Unterschicht mit einem Prozentsatz von 50 % der Befragten doppelt so häufig vertreten wie in der Oberschicht. Jugendliche mit sogenanntem Migrationshintergrund halten die Realisierung sozialer Gerechtigkeit in Deutschland – angesichts häufiger eigener Diskriminierungserfahrungen überraschenderweise – für stärker gegeben als Jugendliche ohne Migrationshintergrund, wobei insbesondere junge Leute mit familiären Wurzeln in osteuropäischen Staaten und – für manche vermutlich unerwartet noch stärker – solche aus islamisch geprägten Ländern diesen Eindruck wiedergeben (ebd., 67 ff.).
POLITISCHE EINSTELLUNGEN UND DEMOKRATIEZUFRIEDENHEIT
Soziale Heterogenität prägt auch eine Reihe von politischen Einstellungen der jungen Generation. So sind unter den 15- bis 25-Jährigen insgesamt 9 % »Nationalpopulist*innen« und 24 % »Populismus-Geneigte«, bei Besitzer*innen des Hauptschulabschlusses allerdings 24 % »Nationalpopulist*innen« und 34 % »Populismus-Geneigte«, hingegen bei Personen dieser Altersgruppe mit (Fach-)Hochschulreife 4 % bzw. 18 % (ebd., 79; zu den Items, mit denen entsprechende Orientierungen – u. a. Zuwanderungs- und Islamskepsis sowie Elitenkritik und Unterdrückung unbotmäßiger Meinungen – erhoben werden, ebd. 76 ff.). Etwas häufiger finden sich solche Haltungen im Osten als im Westen und bei männlichen als bei weiblichen Befragten. Letztere hingegen sind überproportional unter den »Weltoffenen« (insgesamt 27 %) und »Kosmopolit*innen« (12 %) vertreten. Diese beiden Gruppierungen unterscheiden sich von den beiden zuerst genannten vor allem dadurch, dass sie nicht nur eine viel geringere Distanz gegenüber gesellschaftlicher Vielfalt aufweisen und ein deutlich kleineres Ausmaß an Benachteiligungsempfinden haben, sondern auch viel eher davon ausgehen, dass sie Kontrolle über das eigene Leben haben und es weitgehend selbst bestimmen können (vgl. ebd., 84 ff.). Sie sind auch deutlich demokratiezufriedener (zu 88 %), wogegen rund 2/3 der Nationalpopulist*innen mit den Realitäten der Demokratie in Deutschland unzufrieden sind und fast ein Viertel (23 %) von ihnen auch grundsätzlich Demokratie nicht für eine gute Staatsform hält.
Unabhängig davon: Wer eher unzufrieden mit der Demokratie ist, Dinge nicht für änderbar hält und politisch (eher) nicht interessiert ist, zeigt sich politik(er)verdrossen und glaubt nicht, »dass sich Politiker darum kümmern, was Leute wie ich denken« (ebd., 96) – ein Eindruck, den insgesamt immerhin 71 % der 15- bis 25-Jährigen haben (ebd., 94).
POLITISCH-SOZIALES ENGAGEMENT
Hinsichtlich der Bedeutungseinschätzung politischen Engagements haben die weiblichen Befragten im Laufe der Jahre aufgeholt: Mit der Einschätzung, solches Engagement sei »wichtig«, liegen sie mit ihren Altersgenossen gleichauf (jeweils 34 %; ebd., 116). In der Höhe der prozentualen Zustimmungen zu den Werten »sich unter allen Umständen umweltbewusst verhalten« und »sozial Benachteiligten helfen« liegen sie sogar deutlich vor den gleichaltrigen männlichen Befragten (»umweltbewusst verhalten«: 77 % (w.) : 66 % (m.); »Benachteiligten helfen«: 67 % (w.) : 56 % (m.); ebd.).
Unterschiede zeigen sich bei diesen Haltungen aber auch schichtspezifisch: Umweltbewusstes Verhalten und Hilfe bei sozialer Benachteiligung zu leisten finden eher Jugendliche aus den oberen Schichten wichtig. Noch deutlicher fallen in dieser Hinsicht die Differenzen bei der Bedeutungszuweisung eigenen politischen Engagements aus: »Sich politisch engagieren« – dies ist für fast die Hälfte der Jugendlichen aus der oberen Schicht, aber nur rund ein Viertel der jungen Leute aus den unteren Schichten wichtig (vgl. ebd., 122 f.).
Selbst politisch oder sozial engagiert sind bei den 12- bis 25-Jährigen insgesamt 36 % oft, 33 % gelegentlich und 31 % nie. Auch hier zeigt sich, dass die Höhe der Herkunftsschicht und die Höhe des Bildungsniveaus (letztgenanntes allerdings nur leicht) positiv auf die Engagementintensität Einfluss nehmen.
Das Engagement selbst wiederum erstreckt sich inhaltlich vorrangig auf die Durchsetzung der Interessen von Jugendlichen, auf Einsatz für sinnvolle Freizeitgestaltung und auf Umwelt- und Tierschutz (vgl. ebd., 98 ff.). Das meiste davon erfolgt in alltäglichen Zusammenhängen durch persönliche Aktivität (bei 39 %), Mitarbeit in Vereinen (bei 37 %) oder in Form (hoch) schulischen Engagements (bei 26 %; ebd., 101). Jugendliche tragen aber auch ganz wesentlich soziale Bewegungen und politischen Protest. Aktivitäten in und Bezugnahmen auf Aktionsformen wie etwa Fridays for Future, Ende Gelände oder Black Lives Matter prägen ihre politische Sozialisation und ihr politisches Lernen (vgl. auch Bundesministerium 2020). In welcher Form dies geschieht, zeigen nicht zuletzt einschlägige Interviews zu solchem Engagement in diesem Band.
JUGEND UND POLITIK – EMPIRISCHES WISSEN AUS QUALITATIVEN UNTERSUCHUNGEN
POLITIKGESTALTUNG ALS LEBENSGESTALTUNGSCHANCE
Alles in allem zeigt sich bei der Betrachtung der oben aufgeführten quantitativen Befunde: Politisches Interesse und politisches Engagement hängen stark von den Lebenslagen ab, in denen junge Leute aufwachsen. Insbesondere werden sie offensichtlich beeinflusst von den Lebensgestaltungschancen, die von den Rahmungen und strukturellen Bedingungen jeweiliger Lebenslagen abgesteckt werden und in ihnen wahrgenommen werden können. Dieser Eindruck verstärkt sich, wenn auch Befunde von qualitativen Untersuchungen einbezogen werden, also von Studien, die nicht mit Fragebogenstatements und deren Ankreuzen operieren, sondern auf ausführlichen und im zeitlichen Verlauf der Biografie mehrfach durchgeführten Interviews mit jungen Menschen zu politisch und sozial relevanten Haltungen basieren. Sie sind in der Lage, detaillierter zu entschlüsseln, was die Befragten eigentlich konkret unter Formulierungen wie z. B. »sich umweltbewusst verhalten«, »durch den Islam unterwandert werden« oder »politisch engagiert sein« verstehen, welche eigenen politisch-sozialen Akzente sie innerhalb einer offenen Gesprächsatmosphäre setzen und wie(so) sich hierbei im Laufe der Zeit Stabilisierungen oder Veränderungen der Haltungen einstellen. Weiterführende Erkenntnisse können hierzu aus der letzten über drei Jahre hinweg erfolgten Langzeituntersuchung zu politisch-sozialen Haltungen von Jugendlichen, hier insbesondere zu Pauschalisierenden Ablehnungskonstruktionen (PAKOs) gegenüber Angehörigen als missliebig eingeschätzter Gruppierungen, entnommen werden (Möller u. a. 2016). Demnach sind es bestimmte biografische Erfahrungen und ihre Verarbeitungsweisen, die Weichenstellungen in Richtung auf die Entwicklung entweder un- und antidemokratischer oder demokratiekonformer Orientierungen und Aktivitäten begünstigen. Genauer gesagt handelt es sich dabei zum einen um Bilanzierungen, die die Befragten in Hinsicht auf ihre Lebensgestaltungsmöglichkeiten, genauer: in Hinsicht auf Kontroll-, Integrations-, Sinn- und Sinnlichkeitserfahrungen, vornehmen; zum anderen betreffen sie mentale Abbilder relevanter Sachverhalte und Personengruppierungen, sogenannte erfahrungsstrukturierende Repräsentationen, die bei der Erfahrungsverarbeitung eine Rolle spielen, und ihre persönlichen Möglichkeiten, bestimmte Selbst- und Sozialkompetenzen für die eigene Erfahrungsverarbeitung zur Verfügung zu haben.
KONTROLLBILANZEN
Menschen haben ein ganz grundlegendes Bedürfnis nach Realitätskontrolle (vgl. Holzkamp-Osterkamp 1975, 1976), d. h., sie sind motiviert, ihre eigenen Geschicke möglichst weitgehend im Griff zu haben, jedenfalls nicht fremden Mächten hilflos ausgeliefert zu sein. Das Gefühl, wie weit das »Heft des Handelns« in der eigenen Hand sein muss, ist allerdings nicht bei allen gleich stark ausgeprägt: Die einen setzen alles daran, z. B. ihren beruflichen Lebensweg bis in die kleinste Verästelung hinein völlig eigenständig zu lenken, die anderen ergeben sich eher dem Schicksal, das sich für sie auf dem Arbeitsmarkt ergibt. Den einen ist es wichtig, den Wohnort und die Wohnverhältnisse gänzlich selbstbestimmt wählen zu können, die anderen schließen weitreichende Kompromisse zugunsten beruflichen Fortkommens oder aus Gründen der Partnerschaft und des Familienlebens. Die einen bilden generell quer über alle Lebensbereiche ein hohes Level an persönlichen Kontrollerwartungen aus, die anderen geben sich mit vergleichsweise geringer Eigenkontrolle zufrieden – dies unter Umständen schon allein deshalb, weil sie wenig Kontrollbewusstsein haben, also annehmen, allenfalls zu einem kleinen Teil den Lauf der Dinge selbst bestimmen zu können.
So unterschiedlich jedoch auch das Niveau an Kontrollerwartungen beschaffen sein mag: Je stärker ich über das, was mich betrifft, verfügen können will, umso mehr leide ich darunter, wenn mir dies nicht im gewünschten Maße möglich erscheint. Wenn ich also eine Bilanz meiner Kontrollmöglichkeit anstelle, dann ist nicht das absolute Maß der mir »objektiv« gegebenen Kontrolle entscheidend dafür, wie sie von mir gewertet wird, sondern die Relation zwischen Erwartungshöhe und tatsächlich erfahrenem Realisierungsgrad von Kontrolle. Sofern nun die erlebten Kontrolldefizite als besonders groß und schmerzlich empfunden werden, liegt es zum einen nahe, äußere Umstände oder andere Personen(gruppierungen) für wahrgenommene Kontrollmängel verantwortlich zu machen, Verschwörungen als ursächlich zu wähnen und diese zu skandalisieren bzw. die dafür scheinbar Verantwortlichen anzugreifen, oder zum anderen Kontrollerfahrungen auch in Formen zu suchen, die außerhalb sozialer Akzeptanz liegen: in Gewaltanwendung, Proklamierung nationalistisch begründeter Privilegien, Diskriminierung Durchsetzungsschwächerer u. Ä. m.
Dass dafür gerade junge Menschen anfällig zu sein scheinen, könnte damit zusammenhängen, dass sie sich in einer Lebensphase befinden, der gesellschaftlich in herausgehobener Weise die Aufgabe zugewiesen wird, als Individuum eine eigenständige Identität zu entwickeln. An Jugendliche wird die Erwartung herangetragen, sich aus den Abhängigkeiten der Kindheit nach und nach zu lösen, sich in der Gesellschaft zu positionieren und damit den Nachweis zu erbringen, mehr und mehr »auf eigenen Beinen stehen« zu können. Dies nicht hinreichend auf gesellschaftlich akzeptierte Weise zu können, wird daher von ihnen nicht selten als Versagen und Schmach erlebt, die nicht hingenommen werden kann. Zur Identitätssicherung wird in der Folge Kontrolle durch den Ausweis von Selbstgewissheit und Durchsetzungsfähigkeit auf anderen Feldern zu belegen versucht. Deshalb ist es alles andere als verwunderlich, wenn die lebensgeschichtlich relevanten Wurzeln des »Nationalpopulismus« (wohl nicht nur) junger Leute auch durch quantitative Forschung in ihrem »Wunsch nach Rückgewinnung von Kontrolle« (Shell 2019, 85) lokalisiert werden.
Wer hingegen Kontrolle über das eigene Leben in Respekt vor der Gleichwürdigkeit aller und unter Einsatz demokratischer Mittel in den Arealen der Politik und des Politischen zu verspüren vermag und/oder auch wahrnehmen kann, dass Mitglieder derjenigen Gruppierung, die als Eigengruppe verstanden wird, vergleichbare Erfahrungen machen (können), muss gar keine Notwendigkeit darin sehen, Kontrolle außerhalb der Sphären solcher Dialog- und Auseinandersetzungsformen zu suchen, da sich hier Selbstwirksamkeit und Identitätsanker finden lassen.
INTEGRATIONSBILANZEN
Menschen sind zutiefst soziale Wesen. Sich irgendwo und irgendwelchen Kollektiven zugehörig zu empfinden, teilhaben zu können, sich anerkannt zu fühlen und Identifikationsmöglichkeiten zu verspüren, ist für sie daher basal. Jede*r will sich sozial integriert fühlen; dies gilt unabhängig von dem von Person zu Person schwankenden Ausmaß, in dem dies angestrebt wird, und auch unabhängig von der Art und Weise, in der das jeweils gesucht wird. Wo das politische System als prinzipiell integrativ, auch für die eigene Person, angesehen werden kann, werden Chancen ersichtlich, solche Bedürfnisse zu realisieren. Wenn aber die subjektive Bilanzierung des erreichten Integrationsniveaus zu dem Resultat kommt, Integrationshoffnungen durch die Beschreitung der gesellschaftlich dafür zur Verfügung stehenden legitimen Wege nicht eingelöst oder zukünftig einlösbar sehen zu können, gleichzeitig aber auch keine wesentlichen Abstriche an ihnen gemacht werden können, dann kann der Versuch attraktiv erscheinen, entsprechende Wünsche anderweitig umzusetzen, etwa durch Anbindung an einen politischen Kontext und politische Gruppierungen, die abseits dieser Wege Integrationserfahrungen versprechen, etwa in sich ethnisch-kulturell abschottenden, rechtsextremistischen, verschwörungsseparatistischen oder »islamistischen« Zusammenhängen.
Jugendliche können deshalb als für solche Angebote besonders ansprechbar gelten, weil sie sich in einer Lebensphase befinden, in der Antworten auf Fragen nach Zugehörigkeit, Anerkennung, Teilhabe und Identifikation im Zuge ihrer Identitätsentwicklung besonders vordringlich erscheinen. Bemerkenswerterweise erwerben Menschen, die aus derartigen »extremistischen« Bezügen aussteigen, im Prozess ihrer Distanzierung für sie neuartige Integrationsoptionen oder reaktivieren frühere, sodass sie mindestens gleichwertigen Ersatz für ihre vormaligen Einbindungen in »extremistische« Politikzusammenhänge gewahr werden. Dabei liegen diese Integrationserfahrungen zumeist gar nicht einmal in Räumen der Politik im engeren Sinne, sondern dort, wo das Politische den Alltag durchwirkt (vgl. z. B. Möller u. a. 2016; Möller/Neuscheler 2018).
SINNBILANZEN
Menschen wollen wissen, inwiefern ein bestimmtes Denken, Fühlen oder Handeln ihnen oder anderen »etwas bringt«, sie wollen Vorteile oder Gewinne darin absehen können – keinesfalls nur materielle – und sie wollen erkennen können, dass ihr Streben, Tun oder Unterlassen nicht völlig belanglos ist, sondern Spuren hinterlässt, kurzum: Sie wollen Sinn darin sehen. In Bezug auf politische Haltungsbildung heißt dies: Solange politische Positionierung und politische Aktivität(sbereitschaft) als etwas wahrgenommen werden kann, das Wirkungen hinterlässt, sind diesbezügliche Aufladungen mit Sinn möglich. Wo hingegen angenommen wird, dass »alles sowieso egal« ist, werden Sinnzuschreibungen und Sinnstiftung verhindert.
Wird mithin das demokratische System als eine Struktur wahrgenommen, über die Interessenabwägungen und öffentliche Belange nicht angemessen reguliert werden können, muss Unzufriedenheit mit ihm und seinen Institutionen nicht erstaunen. Wo das Personal, das in ihm Entscheidungen trifft, als abgehoben vom »Boden der Tatsachen«, wenig vertrauenswürdig, wenn nicht gar als Kundschaft in einem »Selbstbedienungsladen« gilt, fällt es schwer, es als Repräsentanz des Volkes wahrzunehmen und seiner Finanzierung aus Steuergeldern Sinn zuzuschreiben. Unzufriedenheit mit ihm und Skepsis gegenüber derartiger Umsetzung der demokratischen Idee können dann, wenn sie nicht in Resignation und Apathie führen, sowohl in systemkonformes Aufbegehren münden als auch zu Aggressionen verleiten, die einen Umsturz propagieren und dabei gegebenenfalls auch un- und antidemokratische Mittel mit sich bringen.
Und auch hier zeigt sich: Wo das Funktionieren von demokratisch ausgerichteten Kanälen politischer Mitsprache, Mitentscheidung und Mitwirkung erfahren werden kann, wird Distanz zu und Distanzierung von demokratiewidrigen Haltungen ermöglicht (vgl. ebd.).
SINNLICHKEITSBILANZEN
Menschliche Orientierung verläuft nicht ausschließlich kognitiv. Menschen sind bio-psychosoziale Wesen, sie haben Körper und Gefühle. Auch wenn Bedürfnisaufschub über einen gewissen Zeitraum hinweg möglich ist – die Befriedigung sinnlicher Bedürfnisse ist für sie auf Dauer unverzichtbar: sich und andere spüren, Interessantes sehen und hören, geschmackvoll genießen u. a. m. Dementsprechend beurteilen sie ihre Existenz auch danach, welche Erfahrungen ihnen hinsichtlich sinnlicher Befriedigungen zur Verfügung stehen.
Selbst Politik und Politisches sind hochgradig sinnlich aufgeladen: Die Personalisierung von Politik schreitet scheinbar unaufhaltsam voran, sodass Fragen von Sympathie und Aussehen für die, die um politische Gefolgschaft buhlen, immer wichtiger werden. Symbole, die sie verwenden, Metaphern, in die sie ihre Botschaften kleiden, Bilder und Fotos, mit denen sie sich bzw. ihre Themen in Szene setzen, Personen, mit denen sie sich umgeben, Gefühle, die sie zu wecken oder umzulenken vermögen – all das und vieles mehr an personaler Außendarstellung, Themenverpackung und Agendasetting wirkt zunehmend meinungsbildend. Und »das Politische« ist ohnehin in das Alltagsgeschehen und damit auch in dessen Wahrnehmung und emotionale Bewertung verwoben. Aus der Sicht besonders von Herkunftsdeutschen wird diesbezüglich immer wieder vorgebracht: die Anzahl und die Außenwirkung der Migrant*innen, die im ÖPNV mitfahren, die Multikulturalisierung der Nachbarschaft, die Sprachenvielfalt in der Kita, die ethnische Durchmischung von Schulen, die Verfügbarkeit von Lokalen mit internationaler Küche, aber auch die Furcht vor marodierenden Horden Rechtsextremer, die Angst vor mehr Luftverschmutzung und Umweltzerstörung, die Betroffenheit von (scheinbar wachsender) Unsicherheit im öffentlichen Raum u. a. m. Einerlei, ob solche Faktoren als Zumutungen und Bedrohungen oder Pluralitätsgewinne und Innovationsschübe (oder noch anders) erlebt werden: Sie verdeutlichen die emotionale Aufladung des Politischen und damit seine sinnlichen Erfahrungskomponenten. Die darüber vorgenommene Bewertung politischer Aspekte beeinflusst die politische Haltungsbildung enorm (vgl. auch Besand u. a. 2019)