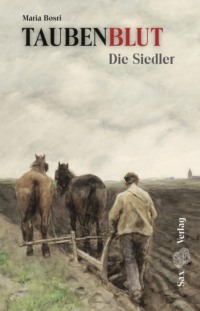Kitabı oku: «Taubenblut. Die Siedler», sayfa 5
Als Nachfolger des sächsischen Königs August III. bestieg 1763 der Pole Stanislaus II. August Poniatowski den polnischen Königsthron. Davor war er polnischer Gesandter in St. Petersburg und Liebhaber der späteren Zarin Katharina II., und die glaubte, mit diesem Mann als König Polen in der Hand zu haben. Außerdem beschnitt sie die Machtgelüste des katholischen Klerus, indem sie den Katholizismus als alleinige Staatsreligion verhinderte. Damit vereitelte sie, dass der Klerus die vom König und einem großen Teil des Hochadels angestrebten Reformen zur Verbesserung der Lebensbedingungen und der Bildung des einfachen Volkes blockierte. Die katholischen Kirchenherren wussten nur allzu gut, dass ein gebildetes und aufgeklärtes Volk den blinden Gehorsam verweigert und sein Elend nicht mehr als gottgegeben hinnehmen würde. Um die wirtschaftliche Lage des durch Krieg und Seuchen entvölkerten Landes zu verbessern, förderte auch König Stanislaus II. August Poniatowski die Zuwanderung ausländischer Handwerker und Bauern mit kostenlosem Land und mehrjähriger Steuerbefreiung. Die Einführung der Schulpflicht für alle Kinder kostete jedoch mehr als gedacht, und die Staatskasse war leer. Dem seit Jahren Not leidenden Volk konnten nicht noch mehr Steuern aufgebürdet werden. Deshalb erwog der König, die »Goldene Freiheit« des Adels aufzuheben und auch dessen Besitz zu versteuern. Ein fatales Ansinnen. Die daraufhin ausbrechenden Proteste gefährdeten das gesamte Reformbestreben. Um letztlich doch noch etwas Geld in die Kasse zu bekommen, veräußerte der König staatlichen Landbesitz. Auf der Verkaufsliste standen auch die Reste der von Flemming gegründeten Domäne.
Johanns Testament
Obwohl der letzte Krieg den Wierzejern kaum Verluste beschert hatte, klagten sie lauthals über die vom Makler geforderten Preise. Kaum einer kaufte etwas und wenn, dann nur ein paar kleine Flecken, um Feldraine zu begradigen oder neue Nachbarn ein wenig auf Abstand zu halten. Im Stillen hofften sie auf sinkende Preise, bauten darauf, dass sich niemand für dieses unfruchtbare Land interessiert. Nur der inzwischen 64 Jahre alte Schlüter Johann kaufte, ohne lange zu feilschen, ein größeres Stück halbwegs tauglichen Ackerlandes und sämtliche Riedwiesen zwischen seinen Feldern und dem großen Moor. Noch zu Lebzeiten seiner Mutter Uta hatten sie am Rand des Moores einen Torfstich aufgetan. Nun fürchtete Johann, dass ihm ein neuer Eigentümer den Weg über die Riedwiesen verwehren könnte. Die Fuhrwerke müssten dann den viel weiteren und stark ausgefahrenen Sandweg benutzen. Dieser Umweg würde schnell teurer werden als die Summe, die der Makler für die Riedwiesen verlangt. Außerdem war Johann davon überzeugt, dass der Wasserstand durch den Torfabbau spürbar sinkt und die Flächen soweit austrocknen, um darauf Weizen, Rüben, Hanf und Kohl anbauen zu können. Der alte Schlüter kaufte überdies das verlandete Uferstück samt Schilfgürtel, das sich von der Dorfmitte bis zum nördlichen Ende des Sees erstreckte. Ein wegloses, von Schwarzerlen umsäumtes, völlig versumpftes Gebiet, das höchstens zum Entenschießen zu gebrauchen war. Im Dorf wurde gemunkelt, um endlich dieses Stück »Unland« los zu sein, hätte der Makler das Seeufer mit einem dicken Strich überzeichnet und so den Schlüterschen Riedwiesen zugefügt. Und der gewiefte Alte sollte für das ganze Uferstück nur einen geräucherten Schinken, ein kleines Fass Pökelfleisch und mehrere Gläser Honig bezahlt haben.
Nur wenige Tage später fuhr der alte Schlüter Johann nach Piotrków Trybunalski, um seine Landkäufe in den Grundbüchern eintragen zu lassen. Danach begab er sich zu einem Notar und beauftragte ihn, in einem unanfechtbaren Testament seinen Enkel Georg als alleinigen Hoferben zu benennen. Der alte Bauer wusste, dass sich seine Töchter und Charlotte, die Witwe seines Sohnes Friedrich, bei seinem Tod aufs Übelste ums Erbe streiten würden. Und da Georg der einzige männliche Nachkomme war, hätten seine Töchter wahrscheinlich das Nachsehen. Charlotte, die Mutter seines im Frühjahr in Piotrków Trybunalski konfirmierten Enkels, führte in Warszawa ein kostspieliges und beschämend unsittliches Leben. Ohne verbindliches Testament könnte diese Person einen willigen Richter finden, der ihr die Vormundschaft über den Jungen zuspräche. Dann wären Hof und Vermögen in Kürze durchgebracht. Friedrich hatte diese Frau 1750 ohne das väterliche Einverständnis geehelicht und war mit ihr nach Warszawa gezogen. Charlotte gebar noch im selben Jahr einen Knaben, den man auf den Namen Georg taufte. Nur dieses Kindes wegen hatte Johann so manchen Schuldschein des jungen Paares beglichen. Als Friedrich 1758 bei einem Duell erschossen wurden war, entledigte sich seine Witwe des achtjährigen Kindes, indem sie es auf immer zu ihren Schwiegereltern schickte. Für den Jungen war der Umzug aufs Land eine wahre Befreiung. In Warszawa durfte er die Wohnung nur in Begleitung seiner Mutter verlassen, und das geschah höchst selten. Die Mutter glaubte, der schmächtige Knabe verschandele beim Promenieren ihre Eleganz.
Für Johann und seine Frau Sofie war die Ankunft des kleinen Georg ein Zeichen des Himmels. Das kränkelnde und verängstigte Kind gesundete unter der liebenden Fürsorge seiner Großeltern in kürzester Zeit und wich seinem Großvater kaum noch von der Seite. Von nun an hatte die Mehrung des Besitzes für Johann wieder einen Sinn. Er fühlte aber, dass ihm nicht mehr viel Zeit blieb, um dem Jungen das notwendige Wissen zum Führen eines so großen Anwesens zu vermitteln. Mit dem beim Notar hinterlegten Testament sicherte Johann außerdem die Versorgung seiner Frau während der Witwenschaft. So musste er nicht befürchten, dass der Hof verschleudert würde und Sofie ihre letzten Jahre in einer Mägdekammer oder einem Stallverschlag hausen müsste. Viel zu oft hatte der Alte die Gier der Schwiegertochter zu spüren bekommen. Ebenso wenig hatte er vergessen, wie ihn seine Töchter bedrängten, ihren Bruder Friedrich wegen seines Ungehorsams zu verstoßen und zu enterben. Dabei war jede Mitgift, die er zu den Hochzeiten gezahlt hatte, viel höher als Friedrichs Schulden. Vielleicht hätte er die Gier seiner Töchter noch verstanden, wenn es ihnen schlecht ginge. Doch dem war nicht so, beide lebten in schönen Häusern und in Wohlstand. Und keine der beiden käme auf den Hof zurück, um hier den Teig für das tägliche Brot mit eigenen Händen zu kneten. Dem alten Johann waren seine Töchter längst fremd geworden, und er ärgerte sich kaum noch, dass es Jahre her war, seit er sie das letzte Mal gesehen hatte. Deshalb folgte er dem Vorschlag des Notars, seinen Töchtern und der Witwe seines Sohnes sofort Kopien des Testaments zukommen zu lassen. Dann könnte nach seinem Tod niemand behaupten, vom Ausbleiben des Erbes überrascht worden zu sein.
Die Sachsen und die polnische Sprache
Als 1764 zwei kleine verlassene Anwesen und das bis dahin königliche Domänenland zum Verkauf standen, gab es mehrere Bewerber. Die beiden Häuslerkaten, die am Dorfrand unweit der Straße nach Piotrków Trybunalski standen und zu denen kaum Land gehörte, kauften eine russisch-orthodoxe und eine jüdische Familie. Die bis kurz vor die Siedlung Kolo reichenden Wälder und die zwischen der Dorfmitte und der Sulejówskaer Straße liegenden Brachen kauften Polen. Und die begannen noch im selben Monat mit dem Bau von Häusern.
Die meisten protestantischen Wierzejer sahen in den andersgläubigen Zuzüglern gefährliche Eindringlinge, vor denen sie sich und ihre Familien schützen müssten. Dabei schmerzte besonders die Erkenntnis, dass dies alles nur durch ihren eigenen Geiz und ihre Kurzsichtigkeit geschehen konnte. Doch nun steckte dieser fremde Dorn in ihrem Fleisch und würde schwären. Am meisten sorgten sie sich um ihre Kinder, fürchteten, die nun ins Dorf kommenden Jesuiten könnten sie mit Schmeichelei umgarnen und von Luthers reiner Lehre weglocken. Und die Jesuiten verstanden ihr Geschäft, sonst wäre es ihnen seinerzeit nicht gelungen, das bereits zu großen Teilen protestantisch gewordene Polen zum Katholizismus zurückzuholen.
Zum Glück sprach keiner der zugezogenen Katholiken Deutsch. Die besorgten protestantischen Eltern drangen deshalb auf den ausschließlichen Gebrauch der deutschen Sprache. Unter Androhung schwerer Strafe untersagten sie ihren Kindern, sich den Kindern der Zugezogenen zu nähern. Ein völlig sinnloses Unterfangen, denn im Zuge der Reformen wurde Polnisch alleinige Amtssprache und ebenso Unterrichtssprache. Selbst in den Pausen durfte nicht mehr Deutsch gesprochen werden.
Daraufhin befürchteten die älteren Lutheraner, dass die Jugend das Deutsche verlernen und somit die von Luther übersetzte Heilige Schrift nicht mehr lesen könnte. Zudem war Deutsch die Sprache ihrer Vorfahren. Ohne diese Sprache wäre es kaum möglich, in die sächsische Heimat zurückzukehren. Bisher wollte zwar noch niemand zurück, doch die Zeiten könnten sich ändern, schließlich rasselte irgendwer immer mit dem Säbel. Dabei hofften alle, dass der Frieden hält, zumal jetzt ein Pole auf dem Thron sitzt. Dieser neue König soll sogar ein Gesetz erlassen haben, das Einwanderern Glaubensfreiheit zusichert. Doch hier, weitab Warszawas, herrschte der katholische Klerus, und der rechnete das Schikanieren von Protestanten immer noch zu den gottgefälligen Taten.
Es war zwar nicht verboten, seine Kinder zusätzlich zu unterrichten, man sollte es aber nicht an die große Glocke hängen. Denn wer sich Privatlehrer leistet, hat Geld und kann folglich höher besteuert werden. Hatte ein katholischer Amtmann erst einmal eine derartige Schlussfolgerung gezogen, kostete es einen Protestanten eine Menge, ihn wieder davon abzubringen. Nur selten wurde das Ganze billiger als die höher angesetzte Steuer.
Von Anfang an litt die kleine sächsische Gemeinde schwer an der polnischen Sprache. In den ersten Jahren nach der Einwanderung hatten nur wenige Lutheraner Polnisch schreiben und lesen gelernt. Wozu auch. Im Dorf sprach man Deutsch, die wohlhabende jüdische Kundschaft auf dem städtischen Markt sprach ebenfalls Deutsch, und die polnischen Tagelöhner begriffen schnell, was sie wie tun sollten, um nicht vom Hof gejagt zu werden.
Nur Uta und der Steinmetz sowie deren Familien bemühten sich, die fremde Sprache richtig zu sprechen. Bei Uta geschah es anfangs aus dem Glauben heraus. Wie sollte sie den Einheimischen Luthers Lehre verkünden, wenn sie nicht deren Sprache sprach? Außerdem ließ sich besser Handel treiben. Den Steinmetz dagegen ärgerte, dass die polnischen Tagelöhner seine Anweisungen oft falsch verstanden. Dadurch kam es zu Verzögerungen und auch zu Gefahren. Beim Hantieren mit den schweren Balken hatte sich ein Tagelöhner böse verletzt, nur weil er den warnenden Zuruf nicht verstanden hatte. Für den Steinmetz ein solcher Gräuel, dass er sich mit Uta zusammentat, um in Petrikau nach einem polnischen Lehrer zu suchen. Im Gemeindehaus wäre ausreichend Platz, und teilten sich sieben Familien die Kosten, wäre die Belastung durchaus erträglich. Der Schmied wollte es sich noch überlegen, doch die anderen Bauern lehnten den Vorschlag rundweg ab. Der König spräche auch kein Polnisch, und die Polen hatten ihn trotzdem auf den Thron gesetzt. Warum also sollte man sich mühen und sogar Geld ausgeben? Und falls irgendwann ein Brief geschrieben werden müsse, könne das ein Schreiberling erledigen. Man sei schließlich Bauer und kein Gelehrter und wolle auch nie einer werden.
Als Uta ihre beiden Töchter damals sogar auf eine städtische Schule schickte, lachte man im Dorf über den Größenwahn der Schlüterin. Doch statt in sich zu gehen und zu schweigen, warf diese den Spöttern vor, aus purem Geiz selbst zu fehlen und Luthers Aufforderung zum Sprachenlernen zu missachten. Denn das Wenige, das man den Kindern in der Schule beibringt, genüge vielleicht, um später die Heilige Schrift und Luthers Predigten lesen zu können. Um jedoch die Botschaft des Herrn mit eigenem Verstand zu erfassen und nach seinem Willen zu verbreiten, dazu reiche es nicht!. Oder wollten sie warten, bis ihre polnischen Nachbarn die deutsche Sprache lernten? Trotz Utas aufrüttelnder Rede befleißigte sich kaum einer der Bauern, mehr als die allernotwendigsten Ausdrücke dieser fremden Zischsprache zu lernen. Im Stillen gaben sie Uta zwar Recht, doch ihre Dickköpfigkeit hinderte sie, die einmal kundgetane Meinung zu widerrufen. Dieses Weib hatte bereits viel zu oft ihren Willen durchgesetzt und diesmal sollten doch nur alle mitmachen, damit sie und der Steinmetz den Lehrer nicht allein bezahlen müssen.
Mit der Zeit kam den Bauern ihre Sturheit teuer zu stehen. In der Summe kosteten die Dienste der Petrikauer Schreiberlinge mehr als der Lehrer in allen vier Wintern. Nicht mitgerechnet die Zeit, die sie wartend in den Schreibstuben verbrachten, anstatt auf ihren Feldern und Höfen zu arbeiten. Neben diesen offensichtlichen Verlusten piesackte die Bauern noch eine andere Sache. Sie ärgerte das weithin zu hörende fröhliche Singen und Lachen, wenn polnische Landarbeiterinnen mit Uta oder der Steinmetzfrau auf den Feldern arbeiteten. Auf den anderen Feldern wurde schweigend geschafft, dort lauschte der Bauer misstrauisch, was da hinterrücks auf Polnisch geflüstert wurde. Doch am allermeisten erboste die Bauern, dass ihre eigenen Kinder trotz Verbot mit den Polenkindern spielten, sich inzwischen mit ihnen bestens verstanden und hinter den Rücken ihrer Väter über deren Unwissenheit und Sturheit lachten. Manches der Kinder hätte gern am abendlichen Unterricht teilgenommen. Und so manche Mutter flehte ihren Ehemann an, es den Kindern zu erlauben. Vergebens, alle fünf Familienoberhäupter blieben stur. Vier Winter lang blieben der Steinmetzsohn Franz, des Schmiedes drei Töchter sowie Utas Töchter Martha und Emma die einzigen Kinder, die im Lesen und Schreiben der polnischen Sprache unterrichtet wurden.
Als August II. im Verlauf des Schwedenkrieges den polnischen Thron aufgeben musste und der Pole Stanislaus I. Leszczynski, Günstling Karls XII., 1705 die Krone aufgesetzt bekam, war es äußerst nützlich, sich mit einem polnischen Amtmann in dessen Sprache verständigen zu können, denn ein vom Amtmann hinzugezogener Übersetzer kostete nicht wenig. Vier Jahre später kehrte August II. auf den polnischen Thron zurück. Nun waren die sächsischen Bauern wieder obenauf und vergaßen schnell, dass mit einem Herrscherwechsel meist auch die Amtssprache wechselt. Sie schickten ihre Kinder lieber wieder aufs Feld arbeiten, statt in die Schule. Wozu auch? Söhne lernen die Landwirtschaft vom Vater und die Töchter alles Nötige von der Mutter. Und Polnisch lernen, um sich mit diesen Jesuitenzöglingen besser verständigen zu können, hielten sie, nach der Rückkehr ihres Königs, für ganz und gar überflüssig. Deshalb spottete man nicht wenig, als Uta ihre beiden Töchter sogar noch in ein Internat gab, in dem sie nicht nur Französisch, Gesang und das Klavierspiel lernten, sondern auch das Getue reicher Töchter annahmen. Erst Jahre später, als der Steinmetzsohn Franz Neumann in Piotrków Trybunalski zum geachteten Bauhüttenmeister aufstieg und der wohlhabende Kaufmannssohn Karl Mannich die zweitgeborene Emma Schlüter heiratete, verstummte der Spott. Aber nur, um in gehörigen Neid umzuschlagen. Trotzdem fanden die inzwischen in die Jahre gekommenen Bauern immer neue Argumente, verweigerten sich weiterhin dem Erlernen der polnischen Sprache. Vermutlich fürchteten sie, dass dann ihr eigenes schlechtes Deutsch zutage käme, denn seit ihrer Schulzeit hatten sie, abgesehen von der Weihnachtsgeschichte, die sie zudem meist aus dem Gedächtnis vortrugen, kaum etwas gelesen und erst recht keine Zeile geschrieben.
Jahre später, mitten in der Kartoffelernte, klopfte ausgerechnet ein Meißner an Utas Tür und bat um Hilfe. Die Angelegenheit sei dringend und er könne doch nicht alles stehen und liegen lassen, um den städtischen Schreiber aufzusuchen. Die Schlüterin half, obwohl sie wahrlich genug anderes zu tun hatte. In den nächsten Wochen baten auch die anderen Bauern Uta oder des Steinmetzen Frau Isolde um Hilfe. Das war bequem, und außerdem sparten sie gehörig Geld. Isoldes Ehemann Wolfgang gefiel das überhaupt nicht. Das Augenlicht seiner Frau war nicht mehr das Beste, er fürchtete, dass die Anstrengung ihr schadet. Doch auch Uta war nicht gewillt, auf Dauer der Bauern Sparstrumpf zu sein und verlangte einen entsprechenden Obolus für die oft stundenlange Mühe. Der polnische Lehrer habe schließlich auch Geld gekostet. Die Empörung über Utas Verlangen war groß. Doch letztlich zahlten sie, denn die städtischen Schreiber waren nicht nur bedeutend teurer, sie ließen die Lutheraner oft stundenlang warten. In ärgste Bedrängnis kamen die alten Wierzejer Bauern in den Querelen nach August II. Tod, als erneut Stanislaus I. Leszczynski den polnischen Königsthron bestieg. Zum Glück für die Lutheraner war ein Großteil des polnischen Adels gegen diesen König. 1736, nach nur zwei Jahren, jagte man Leszczynski endgültig davon und mit August III. gelangte der nächste Wettiner auf den polnischen Thron. Anstatt seine Untertanen zu regieren, kümmerte sich der König lieber um seine Kunstsammlungen. Und noch weniger kümmerte ihn, welche Sprache in den Amtsstuben seines Königreiches gesprochen wurde.
Inzwischen ruhten Uta, Isolde und auch beider Ehemänner auf dem Gottesacker. War ein Vertrag zu Papier zu bringen, mussten die Bauern zu einem jüdischen Schreiber nach Piotrków Trybunalski fahren. Obwohl dieser viel teurer war als die polnischen Schreiber, zahlten die Lutheraner dessen Wucherpreis. Viel zu groß und auch allzu berechtigt war ihr Misstrauen, dass die Polen ihr Wissen den Ämtern meldeten, allein schon, um den Protestanten zu schaden. Der Jude dagegen mied die allmächtigen Behörden. Er kannte deren Geldgier nur zu gut und fürchtete, dass sie daraufhin auch ihn bis auf den letzten Thaler auspressen würden. Obwohl es ihnen zutiefst widerstrebte, nach Utas Tod blieb den Bauern nichts anderes übrig, als die polnische Sprache lesen und schreiben zu lernen. So kam es, dass in den meisten Familien abends gesessen und geübt wurde. Für manchen der längst ergrauten Väter eine harte Geduldsprobe, waren ihm doch seine Kinder und Enkelkinder, nicht nur im Sprachlichen, weit voraus. Oft willkommener Anlass, die Führung des Hofes in jüngere Hände zu legen und sich aufs Altenteil zurückzuziehen. Nun hatte man nicht nur die Zeit, sondern auch den Ehrgeiz, sich mit dem polnischen Nachbarn zu unterhalten. Trotzdem dauerte es noch einige Jahre, bevor die alten Lutheraner und Katholiken das auf beiden Seiten tief verwurzelte Misstrauen überwanden. Die Jüngeren hatten längst begonnen, sich gegenseitig zu helfen. Schließlich waren sie allesamt Bauern und von den Erträgen ihrer Äcker abhängig.
Der 1756 von Preußen entfachte Krieg zur Eroberung Sachsens und Schlesiens berührte, bis auf den nördlichen Landstrich, kaum polnisches Gebiet. Wäre nicht das umherziehende Gesindel, das jeder Krieg mit sich bringt, hätten die Wierzejer davon überhaupt nichts gemerkt. Erst 1763, beim Tod Augusts III., er verschied während einer Opernaufführung, schreckten die Dörfler auf. Neuer König wurde Stanislaw II. Poniatowski, ein Pole.
Die von ihm angeordnete Schulpflicht scheiterte vielerorts bereits im ersten Jahr. Abgesehen davon, dass es zu wenig Lehrer gab und besonders auf den Dörfern Stellen unbesetzt blieben, waren viele der ärmeren Höfe auf die Mitarbeit ihrer Kinder angewiesen. Mit dem Beginn der Frühjahrsbestellung lichteten sich die Reihen der Schüler um die gute Hälfte. Von den restlichen Kindern, die noch zur Schule kamen, waren viele so erschöpft, dass sie im Unterricht einschliefen. Wurden sie vom Lehrer erwischt, gab es Stockschläge, die Jungen aufs Hinterteil, die Mädchen auf die ausgestreckten Hände. Die Härte der Schläge richtete sich gewöhnlich danach, welcher Religion das Kind zugehörte. Bei protestantischen und jüdischen Kindern schlugen die polnischen Lehrer viel kräftiger zu.
Das Ende des sächsisch-polnischen Königtums und die damit einhergehende Änderung der Amtssprache verdeutlichte erneut aufs Schmerzlichste die Wichtigkeit von Sprachen und Bildung. Familien, die es sich leisten konnten, schickten ihre Kinder nach der Dorfschulzeit für weitere drei bis vier Jahre auf städtische Schulen. Die an den Stadtschulen geknüpften Kontakte dienten später auch der Vermittlung von Ehen. Und konnte eine der Töchter nicht verheiratet werden, fand sie wenigstens eine gut bezahlte Anstellung. Die Geschwister eines Hoferben blieben nach ihrer Volljährigkeit nur selten auf dem elterlichen Anwesen, denn hier wäre die Höhe ihres Lohnes vom Wohlwollen des Hoferben abhängig. Dabei war es beinah die Regel, dass Familienmitgliedern überhaupt kein Lohn gezahlt wurde, ihre Arbeit mit Kost und Logis als abgegolten galt. Einige der jungen Leute zogen so weit weg, dass Jahre vergingen, ehe ein erstes Lebenszeichen eintraf.
Auf dem Schlüterhof kam es 1766, nach Johanns Tod, zu einem heftigen Streit unter den Erben, doch das vom Notar aufgesetzte Testament war unanfechtbar. Jetzt zahlte sich aus, dass Sofie, Johanns Witwe, auf einem preußischen Mustergut aufgewachsen war und die Landwirtschaft sprichwörtlich mit der Muttermilch aufgesogen hatte. Bereits 66 Jahre alt, lehrte sie Georg fortan alles, was er als guter Bauer wissen musste. Als Georg 1772 heiratete, konnte sich Sofie endlich zur Ruhe setzen. Georgs Frau Frieda stammte aus dem Dorf Poniatów, war die älteste von drei Töchtern und Hofarbeit gewohnt. Noch im gleichen Jahr gebar die junge Hofbäuerin ihr erstes Kind. Ein Mädchen, das auf den Namen Gertraud getauft wurde. Die nächsten drei Kinder, alles Mädchen, starben bereits im frühen Kindesalter. In dieser schweren Zeit wurde auch Sofie zu Grabe getragen. Erst mit der 1778 geborenen Luise kehrte das Glück auf den Hof zurück. Das Kind wuchs und gedieh. Drei Jahre später war Frieda erneut guter Hoffnung. Der lang ersehnte Hoferbe kam jedoch viel zu früh auf die Welt. Das Kind starb noch vor dem Eintreffen des Pfarrers. Nur wenige Tage später starb auch Frieda.
Polen und die Politik der Großmächte
Im Februar 1768 erzwang Russland vom tagenden Sejm die Zustimmung zu einem »Ewigen Vertrag«, mit dem die sich abzeichnende Stärkung des polnischen Staatswesens verhindert werden sollte. Doch der Widerstand gegen das russische Diktat war damit nicht gebrochen. Unter Führung des Bischofs der ukrainischen Stadt Kamieniec Podolski forderten die Adeligen ein Ende der russischen Bevormundung, sowie die generelle innere und äußere Unabhängigkeit Polens. Bei einer Zusammenkunft auf der Festung Bar forderten sie außerdem den Widerruf der im Ewigen Vertrag zugesicherten Glaubensfreiheit für Dissidenten. Und sie stellten sich gegen die dringend notwendigen wirtschaftlichen Reformen. Der Widerstand gipfelte in der Konföderation von Bar, die zum bewaffneten Aufstand gegen die Russen, ihren eigenen König und den zarentreuen polnischen Adel aufrief. Als König aller Polen versuchte Stanislaw II. Poniatowski, zwischen den Aufständischen und der Zarin Katharina II. zu vermitteln. Währenddessen lieferten sich marodierende Truppen der Konföderation und russische Truppen so heftige Kämpfe, dass der König dem polnischen Heer befahl, die Festung Bar zu erstürmen, was auch gelang. Trotz dieser Niederlage weitete sich der Aufstand auf die gesamte westliche Adelsrepublik und Litauen aus. Zur gleichen Zeit erhoben sich die ukrainischen Bauern und Kosaken gegen die polnische Fremdherrschaft. Obwohl dieser Hajdamakenaufstand ganz andere Ziele verfolgte, verschaffte er den Konföderierten zunehmendes internationales Interesse. So erstarkt, bat deren Rat die westeuropäischen Herrscherhäuser um Unterstützung bei ihrem Kampf gegen die russische Vorherrschaft. Es kam zu einer antirussischen Koalition unter der Führung eines französischen Generals. Dieser General verhinderte den Beitritt des polnischen Königs zum Lager der Konföderierten, indem er den König des Verrates bezichtigte. Dermaßen brüskiert, wandte sich Stanislaus II. Poniatowski wieder der Zarin zu. Nach zwei Jahren Kampf hielten die Konföderierten nur noch zwei kleine Gebiete. Eines um die alte Hauptstadt Wilna herum, das andere, ein länglicher Streifen zwischen Kaliz und Kraków, mit dem Fluss Pilica als östliche Begrenzung. Eine äußerst angespannte Situation für die in den Gebieten der Konföderierten lebenden Evangelischen, hatten doch hier die katholischen Würdenträger das absolute Sagen. Besonders schlimm erging es den protestantischen Bauern im mittelpolnischen Landstrich zwischen Kaliz und Radomsko. Hier wurde nicht nur enteignet und vertrieben, sondern auch getötet.
Die sächsischen Protestanten in Wierzeje wurden verschont, weil sie seit 1763 als Polen galten. Außerdem waren sich die umliegenden kleinen Grundherren nicht sicher, inwieweit deren Höfe noch unter dem Schutz hochadeliger Magnaten standen. Die Angst, wegen Landraubes oder gar Mordes vor Gericht gestellt zu werden, war folglich größer als alle Gier. Die Sachsen galten aber nicht nur formal als Polen, sie beherrschten inzwischen die polnische Sprache so gut, dass sie von durchziehenden Aufständischen oder plünderndem Gesindel nicht mehr als Deutsche erkannt wurden. Und auch in dieser schwierigen Zeit diente das Moor den Dorfbewohnern zur sicheren Verwahrung von allerlei Besitz, sodass sich die Verluste in Grenzen hielten.
Das Ende Polens
Im Spätsommer des Jahres 1772 schlugen russische Truppen den Aufstand endgültig nieder. Die drei Großmächte Preußen, Österreich-Ungarn und Russland beglichen ihre Kriegskosten mit der Inbesitznahme polnischen Gebietes. Die Zarin nahm sich ein Stück Litauen, die österreichische Kaiserin Teile Galiziens sowie ein kleineres Stück Schlesiens und der preußische König den Landstrich zwischen Pommern und dem Königreich Preußen. Damit verfügte er endlich über die seit langem angestrebte Landverbindung zum östlichen Teil seines Königreiches. Für die polnische Adelsrepublik bedeutete dies jedoch den Verlust des direkten Zugangs zur Ostsee. Dieser Raub polnischen Territoriums brachte den zerstrittenen Adel zur Besinnung. Die Reform des Staatswesens und der Wirtschaft wurde erneut in Angriff genommen. Um die Bildungsmisere zu beenden, gründete man sogar eine Erziehungskommission. Doch erst 1788, mit der Aufhebung des Liberum Veto, wurde das größte Hemmnis bei der Modernisierung des Staates abgeschafft. Von nun an galt im Sejm das Mehrheitsprinzip. Im Mai 1791 nahm man eine neue Verfassung an, in der auch die Besteuerung des Adels und die Errichtung eines stehenden Heeres festgeschrieben wurden.
Die sich abzeichnende innere Einheit Polens beunruhigte die benachbarten Großmächte. Der Zarin gelang es, einige der reichsten Magnaten zu einer Gegenreform aufzustacheln. In der Konföderation von Targowica baten diese die Zarin um militärischen Schutz und schufen somit die politische Voraussetzung einer russischen Intervention. Auf dem im Sommer 1792 in Grodno tagenden Sejm erzwang die Zarin mittels militärischer Präsenz die Rücknahme der Verfassung, eine Reduzierung des Heeres und eine weitere Aufteilung Polens. Preußen bekam den westlichen Teil mit Posen bis hin zum Fluss Pilica und Russland die Ukraine und ein Stück Litauen. Piotrków Trybunalski, samt den umliegenden Dörfern, wurde preußisch. Piotrków Trybunalski hieß fortan Petrikau. Und weil noch keine neuen Landkarten zur Verfügung standen, benutzten die neuen Verwalter die alten, teils stark verblichenen polnischen Karten. Darauf zogen sie die Namen kleinerer Ortschaften, so lange sie nicht wegen Unaussprechlichkeit eingedeutscht werden mussten, nur dick nach. Wierzeje blieb Wierzeje.
Wie vordem Friedrich II. während des Siebenjährigen Krieges scherte sich auch Friedrich Wilhelm II. nicht um die Glaubenszugehörigkeit seiner neuen Untertanen. Ihn interessierte lediglich deren Militärtauglichkeit und die pünktliche Entrichtung von Steuern und Abgaben. Zu diesem Zweck wurde in jedem Landkreis der neuen Provinz Südpreußen eine Kriegs- und Domänenkammer eingerichtet. Im Mai 1793 nahm die Petrikauer Landkreisverwaltung ihre Arbeit auf, die Stadt wurde zudem Sitz des Provinzialgerichtshofes. Es entstand ein gewaltiger Beamtenapparat, der das Leben der neuen Untertanen mit preußischer Bürokratie zu regeln versuchte. Dabei beherrschte kaum einer der neuen Staatsdiener die polnische Sprache. Das war ein großer Vorteil für die sächsischen Einwanderer bei der Festlegung der Steuer. So konnten sie den in den Behörden sitzenden Preußen die Größe ihres Besitzes verständlich und glaubwürdig beschreiben – und dabei klein reden. Das war möglich, weil in der ehemaligen polnischen Adelsrepublik Landbesitz noch nie markscheiderisch vermessen wurde. Besitzgrenzen verliefen über markante Punkte, Wasserläufe oder zu diesem Zweck errichtete Grenzsteine. Ein Kontributationskataster zur Schätzung des Ertrages der einzelnen Grundstücke, wie es in Westpreußen seit 1772 bestand, musste für die neue Provinz Südpreußen erst erstellt werden. Auch die 1763 bei der Auflösung der Domäne gekauften Flächen waren nur grob geschätzt und nicht exakt vermessen worden. So standen in den Grundbüchern Maße, die nur selten mit der Wirklichkeit übereinstimmten. Die preußischen Beamten ließen sich die Richtigkeit der Angaben, dazu zählte auch der Viehbestand, von den Landbesitzern beeiden. Ein Eid war etwas Heiliges. Trotzdem gab es keinen einzigen Bauern, der wegen falscher Flächenmaße und des nur halb gezählten Viehbestandes Bedenken oder gar Gewissensbisse hatte. Schließlich hieß es im Eid: »nach bestem Wissen und Gewissen«. Und was konnte man dafür, wenn das Vieh nicht still am Fleck stehen blieb und wartete, bis es gezählt war.
Die bereits von König Stanislaw II. Poniatowski polonisierten Lutheraner merkten recht schnell, dass sich die preußischen Beamten in der Petrikauer Kriegs- und Domänenkammer nicht gerade durch Fleiß auszeichneten. Es musste kaum eine Überprüfung ihrer Angaben vor Ort befürchtet werden. Kein Wunder, hatte man doch hauptsächlich diejenigen hierher versetzt, die schon im Brandenburgischen oder Preußischen wenig oder nichts leisteten, aber noch nicht pensioniert werden konnten. Das einzige Interesse dieser Staatsdiener galt der Aufbesserung ihres Beamtensalärs mittels Schmiergeldern. Nur einer der Staatsdiener war dazu nicht fähig oder nicht willens: Der Forstrat Freiherr von Eberstein musste nicht bestochen werden. Dieser Mann glaubte unbesehen alles, was ihm die Bauern angaben, sie mussten nur recht unterwürfig daherkommen. Die Korruption nahm schon nach kurzer Zeit solche Ausmaße an, dass der preußische Justitiar Joseph von Zerboni beim Oberpräsidenten von Schlesien und Südpreußen, dem Grafen von Hoym, Anzeige erstattete. Doch damit erreichte er nur, dass man ihn wegen Verleumdung verhaftete und im Spandauer Gefängnis festsetzte. Selbst die polnischen Bauern fügten sich widerstandslos der preußischen Herrschaft, da sich die Lebensbedingungen der Landbevölkerung beträchtlich verbesserten. Auch wenn die Leibeigenschaft nicht abgeschafft wurde, ein vom preußischen König zugesicherter und gewährter Rechtsschutz verbot den Grundherren die Misshandlung von Leibeigenen. Ebenfalls verboten wurde das bisher übliche Bauernlegen, bei dem ein Grundherr willkürlich Bauernland als Gutsland einzog, um dadurch seinen Besitz zu vergrößern. Dieses Verbot sicherte erstmals den Landbesitz der Bauernschaft.