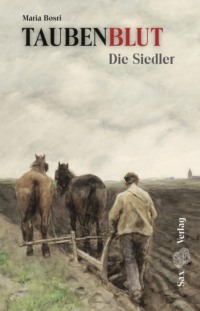Kitabı oku: «Taubenblut. Die Siedler», sayfa 4
Ein Blick nach Russland
Lange Zeit hatte es genügt, in den Sommermonaten ein paar Schiffe nach Archangelsk zu schicken. Das einzig lohnende Geschäft war der Aufkauf von Pelzen, und diese Ware erforderte keine Eile.
Seit dem Machtantritt von Zar Peter I. öffnete sich das Land. Mit großem Nachdruck betrieb der Zar den wirtschaftlichen Aufschwung seines rückständigen Herrschaftsgebietes. Dafür brauchte man nicht nur stetig nutzbare Handelswege, sondern ebenso sichere Zwischenlager und Geschäftsräume. Wie ernst es Peter I. mit dem Fortschritt seines Reiches war, verdeutlichten seine Kriege um einen ganzjährig offenen Hafen und den Zugang zu den Weltmeeren. Am Asowschen Meer unterlag er den Türken. Daraufhin konzentrierte er sich auf den nördlichen Seeweg. Gleich zu Beginn des Nordischen Krieges gelang es ihm, den Schweden das Gebiet vom Ladogasee bis zur Newamündung abzuringen. Zur Sicherung dieser hart erkämpften Position ließ er 1703 in den Sümpfen der Newabucht eine Festung errichten, von der aus der gegenüberliegende Hafen samt Werft verteidigt werden konnte. Tausende von Leibeigenen mussten dabei unter unsäglichen Bedingungen schuften. Ein wichtiges Anliegen des Zaren waren Ausbau und Sicherung des Seeweges ins westliche Europa. Die um die Hafenanlagen herum entstehende Stadt wurde von Anfang an geplant und nach dem himmlischen Torwächter »Sankt Peter« benannt. Den Baumeistern und Handwerkern folgten die Geldverleiher und die Händler. Große Handelsunternehmen und Bankhäuser schickten ihre Abkömmlinge. Diese sollten die alten Ost-Handelsrouten wiederbeleben sowie Niederlassungen gründen, denn das große Reich war nicht in der Lage, den riesigen Bedarf an Waren zu decken. Zudem entbrannte ein mit härtesten Mitteln geführter Wettstreit um die besten Ausgangspositionen auf dem Weg in die Weiten Russlands.
In der Folge stiegen in Warschau, der ersten Station gen Osten, die Grundstückspreise und Mieten ins Unermessliche. Weniger finanzkräftige Handelshäuser wichen auf kleinere Städte Mittelpolens aus. Das betraf auch einige protestantische Unternehmen aus dem Sächsischen.
Die nach Piotrków Trybunalski Zugewanderten waren überglücklich, als sie beim Marktgang die heimatliche Sprache vernahmen und sogar auf Lutheraner trafen, die über ein Gemeindehaus verfügten. War es erst nur der gemeinsame Gottesdienst, ergaben sich bald auch kleine Gesellschaften. Während die Jugend miteinander scherzte und tanzte, erforschten die Alten die Besitzverhältnisse. Man wollte schließlich wissen, ob sich die Annäherung lohnt. Eigentlich heirateten Kaufleute nicht in Bauernfamilien ein. Doch die Sachsen waren schließlich mehr als einfache Bauern und in dieser unruhigen Zeit konnte selbst der vorsichtigste Händler über Nacht zum Bettler werden. Dann wäre es schon von Vorteil, einen Bauern mit gefülltem Speicher in der Familie zu haben. So kam es, dass die Brautwerber bald ihres Amtes walteten.
Emma und Karl
Emma, Utas zweite Tochter, wurde mit Karl Mannich, dem ältesten Sohn eines Chemnitzer Tuchhändlers verheiratet, der hauptsächlich die Kundschaft in der Hauptstadt Warszawa belieferte. Eine für beide Seiten vorteilhafte Wahl, denn mit Emma, die sich schon als Mädchen mehr für den Verkauf auf dem Markt von Piotrków Trybunalski und Geldangelegenheiten als für die Hausarbeit interessierte, bekam das Handelshaus eine äußerst geschäftstüchtige Schwiegertochter. In diesen Zeiten des Mangels bot es sich regelrecht an, der hauptstädtischen Kundschaft nicht nur Stoffe, sondern auch Lebensmittel zu verkaufen. Reiche Städter zahlten selbst für gewöhnliches Obst und Gemüse beinahe Wucherpreise. Dazu veranlasste sie die Angst, ihren Körper durch Hunger zu schwächen und somit anfälliger für Seuchen zu werden. Mindestens einmal pro Woche lieferte der Schlüterhof eine beträchtliche Menge an Rauch- und Pökelfleisch, Eiern, Butter, ausgelassenem Fett, Trockenobst, Weizenmehl und Honig nach Warszawa. Der Bedarf war so groß, dass Emmas Mutter Uta von der Nachbarschaft zukaufte. Schon nach wenigen Fahrten brachten die Lebensmittel mehr ein als der Verkauf von Tuch. Überdies fanden gegerbte Felle, Filze und Schafwolle reißenden Absatz. Bei diesem Erfolg war es kein Wunder, dass bereits im späten Frühjahr die nächste Ehe vereinbart wurde: Ein Vetter Karls heiratete ein Meißner Mädchen.
Tuchhändler Karl und sein Vetter erhandelten bereits im ersten Winter einen solchen Gewinn, dass Uta und auch die Meißner Familie Domänenland zukaufen konnten. Außerdem kaufte Uta noch einen Hektar polnischen Landes und zwei Hektar eines in finanzielle Schwierigkeiten geratenen Gemeindemitgliedes. Diese Landkäufe führten zu erheblichen Unstimmigkeiten innerhalb der Gemeinde. Hauptstreitpunkt war die vor Jahren beschlossene Gemeindeabgabe, eine Art Zehnten, der zur Finanzierung gemeinschaftlicher Bauvorhaben und zur Bezahlung des Lehrers diente. Bisher herrschte Abgabengleichheit, besaß doch kein Hof mehr als die anfangs übereignete Fläche. Damals hatte man außerdem vereinbart, Einnahmen aus dem Verkauf von Lebensmitteln und Heimwerk, wie gesponnene Wolle, nicht auf den Zehnten anzurechnen. Es sollte jeder selbst entscheiden können, ob er genügsam lebt und viel verkauft oder die eigene Tafel krachen lässt.
Nach anfänglichem Protest fügten sich der Schlüterhof und der Meißner Hof dem Verlangen der Mehrheit nach Neuberechnung. Jedoch unter der Bedingung, dass das Stimmrecht der Höhe des erbrachten Zehnten entspricht.
Als Utas Mann Martin 1716 an Wundfieber starb, bestach sie zwei der drei Dorfältesten, damit ihr Antrag, bis zur Volljährigkeit ihres Sohnes Johann den Hof ohne männliche Vormundschaft führen zu dürfen, bewilligt wurde. Dadurch verhinderte sie, dass Fremde Einsicht in ihre Geschäfte erhielten, sich am schwer erwirtschafteten Vermögen vergriffen oder sogar über die Zukunft ihrer beiden noch unmündigen Kinder bestimmten.
Hoferbe Johann Schlüter
Johann, ihren 1700 geborenen einzigen Sohn, schickte Uta 1718 zur Ausbildung auf ein Gut in die Mark Brandenburg. Ein Viehhändler hatte ihr von neuen Methoden und einer strengen Zucht und Ordnung berichtet, die der spätere preußische König Friedrich Wilhelm I. bereits als Thronfolger auf seinem Gut Wusterhausen exerzierte. Sie war fest überzeugt, dass Johann unter solchen Bedingungen mehr lernt als im lebensfrohen Sachsen. Ebenso berechtigt schien ihr auch die Hoffnung, dass Johanns Glaube im Preußischen eher gefestigt als angefochten wird. Zudem ging es den Menschen in Preußen besser, denn ihr König hatte sich nicht am Krieg gegen die Schweden beteiligt.
Fünf Jahre später kam Johann, samt Frau und zwei Kindern, zurück auf den elterlichen Hof. Er hatte sich mit Sofie, einer Tochter des Stallmeisters vom Wusterhausener Gut, vermählt. Zur allgemeinen Verwunderung akzeptierte Uta den Eigensinn ihres Sohnes. Mehr noch, sie unterwies ihre Schwiegertochter nicht nur in der Führung des großen Anwesens, sie gab ihr auch eine des Lesens und Schreibens kundige Polin zur Seite, damit sie sich die fremde Sprache schnellstens aneignet. Der Grund für dieses Handeln: Die letzten Jahre hatten sie viel Kraft gekostet, und sie sehnte sich nach etwas Ruhe. Sie träumte davon, sich ab und zu auf die Gartenbank zu setzen, dem Gesang der Vögel zu lauschen, sich an der Blumenpracht zu erfreuen und den Enkeltöchtern beim Spielen zuzusehen. Kurzum, sich nicht mehr um jede Kleinigkeit kümmern zu müssen. Dann könnte sie sich auch ihren sehnlichsten Wunsch erfüllen und ihre Tochter Martha in Berlin besuchen.
Utas Reise nach Berlin
Die Zeit war günstig, der Frieden hielt schon etliche Jahre. Die Postkutschen fuhren regelmäßig, und der Postmeister versicherte, Überfälle gäbe es kaum noch. Und wenn, davor hatte Uta keine Angst. Sie hatte sich gut vorbereitet, einen Schinken und Räucherwurst eingepackt, denn auch Räuber müssen essen. Nach einem solchen Fund würde keiner von ihnen vermuten, dass in den Unterröcken der einfach gekleideten alten Bäuerin etliche Goldtaler steckten.
Die große Stadt gefiel ihr, vor allem die vielen Gotteshäuser und die Glaubensfreiheit. Die eingewanderten Hugenotten bauten Kirchen und die Juden errichteten eine neue Synagoge. Selbst den wenigen Katholiken wurde die öffentliche Ausübung ihres Glaubens gestattet. Ganz anders in Polen, da hatte man den Lutheranern erst vor kurzem verboten, sogar in der Abgeschiedenheit ihrer Höfe, Gottesdienste abzuhalten. Nur in Warszawa und Kraków gab es noch evangelische Kirchen. Hier wagte man nicht, allzu hart gegen die Evangelischen vorzugehen, zu diesen Gemeinden gehörten zu viele angesehene Bürger.
Außer der Glaubensfreiheit fand Uta jedoch nichts, was ihr wert schien, hier leben zu wollen. Die Zeit mit Müßiggang zu verbringen empfand sie als Sünde. Sie kam immer weniger damit zurecht, den ganzen Tag über nur Kutsche zu fahren, ein winziges Hündchen durch den Park zu führen oder im Salon zu sitzen. Am allermeisten irritierte sie die städtische Angewohnheit, bis weit in den Vormittag hinein im Bett zu liegen und sich sogar das Frühstück ins Schafzimmer bringen zu lassen.
Bereits am vierten Morgen frühstückte Uta kurz nach Sonnenaufgang mit den Bediensteten in der Küche. Danach ging sie spazieren, genoss die morgendliche Frische und die Ruhe. Zum Glück dauerte es gut vier Wochen, ehe Martha von Utas Morgengestaltung in Kenntnis gesetzt wurde. Es erboste sie über alle Maßen, dass sich ihre Mutter zu den Bediensteten an den Küchentisch setzte und mit ihnen frühstückte. Das Ganze endete in einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter, in der jede die bisher eingehaltene Rücksichtnahme ablegte.
Uta ärgerte es, dass sich Martha nur noch für französischen Modeschnickschnack interessierte oder stundenlang Kartenreihen aneinander legte. Die Karten waren ihr manchmal sogar wichtiger als der gemeinsame Kirchgang. Und dann waren noch diese ungeheure Verschwendung und Protzerei. Dabei hatte der preußische König Friedrich Wilhelm I. seinen Untertanen Einfachheit und Sparsamkeit verordnet, damit das Land das zu seiner Sicherheit erforderliche Heer ordentlich ausrüsten und vorhalten kann. Laut gespottet und geschimpft wurde nur hinter verschlossenen Türen in Gesellschaft Gleichgesinnter. In der Öffentlichkeit hielten sich die Untertanen seiner Majestät an das Sparsamkeitsgebot, denn der König ließ dessen Einhaltung überwachen. Doch wehe, seine Spione ergriffen einen oder eine dieser Modesüchtigen! Bei der Höhe des Bußgeldes ließ sich Friedrich Wilhelm nicht lumpen. Deshalb wurde der neueste französische Schick nur innerhalb privater Salons zur Schau gestellt. Unterwegs verbarg man die Pracht unter einem weiten grauen Überwurf. Dabei wurde selbst beim Ein- und Aussteigen aus der Kutsche peinlichst darauf geachtet, dass kein Zipfelchen der teuren Eleganz hervorlugte. Die Angst, in aller Öffentlichkeit des Ungehorsams gegenüber dem König überführt zu werden, rechtfertigte diese Vorsicht. Trotzdem trafen sich die Damen mehrmals wöchentlich reihum und führten vor, was man sich aus Paris hatte kommen lassen.
Einzig die Tatsache, dass Marthas Mann Franz den Bau eines Waisenhauses unterstützte, versöhnte Uta ein wenig mit dem ausschweifenden Lebensstil ihrer Tochter. Aber es ärgerte sie, dass sie von den auf Französisch geführten Gesprächen nichts verstand. Sie musste um Übersetzung bitten. Martha wiederum genierte es, dass die Mutter des Französischen nicht mächtig war. In den Augen der Berliner Gesellschaft zeuge dieser Bildungsmangel von niederer Herkunft und schmälere somit ihr eigenes Ansehen. Sie sah deshalb keinen anderen Ausweg, als der Mutter zu raten, sich in Anwesenheit Fremder abseits zu halten und niemanden anzusprechen. Uta hielt sich daran. Sobald Gäste eintrafen, zog sie sich auf ihr Zimmer zurück und kam erst am nächsten Morgen wieder heraus. In ihrem ganzen Leben hatte sich Uta noch nie so erniedrigt gefühlt. Ihre eigene Tochter grenzte sie aus, nur weil sie vor lauter Arbeit kein Französisch gelernt hatte! Warum auch, im Dorf war man nicht so fein, da brauchte niemand diese Sprache, da genügte es vollauf, Deutsch und Polnisch in Wort und Schrift zu beherrschen. Und das Rechnen, um auch das Schulgeld für die Kinder bezahlen zu können.
In Wierzeje beherrschte nur ihr Schwiegersohn Karl, Emmas Mann, das Französische. Das musste er auch, andernfalls hätte man ihn überhaupt nicht in die vornehmen Häuser eintreten lassen. Dabei verschwieg Karl, dass ihm nicht das Französische, sondern sein hübsches Gesicht und die stattliche Gestalt die Türen der Damensalons öffneten. Doch noch mehr als die französische Sprache, eine gute Ware und ein angemessener Preis galt in der gehobenen Gesellschaft eine vollendete Manier. Und die beherrschte Karl Mannig. Kam Karl nach Wierzeje, war es für Kinder und Erwachsene ein riesiger Spaß, führte er die tiefen Verbeugungen und eleganten Hutschwenkungen vor, mit denen er den adeligen Damen seine Ehrerbietung bezeugte. Die dabei von ihm auf Französisch gesprochenen Schmeicheleien klangen in Utas Ohren wie wohltönender Singsang. Es belustigte sie ungemein, einige dieser Formeln zu lernen, um die von Karl begrüßte feine Dame darzustellen. Doch Karl und Emma kamen nur selten zu Besuch, bis dahin hatte sie alles längst wieder vergessen.
Sie dachte an Emma, die die Arbeiten im Kontor überwachte, wenn Karl auf Reisen war. Das fleißige Kind hatte sogar Russisch gelernt, um mit der Kontorei in Nowgorod ohne fremden Übersetzer korrespondieren zu können. Schlimm war nur, dass ihr der Herrgott von fünf Kindern nur die kleine Klara gelassen hatte. Ein zartes, überaus hübsches Mädchen, dem sie ihre ganze großmütterliche Liebe schenkte. Seit Ostern hatte sie die Kleine nicht mehr gesehen. Gleich nach ihrer Rückkehr aus Berlin wird sie Emma bitten, für das Kind einen Hauslehrer zu besorgen, der sie im Französischen unterrichtet.
Johann und Sofie
Uta dachte auch an ihre anderen drei Enkelinnen, die Töchter ihres einzigen Sohnes Johann, die diese Sprache lernen müssten, wenn sie später einem wohlhabenden Mann zur Seite stehen sollen. Wäre Johann zu geizig, würde sie den Lehrer aus ihrer Tasche bezahlen. Es ging ihr durch den Kopf, dass ihre beiden Ältesten Martha und Emma ihren Aufstieg in die bessere städtische Gesellschaft nur schaffen konnten, weil sie besser ausgebildet waren als alle anderen Töchter in der Gemeinde. Um die Ausbildung des kleinen Friedrich, dem lang ersehnten Hoferben, musste sich noch niemand Gedanken machen. Das Kind wird in den vergangenen Wochen ordentlich gewachsen sein und vielleicht sogar ein paar Schrittchen laufen können. Uta sehnte sich nach dem Jungen. Es war sowieso höchste Zeit, nach Hause zu fahren. Auf den Feldern reifte das Getreide und wartete auf die Schnitter. Während der Ernte mussten die Tagelöhner beaufsichtigt und beköstigt werden. Viel Arbeit für die jungen Hofbauern Johann und Sofie, die sich ehrlich freuten, als die Mutter zurückkam. Mit größtem Wohlbehagen atmete Uta den süßen Duft der Sommerblumen, die den Hausgarten mit ihrer Farbenpracht schmückten. Auf dem Küchentisch stand ein Topf mit dampfenden Erdäpfeln. Eben geerntet, die ersten im ganzen Dorf. Johann war ein guter Bauer, er liebte sein Land, und das sah man an den Erträgen. Auch seine Frau Sofie passte hierher, eine Bäuerin durch und durch. Das Besondere zwischen den beiden Frauen war, zwischen ihnen hatte es noch nie ein böses Wort gegeben. Zugegeben, es fiel ihr selber nicht leicht, sich aus Johanns Entscheidungen herauszuhalten, ihm nicht dazwischenzureden, wenn er das ausprobierte, was er an neuem Wissen und ihr unbekannten Methoden aus dem Preußischen mitgebracht hatte. Es gelang nicht alles, doch in der Summe wirtschaftete er mit gutem Gewinn. Allem voran die neuen Schafe, die er aus der Lüneburger Heide hatte kommen lassen. Die großen schwarzköpfigen Tiere brachten viel Fleisch und vermehrten sich prächtig, obwohl sie auf der Heide und den Magerwiesen nur wenig Futter fanden. Und sie lieferten eine besonders feine, langhaarige Wolle, die ihr Schwiegersohn Karl bis in die Webereien nach Slawa verkaufte.
Im letzten Winter, als sich Uta einen schlimmen Husten zuzog, ließ ihr Johann ein dickes schafwollenes Unterbett anfertigen. Damit ging es ihr bald besser und morgens, beim Aufstehen, schmerzten sie auch nicht mehr sämtliche Glieder. Die arbeitsreichen Jahre hatten nicht nur ihren Rücken gekrümmt, die Füße schmerzten bei jedem Schritt und die Finger sahen aus wie verknöcherte Krallen. All das hielt sie jedoch nicht davon ab, tagtäglich als Erste aufzustehen, im Herd Feuer anzuzünden, frisches Wasser aus dem Brunnen zu holen und den Tisch zu decken.
Als Uta 1740, zu Beginn ihres siebzigsten Lebensjahres starb, vererbte sie ihrem Sohn Johann ein großes Anwesen und ein beträchtliches Vermögen. Ihr sehnlichster Wunsch, die Geburt des übernächsten Hoferben noch zu erleben, erfüllte sich nicht. Friedrich, Johanns einziger Sohn, war eben erst konfirmiert worden.
Mit Uta starb die Letzte, die die schweren, aber auch erfolgreichen Anfangsjahre erlebt hatte. Bis kurz vor ihrem Tod erzählte sie den am Bett wachenden Kindern und Enkeln von den ersten Jahren in der Fremde. Ihr Gesicht leuchtete, wenn sie davon sprach, welche Zufriedenheit und Dankbarkeit die kleine Gemeinde damals erfüllten. Allabendlich, vor dem gemeinsamen Essen, wurde eine kurze Andacht gehalten und dem Herrn für seine Güte und Fürsorge gedankt. Damals brachte man die Ernte gemeinsam ein und teilte sie nach der Anzahl der Familienmitglieder auf. Niemand rechnete auf, wer wie viel gearbeitet hatte. Die Erinnerung an das Ende dieser Gemeinsamkeit regte die Sterbende furchtbar auf. Das war während des Schwedenkrieges, als die Truppen Karls XII. 1702 und 1706 nur wenige Meilen am Dorf vorbei marschierten und eine Spur der Verwüstung hinterließen. Damals fand auf dem Markt in Piotrków Trybunalski jeder noch so erbärmliche Gemüsestrunk einen Käufer.
Um noch mehr Geld einzunehmen, sparten alle Familien am eigenen Essen. Einige aber auch an den der christlichen Nächstenliebe geschuldeten Zuwendungen an Notleidende.
Utas Zuhörer staunten, als sie erfuhren, dass diese in der Gemeinde üblichen Essensgaben aus dem Hungerwinter 1699 stammten, dem ersten Winter nach ihrer Ankunft in Polen. Damals hatte man sich darauf geeinigt, dass jeder Hofbesitzer die bei ihm arbeitenden Fronbauern samt ihren Familien im Winter zumindest so beköstigt, dass niemand verhungert. Die zwei Meißner nahmen das wörtlich. Als im Verlauf der nächsten zwei, drei Jahre kaum ein Tagelöhner für die Meißner arbeiten wollte und auch die Fronbauern darum stritten, wer zu den Meißnern muss, forschten die Lommatzscher nach den Gründen. Der Geiz kam ans Licht. Die beiden Meißner gelobten Reue und Besserung. Daraufhin wurde ihnen vergeben. Trotzdem beendete dieser Vorfall das bis dahin selbstlose Füreinander. Die Erinnerung an diese Zerwürfnisse bedrückten Uta, sie schwieg einige Zeit. Aber bald verdrängten Freude und Stolz auf das Erreichte die trüben Gedanken. Was hatte sie alles erlebt! Sie stand sogar ganz dicht vor dem großen König August, zwischen ihr und ihm nur ein Viertelkorb mit Kartoffeln! Damals aß das ganze Dorf von den Speisen der königlichen Tafel. Und wie viel hatten sie und ihre Nachkommen erreicht! Längst hätte sie als wohlhabende Witwe nach Sachsen zurückkehren können. Doch was sollte sie in dem ihr fremd gewordenen Land? Hier kannte sie jeden, und das waren inzwischen, allein im Dorf, über zweihundert Seelen.
Gemeinderat und Glaube
Im Verlauf der Jahre sah man den meisten Höfen den emsig erwirtschafteten Wohlstand an. In den Ställen wuchs die Zahl der Kühe und Schweine, sodass Ställe und Scheunen ständig vergrößert werden mussten. Es wurden aber auch Häuser gebaut, um wenigstens einen zweitgeborenen Sohn mit seiner Familie im Dorf halten zu können. Schließlich konnte dem Hoferben ein Unglück zustoßen. Zudem gab es um das Dorf herum genug freies Land, das die jungen Leute nur zu roden und urbar zu machen brauchten. Mit dieser schweren Arbeit plagte sich jedoch kaum noch ein Sachse herum. Die Bauern besaßen inzwischen genug Geld, um solchen Plack von Tagelöhnern erledigen zu lassen, ebenso die schwersten Arbeiten auf den immer größer werdenden Feldern. Es gab aber auch Familien, denen nichts gelang und in deren Häusern Schmalhans Küchenmeister blieb. Wurde die Not durch ein Unglück oder Krankheit verursacht, half die Gemeinschaft, zumindest eine gewisse Zeit. Handelte es sich jedoch um eine Strafe Gottes, weil ein Familienmitglied gesündigt hatte, durfte diese vom Herrn auferlegte Prüfung nicht durch Hilfen gemildert werden.
Ob man nun unschuldig oder sündig war, entschieden die drei Dorfältesten nach dem Anhören von Zeugen. Zur Aussage berechtigt waren nur Männer, selbst wenn diese den jeweiligen Vorfall nur aus den Erzählungen ihrer Frauen und Töchter kannten. Das führte dazu, dass selbst bekannte Tatsachen vor dem Gemeinderat ungenau oder völlig anders wiedergegeben wurden. Die Folge waren Fehlurteile. Diese Vorgehensweise hatte Uta angeprangert. Sie forderte die Anhörung direkter Zeugen, egal ob Mann oder Frau, wobei diese die Schwurhand auf die Heilige Schrift legen sollten. Mit dieser Forderung berief sie sich auf Martin Luthers Briefe, in denen der Reformator »die Frau dem Manne als Gleiche« beistellte. So manches Gemeindemitglied hatte noch nicht mal in solchen Schriften geblättert, geschweige darin gelesen. Ihnen genügte, den Kindern an langen Winterabenden die bekanntesten Gleichnisse aus dem Neuen Testament vorzulesen. Nun tat oder war man über Utas Behauptung erstaunt. Dass die von den Gemeinderäten vorgegebenen Regeln des Zusammenlebens nicht ganz mit den Grundsätzen des Reformators übereinstimmten, ahnten einige der ärmeren Lutheraner schon länger, schien ihnen die Ahndung von Vergehen nicht immer gerecht zu erfolgen. Bisher hatte jedoch niemand gewagt, dagegen aufzubegehren.
Uta gewann den Streit und gleichzeitig etliche Feinde. Von da an konnte zwar jedes mündige Gemeindemitglied als Zeuge auftreten oder dem Gemeinderat Vorschläge oder Bedenken unterbreiten, doch bei Abstimmungen ergaben sich erstaunlicherweise oft Mehrheiten zugunsten der wohlhabenden Familien. So wurde beschlossen, dass selbst bei einem schweren Verstoß gegen die Gebote nicht mehr die ganze Familie für das Vergehen eines Einzelnen Buße tun muss. Die Familie konnte sich nun sogar von einem Sünder lossagen, ihn aus dem Kreis der Blutsverwandtschaft ausschließen.
Der aufkeimende Besitzdünkel spaltete die Gemeinschaft zusätzlich. So achteten Brauteltern inzwischen mehr auf die Besitzverhältnisse des zukünftigen Schwiegersohnes als auf dessen Glaubensfestigkeit. 1733, im Todesjahr Augusts des Starken, ging es den meisten Lutheranern in Wierzeje so gut, dass sich die von Luther angemahnte Demut in Hochmut und die Dankbarkeit in Selbstgefälligkeit wandelte. So war es nicht verwunderlich, dass die vorgegebene harte Bestrafung von Sünden und Fehlverhalten als veraltet bezeichnet und mehr Milde geübt werden sollte. Einem Dieb schlüge man doch auch nicht mehr die Hand ab, mit der er gestohlen hatte, obwohl dies in der Heiligen Schrift gefordert wurde.
Nun störten sich einige Familienoberhäupter an der Härte, mit der im sechsten Gebot der Ehebruch geahndet wurde. Sie meinten, eine Jungfer, die ihre Keuschheit verlor, sei zwar eine große Sünderin, aber diese Sünde habe nicht die Schwere eines Ehebruchs, denn nur die Ehefrau breche ein Gott gegebenes Versprechen. Deshalb sei es ungerecht, den Verlust der vorehelichen Keuschheit mit gleicher Härte zu bestrafen. Bisher wurden beide, die sündhafte Jungfer und die Ehebrecherin samt ihrem Bankert, aus der Gemeinschaft verstoßen und des Dorfes verwiesen. Mit viel Glück fand die Verstoßene irgendwo eine Anstellung. Eine stillende Mutter wurde jedoch höchst selten in Dienst genommen. Wollte sie nicht im Elend enden, musste sie sich des Kindes entledigen, indem sie es vor einem Kloster oder einem Pfarrhaus ablegte. Solch ein wenige Tage altes Kind überlebte nur, wenn sich eine Stillende des Findlings erbarmte. Klöster bezahlten arme Frauen für diesen Ammendienst. Eine sich lohnende Ausgabe, denn Findelkinder gehörten später dem, der für die Kosten aufkam. Zusätzlich zur Schande verlor die betroffene Familie somit auch Arbeitskräfte, auf die eigentlich kein Bauer verzichten konnte. Deshalb kaufte man, so man es sich leisten konnte, einen verständigen Bräutigam für die gestrauchelte Tochter. Ein gutes Geschäft für den zumeist Zweitgeborenen, kam er dadurch zu einem Hof oder zumindest zu einer gehörigen Summe Geldes. Fand sich kein Bräutigam, wurde die Sünderin möglichst schnell in ein Kloster gebracht. Meist erlitt sie nach ihrer Ankunft eine Fehlgeburt. Wenn nicht, hatte sie nach Ablauf der Zeit eine Totgeburt. So wurde es ihr zumindest gesagt. Mit einem Steckkissen auf dem Arm kam keine dieser Töchter nach Hause zurück. Doch auch das Kloster verlangte eine angemessene Spende. In Familien, die sich weder Bräutigam noch Kloster leisten konnten, »verunglückte« das ach so geliebte Kind im Moor. Nach einem solchen Unglück wurde zwar viel getuschelt, doch jeder hütete sich, seine Vermutung auszusprechen, denn damit fehlte man gegen das achte Gebot »Du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten«. Und wegen unbedachter Worte, deren Wahrheit nicht mehr bewiesen werden konnte, wollte sich niemand versündigen. Dabei war im Grunde jeder froh, dass es nicht die eigene Tochter getroffen hatte.
Ein alter Eiferer und zwei Familien mit hauptsächlich männlichen Nachkommen widersetzten sich der angestrebten Änderung. Die beiden Familien spekulierten darauf, ihre spätgeborenen Söhne auf diese Weise gut zu verheiraten. Es dauerte mehrere Wochen, bis ein zufrieden stellendes Ergebnis verkündet wurde. Wahrer Ehebruch erfuhr weiterhin keine Gnade. Eine ledige Sünderin konnte jedoch mit Milde rechnen. Die Unglückliche durfte samt ihrem Kind im Dorf wohnen bleiben und ihr täglich Brot als Stallmagd erarbeiten. Damit diese Güte gewährt wurde, überprüften die Dorfältesten deren Bußfähigkeit. So mancher Taler landete dann in den Taschen dieser Männer. Doch die Angst vor dem Gang ins Moor saß bei vielen Mädchen so tief, dass sie ihr Leben lang ungern auf den schwankenden Riedwiesen arbeiteten.
Dabei hatte das Moor auch gute Seiten. So diente es in unruhigen Zeiten, und die gab es reichlich, zur sicheren Verwahrung irdischer Güter. In gut getarnten kleinen Hütten und Unterständen versteckten dann die Bauern das Saatgut, einen Teil der Vorräte, Gerätschaften und die Bienenstöcke. Wenn Plünderer ein solches Versteck entdeckten – mit der Beute auf dem Rücken erreichten nur wenige sicheren Boden. Diejenigen, die im Moor zu versinken drohten, warfen zur Erleichterung die geschulterte Last weit von sich. An solchen Stücken klebten oft noch ihre schlammigen Handabdrücke. Die Dörfler nagelten dann ein kleines Querholz ans obere Ende einer langen Stange und trieben diese so weit in den weichen Grund, bis nur noch ein kleines Kreuz aus dem schwarzen Wasser ragte. Nichts wirkte auf Fremde abschreckender und gruseliger als diese kleinen Kreuze und deren Spiegelbilder, die bereits beim leichtesten Schritt erzitterten.
Königspoker
Der nach dem Tod Augusts II. frei gewordene Thron entfachte innerhalb und außerhalb Polens Begehrlichkeiten. Die Kandidaten: Der durch bestochene Wahlmänner und russischer Intervention an erster Stelle stehende August III., Sohn August des Starken und Wunschkandidat der russischen Zarin Anna oder Stanislaus I. Leszczynski, der Favorit Frankreichs. Drei Jahre stritt sich der polnische Adel um die Nachfolge, da wurde der Pole Stanislaus I. Leszczynski von einer kleinen Gruppe frankreichfreundlicher Adliger im Jahre 1734 flugs ein zweites Mal auf den Thron gesetzt. In den zwei Folgejahren verschoben sich die Machtverhältnisse innerhalb des polnischen Adels, und Stanislaus I. Leszczynski konnte sein Leben nur durch die Flucht nach Frankreich retten. 1738, im fünften Jahr dieses Thronfolgekrieges, und angesichts der weiterhin auf polnischem Gebiet stationierten russischen Truppen, übernahm der Sohn August des Starken den polnischen Königsthron. Obwohl sich August III. nur selten in seinem neuen Regentschaftsgebiet aufhielt, beruhigte sich die Lage in Polen. Es blieb auch ruhig, weil das russische Militär nach der Inthronisierung August III. nicht nach Russland zurückkehrte, sondern auf polnischem Gebiet stationiert wurde.
In der Hoffnung auf ein besseres Leben ergoss sich eine regelrechte Flut deutschsprachiger Kolonisten und Siedler über die durch Krieg und Pest entvölkerten Brachen des polnisch-litauischen und preußischen Königreiches. Die meisten Einwanderer waren katholische Schwaben. Es kamen aber auch Lutheraner und Juden. Der Fleiß der Neuankömmlinge zahlte sich aus. Bereits nach wenigen Ernten ging es ihnen besser, als sie es je erhofft hatten. Einige der Spätgeborenen aus der östlich von Piotrków Trybunalski liegenden protestantischen Siedlung Wierzeje zog es gen Norden. In den endlosen Weiten dieses Landstriches zwischen der Ostsee und den Masuren gab es genug leer stehende Höfe, die man kostenlos an Neusiedler vergab. Dazu kam, dass Protestanten im Königreich Preußen willkommen geheißen und freudig in die Gemeinden aufgenommen wurden. Doch 1756, mit Beginn des Siebenjährigen Krieges, mussten nicht nur die Männer zum Militär, auch die Pferde wurden konfisziert und fehlten nun vor Pflug und Wagen. Doch wozu sollten sich die Frauen auch plagen, alles, was auf den Feldern wuchs, wurde requiriert. Zuerst von den Preußen und danach von den Russen. Und weil diesen die Eroberung des reichen Königsbergs missglückt war, plünderten sie auf dem Land jedes Haus und jede Speisekammer. Auch die Höfe der ehemaligen Wierzejer. Damit nicht genug. Auf ihrem Rückzug zerstörten sie die Siedlungen und töteten jeden, der keine russische Uniform trug. Auch Frauen und Kinder. In Wierzeje erfuhr man erst lange nach Kriegsende, wie übel es den ins Preußische Ausgewanderten ergangen war. Hier hatte man Glück. Der Krieg machte nicht nur um das Dorf, sondern um die ganze Region einen Bogen. Trotzdem hatten die Wiezejer, wie beim Ausbruch von Unruhen und Kriegen üblich, das meiste an beweglicher Habe im Moor in Sicherheit gebracht. Und das war nicht wenig, nach zwanzig Jahren Frieden.