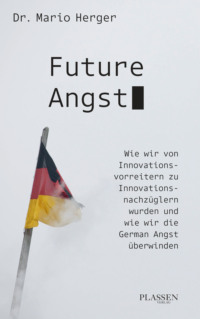Kitabı oku: «Future Angst», sayfa 5
Dinglichkeit der Dinge
Als 17-jähriger Schüler verbrachte ich meine Sommerferien mit zwei jeweils einmonatigen Praktika. Der erste Job war eine Straße weiter von meiner Wohnung bei einem Fotohändler für professionelle Fotografen. Ich hatte die verantwortungsvolle Aufgabe erhalten, das Lager mit Secondhand-Fotoartikeln auszumisten. Man muss sich das so vorstellen, als ob in einem größeren Raum mit Regalreihen ein Elefant durchmarschiert war, einmal trompetete und sich dabei geschüttelt hatte, um befriedigt weiterzuziehen. Was ursprünglich ein Schulungsraum für Fotografen mit Einrichtungen für Studioaufnahmen gewesen war, hatte mit der Zeit und dem Wechsel und Abgang der Verantwortlichen den Charakter einer mehr als chaotischen Anordnung von Regalen und Objekten eingenommen. In knapp zwei Wochen hatte ich das Lager ausgemistet, dabei von großen Ventilatoren, damit die Haare der Models im Wind schön wehten, über antike Kameras bis hin zu einem hochbrennbaren Zellulosenitratfilm mit Aufnahmen einer Wehrmachtparade vor dem Führer einiges an verstaubten Schätzen ausgegraben.
Das waren alles greifbare, dingliche Dinge, noch lange bevor es digitale Kameras gab. Film kam in Rollen, das technologische neueste Must-have bei Kameras für Amateure war der Autofokus gewesen und für mich am aufregendsten waren Infrarotfilme im Kühlschrank, die vor allem bei Profifotografen zum Einsatz kamen. Das verstand ich als 17-jähriger Schüler ohne viel Erfahrung.
Der Kontrast zum zweiten Ferienmonat konnte nicht größer sein, als ich ein paar Straßen weiter in die Bankfiliale trat und dort vier Wochen mit dem Ablegen von Zahlscheinen und der Tageskalkulation ebendieser eher wenig beschäftigt war. Für mich machte allerdings den größten Eindruck in dieser zweitkleinsten Filiale in Wien ein persönliches Gespräch mit der Chefin am zweiten Tag. Diese hatte mich in ihr Büro beordert und eine halbe Stunde von den „Produkten“ und dem Geschäftsmodell der Bank erzählt. Ein Sparbuch, ein Konto oder ein Bankenkredit waren Produkte. Natürlich waren mir diese Dinge ein Begriff. Aber jemandem wie mir, der aus einer Arbeiterfamilie stammt, in der das Leben des Vaters an einer Werkbank statt-fand, waren nicht greifbare und abstrakte Dinge wie eben ein Sparbuch, ein Konto oder ein Kredit nicht als Produkte in den Sinn gekommen.
Abgesehen davon, dass die Finanzwelt für mich persönlich nicht als zukünftiges Berufsfeld interessant genug erschien, hatte ich verstanden, dass Produkte dinglichen und nichtdinglichen Charakter haben konnten. Letztendlich verschlug mich meine berufliche Laufbahn von einem eher dinglichen Studium der Chemie in eine Welt der nichtdinglichen Softwarebranche. 30 Jahre später hat sich dank des Siegeszugs digitaler Technologien die Vielfalt von Nichtdinglichem explosionsartig vermehrt. Nicht nur das: Selbst die scheinbar so dinglichen Produkte kommen ohne Nichtdingliches gar nicht mehr aus. Jede moderne Kamera kann ohne Millionen Zeilen von Softwarecode gar nicht mehr verwendet werden. Jede Ampelanlage und angeschlossene Verkehrssteuerung ist nur durch Software funktionstüchtig. Autos bewegen sich ohne Millionen Zeilen an Software keinen Zentimeter mehr vom Platz. Volkswagen beziffert die Zahl der Programmierzeilen in seinen Autos mit über 100 Millionen.31 Fernseher, Mikrowelle, Telefon, medizinische Geräte, Flugticketbuchung, Flugzeuge, Baumaschinen, Bauzeichner, Zugfahrpläne, Gerichte, ja, selbst Kunst und Kultur sind von technologisch Nichtdinglichem so abhängig geworden, dass ohne dieses die Arbeit nicht oder nur mehr sehr beschränkt möglich wäre.
Gleichzeitig haben diese äußerlich scheinbar wenig veränderten Produkte – Auto, Flugzeug, Kamera – recht wenig mit ihren Vorgängern gemeinsam. Ein Smartphone hat mit einem Wählscheibentelefon so viel gemeinsam wie ein Homo sapiens mit unserem 540 Millionen Jahre alten Vorgänger Saccorhytus coronarius.32
Umso erstaunlicher scheint, wie wenig Wertschätzung Produkten entgegengebracht wird, die nicht greifbar sind. Spiegel-Podcaster Sascha Lobo beantwortet Leserkommentare auf eine seiner Kolumnen, in der er die Rückständigkeit deutscher Unternehmen in der Digitalisierung und bei der Internet- und Mobilfunkinfrastruktur behandelt. Sie führen unbeabsichtigt genau diese gedanklichen Fehler vor.33
„Na und, Facebook ist bald tot, aber die Telekom lebt weiter.“
„Naja, Facebook ist eine digitale Plattform. Die Telekom besitzt Infrastruktur.“
„Falsch gedacht, Herr Lobo. Softwareprodukte stellen letztlich keine echten Werte dar. Zieht man den Stecker, ist alles weg.“
Man bitte den letzten Kommentator, das doch einmal den Leuten bei SAP zu sagen. Deren einziges Produkt ist Software, beschäftigt damit fast 100.000 Mitarbeiter und ist das wertvollste Unternehmen Deutschlands mit einer beinahe doppelt so hohen Marktbewertung wie das zweitwertvollste deutsche Unternehmen Volkswagen. Letzteres kämpfte im Jahr 2020 mit der Auslieferung seines neuen Hoffnungsträgers, dem Elektroauto ID.3, weil die Software nicht funktionierte. Zehntausende Fahrzeuge waren bereits produziert, ohne dass sie ausgeliefert werden konnten.
Wie ist das aber mit der Infrastruktur der Telekom? Lobo weist darauf hin, dass die Digital-Giganten Facebook und Google selbst über riesige Kabelinfrastruktur verfügen. Google beispielsweise besaß bereits im Jahr 2018 über 100.000 Kilometer an Unterseekabeln, Facebook knapp 92.000 Kilometer.34 Damit bricht die Mär vom Unterschied und dem Wert von Unternehmen mit Infrastruktur und solchen mit digitalen Plattformen zusammen. Es wird augenscheinlich, dass Google, Facebook und Co dingliche Infrastruktur und digitale Produkte haben, während die Telekom Infrastruktur, aber kein wirkliches digitales Produkt hat.
Und zieht man wirklich den Stecker, dann ist die Telekom genauso betroffen. Denn was, wenn nicht digitale Produkte, fließt denn durch die Kabel? Ist kein Strom mehr da, helfen der Telekom die ganzen Kabel, durch die nun nichts mehr fließt, nichts.
Wir können solche Kommentare selbstverständlich gerne dem uninformierten Teil unserer Gesellschaft zuschreiben, doch dem ist leider nicht so. Diese Aussagen werden von vielen Vorständen und Vordenkern ebenso unreflektiert kolportiert. Und ich höre von ihnen dann auf Kongressen – und wenn sie ins Silicon Valley auf Besuch kommen.
Der aus Griechenland stammende Biomathematikprofessor am MIT Manolis Kellis meinte zu der Zurückhaltung der Menschen und Unternehmen in Bezug auf digitale Technologien, dass wir Menschen selbst digitale Wesen seien. Unsere Gene seien selbst aus vier Basen zusammengesetzt, die durch einen Kopiermechanismus repliziert werden.35 Statt Nullen und Einsen kommen Adenin, Guanin, Cytosin und Thymin zum Einsatz, aus denen so komplexe Wesen wie wir entstehen. So betrachtet ist digitale Technologie eigentlich sehr natürlich.
Verklagt die Innovatoren!
Woran erkennt man die disruptive Kraft von Unternehmen? An der Anzahl der Klagen, die gegen sie vor Gericht eingebracht werden. Eine disruptive Innovation hinterfragt alte Modelle und stellt den Status quo infrage, sehr zum Leidwesen der Platzhirsche, die es sich in diesem Feld bequem gemacht haben. Beispiele, die einem gleich einfallen, sind Uber, Microsoft, Facebook oder Google. Uber wurde in fast jeder Stadt, in der das Unternehmen seine Dienste anbot, von den lokalen Taxifirmen vor Gericht gezerrt. Microsoft, Facebook und Google wurden vor allem von Regierungen und Behörden angeklagt.
Das sind oft spektakuläre Prozesse und Verfahren, in denen es nicht selten um grundlegende Fragen der Rechtsauslegung geht. Ist Uber ein Taxiunternehmen? Warum wurden die vielen Regulierungen für das Personenbeförderungsgewerbe überhaupt notwendig? Und wie genau ist das mit dem Datenschutz und den Monopolen?
Sehen wir uns die Prozesse und das Vorgehen von Behörden gegen solche Disruptoren an, dann fällt auf, dass vor allem amerikanische Unternehmen, aber keine aus dem deutschsprachigen Raum belangt werden. Sind wir so viel braver? Nicht, wenn wir uns Volkswagen und den Dieselskandal oder Wirecard ansehen. Diese beiden Skandale waren Betrug und haben wenig mit disruptiver Innovation zu tun.
Ziehen wir die Anzahl der Gerichts- und Behördenverfahren gegen disruptive Start-ups als Maßstab für Innovation heran, dann kommt kaum disruptive Innovation aus unseren Breiten. Die Angst, verklagt zu werden, ist auch eine Angst vor der Zukunft.
KAPITEL 3
Past Angst – Goldmine der Absurditäten 
Technologie: neues Zeugs, das nicht immer ganz so gut oder auf mysteriöse und unbekannte Art funktioniert.
Donald A. Norman
Mit dieser augenzwinkernden Definition von Technologie wollte der emeritierte Kognitionswissenschaftler und Usability-Experte Donald A. Norman darauf verweisen, wie Menschen Technologien gegenüberstehen. Etwas, das uns vertraut ist, das wir als selbstverständlich betrachten und gebrauchen, hat diese Mystik nicht nur verloren, sondern wird auch gar nicht als Technologie wahrgenommen. Technologie als etwas künstlich von uns Geschaffenes, das als Ergebnis wissenschaftlicher Erkenntnis eine praktische Anwendung fand, wird Teil des Alltags, ohne dass wir über die Hürden nachdenken, die es zu überwinden galt.
Schuhe würden wir heute eher nicht zu Technologie zählen. Ein Smartphone oder Auto selbstverständlich schon. Doch ich erinnere mich, wie wir im Kindergarten lernen mussten, Schuhe zu binden. Dazu gab es sogar einen Holzrahmen mit Schnürsenkeln, an dem wir übten. Und ich weiß ganz genau, dass ich da kein Naturtalent gewesen bin. Für die ersten Höhlenmenschen, die ein Stückchen Leder an die Fußsohlen pappten, war das ein epochemachender Schritt. Und wie wenig selbstverständlich Schuhe in der Form sind, wie wir sie heute kennen, kenne ich noch aus Erzählungen meiner Urgroßeltern: Einfache russische Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg hatten nur Fußlappen um die Beine gewickelt, statt Socken in ihren Stiefeln zu tragen.
Im Großteil der Menschheitsgeschichte wurden Erfindungen nicht bloß als etwas Widernatürliches, sondern sogar als gotteslästerlich betrachtet. Das findet Widerhall in Sagen und Legenden. Der griechische Titanengott Prometheus, dessen Aufgabe es ist, die Menschen zu beschützen, bringt diesen gegen den Willen von Zeus das Feuer. Zeus’ Strafe ist eines grausamen Diktators würdig: Prometheus wird verbannt, gefesselt und täglich von einem Adler besucht, der seine Leber aus dem Leib reißt und frisst.
Diese Angst davor, den Göttern die Geheimnisse entrissen zu haben oder in den natürlichen und gottgegebenen Kreislauf einzugreifen, diente und dient nach wie vor als Argument gegen den Fortschritt. Das Feuer, der Kompass, Teleskop und Mikroskop, Impfungen, Elektrizität und in moderner Zeit die Angst vor Teilchenbeschleunigern oder einer Maskentragepflicht zu Corona-Zeiten, die von fundamentalistischen Christen als Eingriff gegen das gottgeschaffene „Atmungssystem“ betrachtet wird, zeigen die tiefe Skepsis und Ignoranz – und bringt Menschen dazu, teils irrationale Entscheidungen zu treffen. Neugier damals wie heute hat die Konnotation, gefährlich zu sein. Kostet bloß nicht den Apfel vom Baum der Erkenntnis. Denn das führt zu Bewusstsein und zu Änderungen, die Gefahren anziehen.
Soziale Phasenverschiebungen
In der Geschichte der Menschheit gab es bislang drei sogenannte „soziale Phasenänderungen“. Der Begriff ist aus der Chemie entlehnt. Dort kennen wir beispielsweise Phasenübergänge zwischen fest, flüssig, gasförmig und Plasma. Wasser kann als Eis, als flüssiges Wasser, als Wasserdampf und als Plasma (in der Sonne) vorliegen. Jede Phase unterscheidet sich in ihren Eigenschaften und kann durch die Kombination äußerer Faktoren wie beispielsweise Temperatur und Druck, die auf den Stoff wirken, erzeugt werden.
Ähnliches spielt sich bei Übergängen von einer Phase der Menschheitsentwicklung in die nächste ab. Gewisse äußere Faktoren beeinflussen den Übergang. Die erste Phasenverschiebung war der Übergang von einer Gesellschaft aus Jägern und Sammlern zu einer sesshaften Agrarkultur. Was sich vordringlich änderte, war, was wir wann als Nahrungsmittel konsumierten. Was sich in zweiter Linie änderte, war die Notwendigkeit, Techniken zu entwickeln, um Landwirtschaft zu betreiben, Grundstücke abzugrenzen, Gesetze zu erstellen, Tiere zu domestizieren, um sie als Transport- und Arbeitstiere einzusetzen und zum Verzehr zu halten. Die Landwirtschaft erlaubte auch die Entstehung größerer Verbände, als es für Nomaden praktisch gewesen wäre, und zwar in Form von Städten. Arbeitsteilung wurde ein weiteres Element in dieser Phase, was wiederum zu Hierarchieunterschieden führte sowie zur Einführung von Geld, Schrift und Militär.
Der zweite Phasenübergang kam mit der industriellen Revolution, die durch unsere Fähigkeit, Energie in bis dato nicht möglichem Ausmaß auszuschöpfen, geprägt war. Von Menschen, Tieren, Wasser- und Windkraft als Energiequellen gingen wir dazu über, Energie aus Kohle mittels Dampf und Elektrizität und in späterer Zeit aus dem Atom oder der Solarenergie zu nutzen. Damit steigerten wir die Produktion und es kam zu einer Abwanderung vom Land in die Städte und Fabriken. Das führte in der ersten Zeit nicht zu einer Erhöhung des Lebensstandards für alle Menschen, sondern zwang viele von einem natürlichen Lebensrhythmus zu einem, der von Maschinen vorgegeben wurde. Und damit brachte es Armut für diejenigen, die sich nicht anpassen konnten oder wollten. Langfristig führten diese Änderungen zu einem steigenden Wohlstand für alle, der auch durch notwendige Änderungen der Fertigkeiten der Menschen ermöglicht wurde. Die Schulpflicht führte die breite Masse der Bevölkerung zu Schreib- und Lesefähigkeit, was wiederum neue Möglichkeiten bot.
Der dritte Phasenübergang, in dem wir uns aktuell befinden, ist der hin zu einer autonomen Zivilisation.1 Im Vergleich zu den vergangenen zwei Phasenübergängen sind die Treiber nichtdinglich, also nichtgreifbar. Es handelt sich dabei um Intelligenz, die wir auf Maschinen verlagern, um Information, die wir durch Maschinen erfassen und verarbeiten lassen, und um Zeit, die wir vorwiegend von der realen in den virtuellen Raum verlegen. Indem wir uns mit dem Fernseher, dem Computer oder dem Smartphone beschäftigen, verbringen wir mehr und mehr unserer Zeit in einem virtuellen Raum. Milliarden von Maschinen und Sensoren erfassen und vermessen die Welt und ergänzen unsere Sinne um zusätzliche Daten. Mit künstlicher Intelligenz erweitern wir den uns zugänglichen und nutzbaren Intelligenzraum.
Jeder Phasenübergang weist unterschiedliche Eigenschaften auf und kann zu problematischen Ergebnissen führen. Wenn Wasser zu Eis gefriert, können Rohre bersten. Verdampfendes Wasser kann zu Verbrühungen führen. Werden die Phasenübergänge richtig kontrolliert und eingesetzt, führen sie zu vorteilhaften Resultaten. Dampf wird zum Antrieb von Dampfmaschinen verwendet und Eis schützt Nahrungsmitteln vor dem Verderben.
Je nachdem, wie die Menschen diese Phasenübergänge erfahren oder vorhersehen, tendieren sie entweder zu einer skeptischen oder optimistischen Sicht der Entwicklung. Aus der Gnade der Spätgeborenen heraus erscheinen uns die ersten beiden Phasenübergänge von den Jägern und Sammlern zur Landwirtschaft und von einer Agrarwirtschaft zu einer industrialisierten Zivilisation als positiv, weil wir von den positiven Auswirkungen profitiert haben. Die negativen Auswirkungen von arbeitslos gewordenen Webern und Kinderarbeit in Fabriken und den damit einhergehenden sozialen Unruhen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts oder die Mangelernährung der ersten Agrarkulturen kennen wir nicht aus eigener Erfahrung, sondern nur aus den Geschichtsbüchern.
Das führt zu dem Paradox, dass wir meinen, unsere Zeit stehe vor den größten Umwälzungen der Menschheitsgeschichte und würde uns einerseits die schrecklichsten Auswirkungen, andererseits die glänzendste Zukunft bringen. Dystopie hier, Paradies da. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt, dass dem nicht so ist. Weder kam es zu einem Zusammenbruch der Zivilisation noch führte sie uns in ein uneingeschränktes Paradies. Auf den nächsten Seiten möchte ich von einigen dieser vergangenen Ängste und Hoffnungen anhand von ausgewählten Erfindungen – die uns heute selbstverständlich und wenig kontrovers erscheinen – berichten. Wir werden somit sehen, dass die Ängste und Hoffnungen, die Argumente für und wider vorhersehbaren Mustern folgen und unsere Diskussionen sich heute nicht von denen unserer Vorfahren unterscheiden.
Die gute alte Zeit
Das ist es, was die Gegenwart ausmacht. Es ist ein bisschen unbefriedigend, weil das Leben unbefriedigend ist.
Gil Pender
Was macht man als erfolgreicher Drehbuchautor, um sich beruflich weiterzuentwickeln? Diese Frage stellte sich der Amerikaner Gil Pender und beschloss, sich in ein anderes literarisches Fach zu bewegen und einen Roman zu schreiben. Als Vorbild hatte er sich die 1920er-Jahre genommen, die er bewunderte. Er bedauerte, sie nicht selbst erlebt zu haben. Als ihn bei einem Aufenthalt in Paris spätabends ein Oldtimer mitnimmt, findet er sich in einer Gesellschaft wieder, die eine Kostümparty zu feiern scheint. Alle Teilnehmer sind in Mode der 1920er-Jahre gekleidet. Gil realisiert, dass die Personen auf der Party keine Geringeren als F. Scott Fitzgerald, Jean Cocteau, Josephine Baker und andere längst verstorbene Berühmtheiten sind.
Gil ist – wie meine filmhistorisch gebildeten Leser sicherlich rasch erkannt haben – der fiktive Charakter, den Owen Wilson in Woody Allens Film „Midnight in Paris“ aus dem Jahr 2011 spielt.2 Der Oldtimer, den Gil bestiegen hatte, hatte ihn in einer Zeitreise in diese Epoche zurückgebracht. Gil ist, wie leicht verständlich, völlig hingerissen und kann sein Glück nicht fassen. Er lernt Picassos Geliebte Adriana – gespielt von Marion Cotillard – kennen, die von ihrer Epoche gelangweilt ist. Sie träumt von der „Belle Époque“, in der sie gerne Maler wie Henri de Toulouse-Lautrec oder Edgar Degas kennengelernt hätte.
Am selben Straßenrand, an dem Gil von dem Oldtimer aufgegabelt und in die Zeit zurückversetzt worden war, wartet eine Kutsche, die sie in die – wie nun leicht zu erraten ist – Belle Époque bringt. Dort allerdings erfahren Adriana und Gil, dass die angebeteten Helden wiederum einer anderen Epoche, nämlich der Renaissance, nachweinen und ihre eigene erbärmlich langweilig finden.
Die Moral der Geschichte ist, dass wir diesen nostalgischen Filter der Vergangenheit überstülpen, die das meiste an Schlechtem aus dieser Epoche ausblendet und nur den Glamour durchlässt. Wir trauern einer verklärten Vergangenheit nach, die es so nie gegeben hat. Sie war selten einfacher, sie war zumeist gefährlicher und für die wenigsten Menschen gab es die Möglichkeiten, die vielen von uns heute offenstehen.
Lassen wir uns doch auf ein Gedankenexperiment ein und fragen uns, wann denn die Vergangenheit besser gewesen ist als die heutige? Und dies sollte uns leichtfallen, weil wir gerade in den Nachwehen der Covid-19-Pandemie stecken, also somit in einer Periode, die sicherlich kein Spaß ist. Vielleicht springen wir doch einfach einmal 100 Jahre zurück und landen zu Beginn der Goldenen Zwanzigerjahre.
Im Jahr 1920 befinden wir uns gerade in den Nachwehen einer noch größeren Pandemie, die 500 Millionen Menschen erfasst und geschätzte 50 Millionen Menschen dahingerafft hatte. Ein Impfstoff für die damals grassierende Spanische Grippe ist selbst 100 Jahre später nicht gefunden. Und das ist eine Epoche, in der wir jeden Tag auf den Straßen Kriegsinvaliden sehen. Menschen, die im Ersten Weltkrieg ein Bein, Auge, einen Unterkiefer, Arm und mehr verloren haben oder durch den Shell Shock – neumodern PTBS – unter Kriegstraumata litten. Ganz zu schweigen von den kriegsbedingt mangelernährten Menschen und dem Überschuss an Frauen, die wegen der vielen gefallenen Männern keine Familie gründen konnten. Dazu die große Änderung, die den Übergang von einer Monarchie in eine Demokratie gebracht hatte. Und die Wirtschaft, die von Rüstungsgütern auf zivile Produkte umstellen will, findet keine Abnehmer. Deutschland und Österreich ächzen unter den Kriegsreparationen an die Gewinner und Österreich sieht sich als den Rest, der von der Monarchie übriggeblieben ist, und als nicht lebensfähig.
Was ist, wenn wir großzügig den Zweiten Weltkrieg, der ganz sicher – auch nostalgisch verklärt – nichts Gutes an sich gehabt hatte, überspringen und 50 Jahre vorausgehen? im Jahr 1970 befinden wir uns in den Nachwehen der Studentenproteste, die USA sich mitten im Vietnamkrieg, nukleare Abrüstung wird durch die Friedensbewegung zu einem Thema und in Deutschland beginnt der RAF-Terror, der das Land mehrere Jahre in Atem hält. Knapp zwei Jahre später wird es zu einem Terroranschlag bei den Olympischen Spielen in München kommen und im Jahr 1973 der Ölpreisschock die Wirtschaft treffen. Im Jahr 1975 gibt es eine Geiselnahme von OPEC-Ministern in Wien durch den venezolanischen Terroristen Ilich Ramírez Sánchez, besser bekannt als Carlos, der Schakal.
Auf der positiven Seite lassen die Mondlandungen die Menschen von einer Zukunft im All träumen. Dieser Traum erfährt aber mit dem Explosionsdrama am Bord der siebten Mission Apollo 13 einen Dämpfer. Klar, die Tapeten von damals waren psychedelisch und Schlaghosen und lange Haare waren in, aber das war nicht unbedingt etwas, womit wir auf Dauer leben möchten. Und die Erfindung der Antibabypille hatte eine Neuverhandlung im gesellschaftlichen Umgang zwischen Männern und Frauen gebracht, die nach wie vor zu Spannungen führt. Und bevor ich es vergesse: Das Internet gab es auch noch nicht, dafür aber LSD und eine ganze Reihe neuer Rauschmittel.
Die 1970er sind also auch nicht ganz so toll, wie unsere Erinnerungen es uns weismachen wollen. Für mich allerdings schon, denn ich wurde im Jahr 1971 geboren. Wir wäre es mit 100 Jahren davor, mit dem Jahr 1870? Da war Deutschland noch in kleine Herzogtümer aufgeteilt und sollte den deutsch-französischen Krieg von 1870 bis 1871 nutzen, um mit dem Deutschen Bund zum ersten Mal ein vereinigtes Reich deutschsprachiger Staaten zu gründen. Die von den Franzosen abgepressten Reparationszahlungen führen zur Gründerzeit in Deutschland, langfristig aber zu weiteren, noch blutigeren Konflikten mit dem Nachbarn.
Transportmittel der Wahl waren nach wie vor das Pferd und die Kutsche, auch wenn die Eisenbahn und die Dampfmaschine einen rapiden Wandel losgetreten hatten. Damit gewann die industrielle Revolution an Geschwindigkeit, die eine Migration vom Land in die Städte zur Folge hatte. Viele Städte vervielfachten ihre Bevölkerungszahlen in nur wenigen Jahrzehnten und die Lebensbedingungen in den überforderten Städten unterschieden sich nicht viel vom Mittelalter. Erst zu diesem Zeitpunkt sollten die Stadtväter fundamental den Charakter ihrer Städte zu ändern beginnen.
Auch war man lieber nicht eine Frau, die vor der Entbindung stand. Die Theorien zu Viren und der Übertragung von Krankheiten befanden sich erst im Entstehen – und damit auch das Verständnis, wie wichtig Hygiene für die Gesundheit ist. Einige Ärzte wie Ignaz Semmelweis hatten erkannt, dass von Ärzten, die aus der Pathologie kamen, offenbar Krankheiten an entbindende Frauen weitergegeben wurden, sodass diese im Kindbett verstarben. Impfungen waren bereits bekannt, wurden allerdings noch mit Misstrauen beäugt.
Egal, welches Jahrzehnt in der Vergangenheit wir wählen und welches Jahrhundert oder sogar Jahrtausend wir betrachten, wenn wir – um den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama zu zitieren – uns auszusuchen hätten, wann wir geboren sein wollen, aber keinen Einfluss darauf hätten, ob als Mann oder Frau, in welchem Stand und in welches Land, wir würden mit hoher Wahrscheinlichkeit die heutige Zeit wählen. Und sollten wir doch – wider besseren Wissens – den Knopf für eine andere Epoche drücken, wir würden sehr bald unsere Entscheidung auf das Bitterste bereuen. Auch Gil Pender akzeptierte nach seinen Pariser Zeitreisen seine eigene Epoche als das, was sie ist: brutal wirklich, noch nicht nostalgisch verklärt und die beste aller Zeiten, die er noch beeinflussen und mitgestalten konnte.