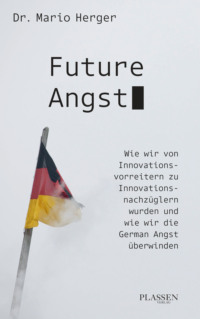Kitabı oku: «Future Angst», sayfa 6
Innovationen der Vergangenheit und damalige Reaktionen
Wie die Geburten der Lebewesen zunächst unförmig sind, so sind alle Neuerungen, die die Geburten der Zeit sind.
Sir Francis Bacon
Anfang des 20. Jahrhunderts hatte der japanische Schriftsteller Tanizaki Jun’ichirō ein kleines Pamphlet verfasst, in dem er auf die japanische Ästhetik einging und seine Meinung in einer recht ungeordneten Weise kundtat. Gerade dieser in Japan geschätzte Stil einer nonchalanten literarischen „Unstruktur“ fand bei seiner Leserschaft Anklang. Tanizaki reflektierte in „Lob des Schattens“ über das langsame Verschwinden des japanischen Stils durch die seit Mitte des 19. Jahrhunderts begonnene Öffnung des Landes zum Westen hin. Für ihn war besonders der Verlust der Bauweise und der Innengestaltung japanischer Häuser beklagenswert. Er schildert seine Versuche, trotz moderner Glasfenster seinem Haus den Anschein traditioneller verkleideter Papieröffnungen zu geben – und scheitert kläglich, da er weder den japanischen noch den modernen westlichen Effekt erreicht. Auch lässt sich Tanizaki über die beste Art aus, wie die elektrischen Leitungen am wenigsten sichtbar einzubauen sind und klagt, dass moderne Glühbirnen nicht den heimeligen Schein alter Öllampen verbreiten. Das Dunkel in traditionellen japanischen Häusern zog er den lichtdurchfluteten neuen Gebäuden vor, weil diese das Geheimnisvolle bewahrten.
Auch wenn er den Lesern immer wieder versichert, dass dies der Lauf der Zeit sei, so ist seine Nostalgie für das verschwindende Alte nicht zu übersehen. Wie auch immer, er schien einen Nerv bei seinen Landsleuten getroffen haben, das Pamphlet erreichte einige Popularität.
Einige Jahre später bestellte Tanizaki einen Architekten zu sich, der ihm ein neues Haus bauen sollte. Der Architekt kam und teilte Tanizaki mit Stolz mit: „Ich habe ihr ‚Lob des Schattens‘ gelesen, Mr. Tanizaki, und ich weiß ganz genau, was Sie möchten.“ Der überrumpelte Tanizaki antwortete: „Aber nein, ich könnte doch nie in solch einem Haus leben!“3
Der Komfort der Gegenwart war selbst dem Nostalgiker Tanizaki wichtiger. Die Retrospektive verklärt, die Prospektive erschreckt. Die nächsten Kapitel bringen eine Reihe von amüsanten und doch nachdenklich machenden Beispielen aus der Zeit unserer Vorväter und -mütter, die vor Neuerungen standen, die sie damals so bewegten wie uns heute künstliche Intelligenz, Selfies oder Roboter.
Sehen wir uns ein paar Innovation aus der Vergangenheit an, die wir heute wie selbstverständlich hinnehmen: den Fahrstuhl, den Mülleimer, die Impfung, den Regenschirm, den Teddybären, das Stethoskop, den Spiegel, Elektrizität und in einem Spezialkapitel die „Krankheiten“, die sie verursachen.
Die Hochzeitsnacht im bewegten Raum
Für deutsche Ingenieure stellten Fahrstühle nicht die Novität dar, wie sie es in den USA Ende des 19. Jahrhunderts waren. Hierzulande wurden die angepriesenen Fahrstühle eher als „Kinderspielzeug“ denn als ingenieurstechnische Herausforderung betrachtet. Schließlich waren Lifte für mehrstöckige Gebäude vergleichsweise langsam und überwanden nur geringe Höhen. In den deutschen Kohlegruben mussten die Seilaufzüge Tausende Meter unter Tage überwinden – und das ziemlich rasant. Schafften die ersten Fahrstühle in Gebäuden eine Geschwindigkeit von 1,5 Metern pro Sekunde, waren es um das Jahr 1890 zwischen drei bis fünf Meter.4
Kein Vergleich zu den mehr als zehnmal so schnellen Grubenliften. Diese durften aber von den Bergleuten selbst nicht benutzt werden, sondern waren ausschließlich für den Materialtransport zugelassen. Zu häufig rissen die Seile, obwohl sie regelmäßig genauestens inspiziert wurden. Diese Seilrisse in Ländern mit vielen Kohlengruben riefen andere Ängste hervor als in den USA, wo es mit Ausnahme des Gold Rushs ab dem Jahr 1849 keine historisch lange kollektive Erinnerung an Grubenunglücke dieser Art gegeben hatte. Erst die Verwendung von Stahlseilen ab Mitte des 19. Jahrhunderts rief auch bei den Bergleuten keine Angst vor Seilrissen mehr hervor.
Deutschland zählte zu den Aufzugpionieren. So hatte der aus Jena stammende Mathematiker Erhard Weigel in seinem im Jahr 1670 errichteten siebenstöckigen Haus eine Besonderheit eingebaut. Es handelte sich um einen mit Flaschenzügen betriebenen Aufzug. Apropos Flaschen: Die brauchte man in diesem Haus nicht, er hatte sich nämlich auch eine Weinleitung direkt aus dem Keller legen lassen.
Auch die österreichische Kaiserin Maria Theresia, die von 1740 bis 1780 regierte und in ihrer Regierungszeit nicht nur 16 Kinder gebar und Kriege führte, sondern auch bei Mahlzeiten immer kräftig zugeschlagen hatte, war in ihren letzten Lebensjahren bereits durch Krankheiten so geschwächt, dass sie die Stufen der Wiener Kapuzinergruft, in der die Habsburger Kaiser begraben liegen, nicht mehr bewältigen konnte. Für sie ließ man einen kleinen Lift einbauen, der es ihr ermöglichte, in der Krypta ihrer Eltern zu beten.
Um das Jahr 1850 wurden die ersten Lifte in den USA eingebaut, um das Jahr 1870 waren alle größeren Hotels an der Ostküste mit solchen ausgestattet, und um das Jahr 1890 gehörten sie fast schon zur baulichen Standardausrüstung. Dabei veränderten sie nicht nur die Bauweise und Bauhöhe, sondern auch, was als „Beletage“ in einem Gebäude galt. Bis zum Siegeszug des Aufzugs beschränkte sich die Höhe von Gebäuden auf sechs oder sieben Stockwerke, wobei die besten Wohnungen im ersten oder zweiten Stock lagen und die schlechtesten unter dem Dach. Mit dem Aufzug konnten Häuser nicht nur in die Höhe wachsen – und das um einen zentralen Aufzugsschacht, der bei Neubauten dann als Erster errichtet wurde. Auch die besten Wohnungen befanden sich ganz oben, weit weg vom Straßenlärm und Schmutz, mit Zugang zu viel Licht und gutem Ausblick.
Wegen der Angst vor einem Seilriss waren nicht nur die Baubehörden Aufzügen gegenüber skeptisch, auch die Liftbenutzer trauten der Sache nicht über den Weg. Aus Sicherheitsgründen bevorzugte man hydraulische Lifte. Bei dieser Vorrichtung sitzt die Kabine auf hydraulischen Stangen, die sie langsam in die Höhe heben. Die Nachteile dieser Konstruktion sind unter anderem, dass eine entsprechende Vertiefung im Boden für die Stangen ausgehoben werden muss, die Geschwindigkeit der Fahrkabine relativ langsam ist und nur eine geringe Zahl von Stockwerken abgedeckt werden kann.
Tatsächlich war die Angst vor einem Seilriss völlig unbegründet. Es gibt bis vor dem Ersten Weltkrieg nur einen Bericht über einen tödlichen Unfall, bei dem die Kabine abgestürzt war. Und dieser Fahrstuhl war hydraulisch betrieben worden. Im Pariser Grand Hotel starben am 24. Februar 1878 drei Personen, ausgelöst durch technisches Versagen. Ein Gussstück, mit dem die hydraulische Stange unten an der Fahrstuhlkabine befestigt war, war gebrochen. Das Gegengewicht der Kabine hatte diese nun getrennt von der hydraulischen Stange mitsamt dem Hotelverwalter, dem Liftboy und einem Hotelgast unkontrolliert in den letzten Stock befördert. Dort riss beim Zusammenprall mit der oberen Begrenzung die am Kabinendach befindliche Kabelverbindung, woraufhin die Kabine in die Tiefe stürzte und unten zerschmetterte.
Eine größere Gefahr ergab sich nicht durch die Fahrt mit der Kabine selbst, sondern beim Ein- und Aussteigen. Die heute üblichen Schiebetüren waren erst nach dem Zweiten Weltkrieg aufgekommen. Vorher waren es vor allem Gittertüren gewesen, die manuell bedient werden mussten und die Kabine sicherten. Diese Gitter konnten auch dann geöffnet werden, wenn keine Fahrstuhlkabine bereitstand. Das führte dazu, dass immer wieder Menschen in die Tiefe stürzten. So ein Unfall ereignete sich im Warenhaus „Gerngroß“ auf der Mariahilferstraße in Wien, wie die Wiener Zeitung am 15. Mai 1916 zu berichten wusste:5
Der 47-jährige Angestellte Karl Rudolf wollte den Fahrstuhl benützen, um in den zweiten Stock zu fahren. Als der Fahrstuhl zwischen dem zweiten und dritten Stocke schwebte, stürzte Rudolf in die Tiefe des Schachtes und blieb mit schweren Verletzungen tot liegen. Es wird vermutet, daß Rudolf der Meinung war, der Fahrstuhl halte noch im zweiten Stock, während er sich bereits nach dem dritten Stock in Bewegung gesetzt hatte. Rudolf dürfte versucht haben auszusteigen und hierbei in die Tiefe gestürzt sein.
Wenn die Fahrstuhltüren die Benutzer nicht vor dem Absturz schützten, dann töteten sie diese manchmal gleich selbst. So berichtet das Neue Wiener Journal am 13. August 1904 von einem „schrecklichen Unfall“ in Berlin, den Prinz Friedrich Leopold als Augenzeuge miterlebte:6
Ein entsetzlicher Fahrstuhlunfall hat sich heute Nachmittags um 4 Uhr vor den Augen des Prinzen Friedrich Leopold zugetragen. Der Prinz, der bekanntlich in den nächsten Tagen Potsdam verläßt, um nach Ostasien abzureisen, besuchte heute die Firma Tippelskirch & Comp. in der Potsdamerstraße, um eine Reiseausrüstung zu besichtigen. Darauf bestieg der Prinz mit seinem Adjutanten den Fahrstuhl, der vom Wärter in Bewegung gesetzt wurde. Der Wärter macht einen Fehltritt und gerieth mit seinem Körper zwischen den Lift und die eisernen Schienen. Man brachte den Fahrstuhl sofort zum Stehen und alarmirte die Feuerwehr. Es dauerte lange Zeit bevor es gelang, den Unglücklichen aus seiner furchtbaren Lage zu befreien. Bald nach seiner Befreiung starb der Unglückliche unter den Händen der herbeigeholten Aerzte. Erst dann wurde der Prinz und der Adjutant aus dem Fahrstuhl gebracht.
Wenigstens war der Prinz unversehrt geblieben. Erst um das Jahr 1890 herum konnte mittels einer neuen Erfindung – elektrische Kontakte in den Türen und Kabinen – das Problem des unbeabsichtigten Türöffnens gelöst werden.
Weniger offensichtlich, aber doch besorgniserregend waren andere Auswirkungen, die durch diese Technologie hervorgerufen worden waren: die „Aufzugskrankheit“. Im Jahr 1890 wurde dieses Syndrom im Scientific American zum ersten Mal vorgestellt.
Der Aufzug in modernen großen Gebäuden hat nur einen Nachteil, nämlich die Krankheit, die er verursacht, wenn die Kabine plötzlich angehalten wird. Für Menschen mit einer empfindlichen Konstitution ist diese Krankheit oft eine so ernste Angelegenheit, dass der Aufzug für sie ein gefährlicher Segen ist. … Der Stillstand der Aufzugskabine bringt Schwindel im Kopf und manchmal Übelkeit im Magen mit sich. Die inneren Organe wollen in der Kehle aufsteigen.
Ähnliche Beobachtungen wurden schon Jahrzehnte vorher bei der ersten Benutzung von Eisenbahnen beobachtet, bei der manche Fahrgäste an nervösen Irritationen zu leiden begonnen hatten. Selbst wenn die Benutzung von Aufzügen üblich geworden war, so doch vor allem zum Hochfahren. Den Abstieg machte man nach wie vor über das Treppenhaus – bis die ersten forschen „Abenteurer“ den Aufzug auch zum „gefährlichen Runterfahren“ zu benutzen begannen. So schildern in der zweiten Fallstudie in Sigmund Freuds und Josef Breuers „Studien zur Hysterie“ die Autoren von einer plötzlichen neurotischen Episode bei der Patientin „Emmy v. N.“:
Auf Nachfrage erzählt sie, dass sich die Pension, in der die Kinder hier wohnen, im fünften Stock befindet und mit dem Aufzug erreichbar ist. Gestern bat sie die Kinder, den Aufzug auch für die Abfahrt zu benutzen, und wirft sich nun vor, dass der Aufzug nicht ganz zuverlässig sei. […]
Wie auch immer, vier Jahre nach ihrer ersten Erwähnung im Scientific American zitierte die Washington Post einen Arzt aus Chicago mit den Worten:
Die Fälle von Aufzugskrankheit nehmen zu. Sie wird jetzt gut definiert. Ihre Auswirkungen finden sich in einer erhöhten Anzahl von Fällen von Gehirnfieber und gestörtem Nervensystem.
Diese zuversichtliche Bekanntgabe der Ergebnisse des Chicagoer Arzt war offenbar die letzte Erwähnung der Krankheit in amerikanischen Publikationen. Rechtzeitig mit dem Verschwinden dieses Syndroms hatte bereits ein anderes seinen Platz eingenommen – und ist geblieben: Klaustrophobie. Die Angst vor engen geschlossenen Räumen wurde das erste Mal zwischen den Jahren 1870 und 1880 erwähnt, also genau dann, als Aufzüge vermehrt zum Einsatz kamen.
Fahrstühle waren auch der Schauplatz einer Reihe von Begegnungen und Geschichten. Das Buch „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ von Thomas Mann hat den Lift in einem Pariser Grand Hotel als zentralen Schauplatz, in dem Felix Krull als Liftboy arbeitet. Der Film „Abwärts“ aus dem Jahr 1984 handelt von vier Personen, die an einem Freitagabend in einem Frankfurter Bürohochhaus im Aufzug stecken bleiben und während des stundenlangen Wartens ihre Hölle miteinander und durch sich erleben. In vielen Actionfilmen mit von Jackie Chan, Angelina Jolie oder Jason Statham gespielten Helden sind Aufzugskabinen und Liftschächte Orte dramatischer Kämpfe auf engstem und gefährlichem Raum.
Spezielle Herausforderungen stellten Aufzüge für höfische Etikette und Protokolle dar. Zuerst ist da einmal die Frage zu klären, ob man in einem Aufzug den Hut abzunehmen hat oder nicht oder wie eng man zusammensteht. Ist das noch ein öffentlicher oder mehr ein privater Raum? Die ersten Aufzüge waren wie Zimmer eingerichtet, mit einem Sofa, Kandelabern und aufwendigen Glasverzierungen. Delikater war das, wenn wir von Herrschenden sprechen. Die Hochzeit der einzigen Tochter von Kaiser Wilhelm II., Prinzessin Viktoria Luise, im Jahr 1913 war die Quelle großer Sorge. Das beste Hotel in Berlin, das Hotel Adlon am Pariser Platz, sollte 800 hochrangige Gäste aus aller Welt beherbergen. Die Komplikation kam – wie kann es anders sein? – durch den Aufzug und die Attitüden der feinen Herrschaften zustande.
So hatte der Schwager des Kaisers, Herzog Ernst Günther von Schleswig-Holstein, darauf bestanden, mit seiner Gattin im vierten Stock des Hotels untergebracht zu werden. Ein paar Tage vor der Hochzeit mussten der Herzog und die Herzogin aber in das zweite Stockwerk umziehen, weil der russische Zar dem Herzogenpaar einen Höflichkeitsbesuch abstatten wollte und es für den Zaren nicht infrage kam, den Aufzug zu benutzen. Zu viele Fragen waren und sind auch heute noch bei der Aufzugsbenutzung von Herrschenden offen. So war dem russischen Zaren nicht zuzumuten, mehrere Minuten in der Enge der Fahrstuhlkabine mit Adjutanten und anderen auszuharren. Und im zaristischen Hofprotokoll, das noch aus der Zeit Katharina der Großen stammte, fehlten natürlich Vorschriften zur Aufzugsbenutzung. Der russische Präsident Putin verwendet bis heute keinen Aufzug, weil deren Benutzung für die Leibgarde und den Sicherheitsdienst ein zu großes Risiko darstellt.
Doch auch als Schauplatz vergnüglicher und anzüglicher Geschichten dienten Aufzüge schon früh. Die Geschichte eines jungen Brautpaares schien in den Rubriken „Vermischtes“ bei der Boulevardpresse um die Wende des 20. Jahrhunderts besonderen Anklang gefunden zu haben. Sie erschien im Laufe des Jahres in Dutzenden Blättern. Heute würde man sagen, „sie ging viral“. Im Jahr 1909 beispielsweise druckte der Bludenzer Anzeiger dieses „Missgeschick“ aus Berlin ab.7 Ein frisch vermähltes Brautpaar war nach den Feierlichkeiten auf dem Weg in sein neues Zuhause, das über den damals noch unglaublichen Luxus von Nachtbeleuchtung und eines Aufzugs verfügte. Offenbar benutzten die jungen Eheleute den Fahrstuhl das erste Mal, denn der Ehemann stellte sich beim Einsteigen ungeschickt an. Ob wegen des konsumierten Alkohols, der Müdigkeit, des Wunsches nach baldiger Vollziehung der Ehe oder aus all diesen Gründen ist unklar. Jedenfalls ging genau in dem Moment die Nachtbeleuchtung aus, als sich der Fahrstuhl in Bewegung setzte. Sofort tastete der Gatte in der Dunkelheit nach dem Lichtschalter, erwischte aber den Halteknopf. Der Aufzug kam mit einem Ruck zum Stehen, was die junge Gattin heftig erschreckte. Voller Furcht bat sie ihren Mann, doch bitte keinen weiteren Knopf mehr zu drücken. Dieser – gehorsam, wie es nur frische Ehemänner sein können – folgte dem Wunsch seiner weinenden Gemahlin. Beide schliefen im Fahrstuhl ein. Am frühen Morgen entdeckte dann der Pförtner zu seiner Überraschung die beiden fest umschlungen auf dem Fahrstuhlbänkchen und befreite sie aus der misslichen Lage, die sie „in Seligkeit schwebend“ verbracht hatten.
Noch im Jahr 1945 gab es in Manhattan 15.000 Aufzugführer beiderlei Geschlechts, die am 24. September 1945 in Streik traten und damit 1.500 Bürogebäude ohne funktionierende Aufzüge hinterließen. Die Angestellten mussten lange Wege aus den obersten Stockwerken antreten. Solche Streiks richteten großen finanziellen Schaden für die Firmen in diesen Wolkenkratzern an. Noch immer gab es Liftboys und Elevator Girls, obwohl schon damals die Technologie für automatische Lifte vorhanden war. Aber immer noch war die Angst zu groß, in einem defekten Aufzug Hunderte Meter im leeren Schacht nur an einem Seil hängend ohne Liftboy verweilen zu müssen. Dabei hatte der Fachverband der Aufzugsindustrie (Elevator Industry Association) 1952 in einer Studie festgestellt, dass automatische Lifte fünfmal sicherer waren als solche mit Aufzugführer.8
Mitte der 1950er-Jahre wurden nach einigen weiteren Streiks die Bürogebäude schließlich vollständig auf automatische Aufzüge umgerüstet. Heute erschiene uns ein Liftboy als merkwürdig. Doch die Diskussion dürfte uns bekannt vorkommen, nur die Technologie hat sich geändert. Heute führen wir dieselben Diskussionen um die Sicherheit in von Menschen gesteuerten Autos und von autonomen Autos.
Der Präfekt, der dem Abfalleimer seinen Namen gab
Mit dem starken Wachstum der Städte in Europa, hervorgerufen durch die industrielle Revolution und die einsetzende Landflucht, standen die noch zumeist einen sehr dörflichen Charakter ausstrahlenden Städte des frühen 19. Jahrhunderts vor neuen Herausforderungen. Wohnungen mussten errichtet und Stadtmauern abgerissen werden und durchgehend gepflasterte Straßen sollten den Staub und Matsch reduzieren und sie bei jedem Wetter befahr- und begehbar machen. Straßenmobiliar wie Laternen, Sitzbänke, öffentliche Zeit- und Wetteranzeiger oder Urinale kamen als neue städtische Elemente hinzu, die das zivilisierte und hygienische Zusammenleben großer Menschenmassen ermöglichen sollten.
Auch der Abfall und der damit einhergehende Gestank und die Seuchengefahr wurden zu einem Thema. Abfälle wurden einfach auf die Straßen oder in nahe Flüsse gekippt. Pferdekot und dessen Gestank waren in den Straßen der Stadt allgegenwärtig. Die Pferde, die als Arbeitstiere zum Einsatz kamen, lebten im Durchschnitt nicht länger als zwei Jahre. Oft kollabierten sie mitten auf der Straße und wurden dort tagelang liegen gelassen, bis sie ausgetrocknet genug waren, damit man sie fortschaffen konnte.
Eine Lösung musste her. Und die manifestierte sich unter anderem in Mülleimern, die zuerst in jedem Haus, anschließend auf öffentlichen Plätzen und in Straßen aufgestellt wurden.
Unter der Zuständigkeit des französischen Präfekten Eugène Poubelle befand sich im Jahr 1883 auch die Stadt Paris. Um die hygienischen Zustände einer wachsenden Bevölkerung zu verbessern, erließ er im selben Jahr eine Verordnung, wonach jedes Haus über einen „Kehrichtkasten“ für seine Bewohner verfügen musste, in dem der Unrat abgelegt wird. Die Länge und Breite, die Farbe und das Material waren vorgeschrieben sowie, wann der Hauswart diesen vor die Haustür zu stellen hatte. Die Form dieser ersten Pariser Abfalleimer ähnelten einem überdimensionierten, abdeckbaren Blumenkasten mit zwei Tragegriffen an den Seiten, auf denen auch die Straßennummer angebracht war.
Diese an sich sehr lobenswerte Erfindung wurde allerdings– wie sollte es auch anders sein – nicht überall wohlwollend aufgenommen. So berichtet die Zeitung Der Vorarlberger am 22. Februar 1884, knapp zwei Monate nach Inkrafttreten der Verordnung, dass hauptsächlich eine Berufsgruppe gegen diese neue Einrichtung protestierte: die Lumpensammler.9
Vom 16. Jänner ist die Abfuhr des Kehrichtes auf drei weitere Jahre verpachtet und da heißt es in den Artikeln 18 und 19 des Vertrages ausdrücklich: „Die Unternehmer haben das Recht auf die vollständige Überlassung des Kehrichtes und können daher diejenigen gerichtlich verfolgen, welche Bestandteile desselben wegschaffen.“ Dadurch ist das Lumpensammeln thatsächlich unter Strafe gestellt und unmöglich gemacht.
Lumpensammler waren über Jahrhunderte entscheidend für den Buchdruck. Alte Lumpen, die sich zum Tragen nicht mehr eigneten, wurden als Rohstoff für die Papierherstellung verwendet. Damit war dieser Abfall wie auch beispielsweise Pferdekot ein Rohstoff, mit dem sich die Armen ihren Unterhalt verdienen konnten. Und die geschätzten Erlöse der Lumpensammler lagen im Jahr 1883 in Paris bei fast vier Millionen Francs im Jahr.10 Und das hatte ihnen der Präfekt nun per Verordnung weggenommen. Kein Wunder, dass es zu Anschuldigungen kam.
Das Ergötzlichste bei der Sache ist immerhin die Entrüstung der Radikalen über den Präfekten Poubelle, der durch die Verordnung sich eines ungeheuren Amtsmißbrauches schuldig gemacht haben soll.
Auch im deutschsprachigen Raum waren Lumpensammler vielen Verordnungen unterworfen. Egal, ob Schlesien, Preußen, Danzig, Nassau oder Breslau, um nur ein paar der Polizeigesetze oder fürstlichen Verordnungen zu nennen, diese Länder regelten, was Lumpensammler wann und wo an Unrat aufsammeln und verwerten konnten. Auswärtigen Lumpensammlern wurde die Ausübung der Tätigkeit meist unter Androhung von Strafe untersagt. Zahlreiche Polizeiberichte geben Zeugnis von tatsächlichen oder vorgeblichen Übertretungen durch die Lumpensammler. Der Wächter – Polizeianzeiger für Norddeutschland nennt für das Jahr 1852 die Fallzahlen für Preußen:11
19,732 Krämer und Lumpensammler zogen 1852 allein in Preußen umher und 9917 Musikanten machten gewerbeweise in Wirthshäusern Musik.
Eine Zeile weiter in diesem Artikel „Die Lage der Wandergesellen“ versteht man aber auch gleich, wieso Lumpensammler und herumziehendes Volk so stark reguliert wurden und unter Polizeibeobachtung standen.
Mit unglaublicher Schnelligkeit verbreiten diese fahrenden Leute, wie das Mittelalter sie genannt haben würde, Einfälle und Bemerkungen, Nachrichten und geistige Richtungen, welche Censur und Preßpolizei in den Tagesblättern unterdrückt, über ganz Deutschland bis in die kleinste Stadt, bis in das kleinste Dorf; sie sind das für ein Land, was das Männercasino oder der Frauencaffee für die Stadt ist und die Spinnstube für das Dorf war. Wer aber achtet auf sie. Wer geht ihnen nach?
Poubelles Erlass löste als Nebeneffekt dieses „Problem“. Auch wenn sich an der Verordnung zur Einrichtung von „Kehrichtkästen“ und der Auftragsvergabe an ein Privatunternehmen nichts mehr rückgängig machen ließ, die „Rache“ der Lumpensammler an Poubelle war eine andere: Im Jahr 1890 nahm das französische „Große Universalwörterbuch des 19. Jahrhunderts“ von Larousse das Wort „Poubelle“ als Bezeichnung für Mülleimer in sein Register als Eintrag auf. Bis heute heißt „poubelle“ im Französischen Mülleimer.