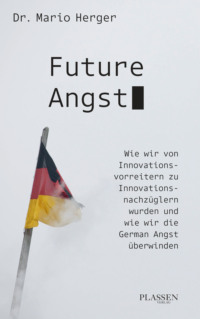Kitabı oku: «Future Angst», sayfa 7
Was Jackie Chan wirklich umhaut
Erinnern wir uns noch an diese Pandemie, die für den besseren Teil von 2020 und 2021 weltweit das Leben und die Wirtschaft über Monate lahmlegte? Genau das passiert, wenn man für eine ansteckende Krankheit keinen Impfstoff hat. Was für uns moderne Menschen Covid-19 ist, waren vor 100 Jahren die Spanische Grippe, Masern, Pocken, Tuberkulose oder Röteln. Für uns stellen diese damals oft tödlichen Krankheiten meist keine direkten Erfahrungen mehr dar, weil wir dafür Impfstoffe, Medikamente und Behandlungsmethoden entwickelt haben. Wir kennen heute in der entwickelten Welt zumeist niemanden, der durch solche Krankheiten entstellt worden war. Anfang des 20. Jahrhunderts waren Menschen, die solche Krankheiten erfahren hatten, im Alltag nicht zu übersehen.
Das führt zu einer Unterschätzung der Gefahren, die von diesen – manche von ihnen verharmlosend „Kinderkrankheiten“ genannten – Viruserkrankungen ausgehen. Und damit überschätzt man die Gefahren, die von Impfungen ausgehen. Funktionierende Maßnahmen, die eine Pandemie und schwere Erkrankungen gar nicht erst ausbrechen lassen, sieht man nicht direkt. Sie zeichnen sich durch ihre Abwesenheit aus. Einzelne Fälle, die unter Millionen von Geimpften durch Impfnebenwirkungen auftreten, finden dann besondere Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, die eine ganz besondere Form an Menschen hervorruft: die Impfgegner. Man glaube bloß nicht, diese seien eine Erscheinung unserer Zeit. Es gibt sie bereits so lange, wie es Impfungen gibt.
Bereits die österreichische Kaiserin Maria Theresia beschäftigte sich mit diesen Krankheiten. Sie selbst steckte sich durch den Kontakt zu ihrer an Blattern (auch als Pocken bekannt) erkrankten und dann daran verstorbenen Schwiegertochter Josepha mit dieser Krankheit an. Ohne Impfung sollte ein Drittel aller an Blattern Erkrankten nicht genesen. Maria Theresia aber gesundete, wenn nun auch durch Pockennarben entstellt. Wegen der Gefährlichkeit dieser Krankheiten, die mehrere Mitglieder der Kaiserfamilie dahingerafft hatten, bemühte sich die Regentin um ein Gegenmittel. Im Jahr 1718 hatte Lady Mary Wortley Montagu als Gattin des britischen Gesandten in der Türkei von der aus Asien stammenden „Inokulation“ gehört, bei der Viren aus den Wunden von an Pocken erkrankten, aber genesenen Menschen in kleine Wundritzen gerieben wurden.12 Vom britischen Königshaus ausgehend hatte sich die Inokulation dann von einem Kaiserhaus zum anderen weitergesprochen, auch wenn das Risiko mit zwei bis drei Prozent Erkrankungen bei den so Inokulierten im Vergleich zu heutigen Standards immer noch vergleichsweise hoch war. Als im Jahr 1796 dann dem englischen Landarzt Edward Jenner der Durchbruch mit Impfungen gelang, bei denen noch weiter abgeschwächte Viren per Injektion verabreicht wurden, begannen die Krankheiten an Schrecken zu verlieren.13 Im Jahr 1807 führte dann Bayern als erstes Land weltweit die Impflicht ein, gefolgt von Hessen und Preußen. Kaiser Wilhelm unterzeichnete im Jahr 1874 das Reichsimpfgesetz.
Der englische Name für Impfungen „vaccinations“ stammt übrigens von der Quelle der ersten Impfstoffe. Es war schon länger bekannt, dass Melkerinnen, die sich mit Kuhpocken angesteckt hatten, nicht an Pocken erkrankten. Die ungefährlichen Kuhpocken dienten dann als Grundlage für den Impfstoff. Der lateinische Name für „von der Kuh“ lautet „vaccinus“, und Jenner wählte „vaccination“ als Bezeichnung für diese Form der Immunisierung.
Doch selbst 100 Jahre nach Einführung der Impfplicht in Bayern blieb der Widerstand groß. Die Wiener Montags-Post veröffentlichte am 4. November 1907 gleich auf der Titelseite einen großen Leitartikel, der unter dem bedrohlichen Titel „Ein ernstes Wort zu rechter Zeit“ für die Impfgegner Partei ergriff. Nachdem eine Blatternepidemie ausgebrochen war, hatte sich der Hohn und Zorn der Abgeordneten im niederösterreichischen Landtag auf die Impfgegner ergossen. Mit dem (anonymen) Leitartikler der Montags-Post war da nicht zu spaßen! So schreibt er dort:14
In diesem Zwecke bediente [die orthodoxe Medizin] sich der Presse, die – im guten Glauben an den angeblichen Segen der Impflanzette – ihr auch diesen Liebesdienst erwies. In der „Wiener Allgemeinen Zeitung“ vom 5. September d. J. wird die aufopferungsvolle Kulturarbeit der Impfgegner, also auch die der zahlreichen impfgegnerischen Ärzte und Professoren als ein „verbrecherisches Treiben“ bezeichnet.
Im Namen der Impfgegnervereine Deutschlands und im Namen von Millionen von Impfgegnern protestieren wir gegen diese groben Beleidigungen der orthodoxen Medizin ganz energisch und weisen alle diese in’s finstere Mittelalter gehörigen Angriffe als unberechtigt zurück.
Fast beleidigt wirkt der Leitartikler, als er das fehlende Interesse an einem Impfgegner-Pamphlet bei den ärztlichen „Impffreunden“ scharf kritisiert:
Auf der Naturforscherversammlung zu Frankfurt vertrat der soeben genannte Professor Hermann seinen neugewonnenen Standpunkt als Impfgegner und bat seine Kollegen, die Ärzte, sein Buch, das er ihnen gratis zur Verfügung stelle, mitzunehmen. Von den 200 Exemplaren, die zur Mitnahme auslagen, war – ein einziges verlangt worden! Beweist denn das aber nicht sehr drastisch, daß die sogenannten Fachleute – hier mit einer einzigen Ausnahme – so viel wie gar kein Interesse an der Klarstellung der Impffrage haben, durch solche Ignoranz allerdings die heilige Pflicht eines ernsten Forschers brutal mit Füßen treten.
Die Schuldigen waren somit nicht nur die Forscher, die ihrer „heiligen Pflicht“ nicht nachkämen, sondern auch noch andere, denen man auch heute das große Geschäft unterstellt, wie man in der folgenden Zeile sieht:
Die Impfung oder wie es in der anderen Sprache sehr bezeichnend heißt, das Impfgeschäft, ist nichts anderes als ein Dogma der medizinischen Hierarchie.
40 Jahre nach einer Kontroverse im Parlament hatte sich nichts geändert, wie es auch 100 Jahre nach dem Erscheinen dieses Artikels immer noch so sein sollte. Die Pharmaindustrie will Geld mit uns machen und drängt uns deshalb Medikamente und Impfstoffe auf. Zum Glück gibt es Ehrenmänner:
Wir erinnern an die Worte des uns allen als Ehrenmann bekannten Dr. med. Hofer, mit denen er vor 40 Jahren das Verhängnis des Impfzwanges von Oesterreich abwandte, an die Worte, die er im Juni 1868 im Wiener Parlamente laut und mutig in die Welt rief: „Ohne physiologische Beweise bleibt mir die Impfung eine Charlatanerie, ohne Physiologie gibt es keine Wissenschaft, und die Impfung ist, ich möchte sagen: ein wissenschaftliches Verbrechen.“
Besonders in Deutschland waren die Impfgegner zahlreich und scheinbar gut organisiert. So berichtet die Wiener Klinische Wochenschrift am 16. April 1896:15
Im 7. Decennium war die Agitation der Impfgegner besonders lebhaft, sie hat aber seither noch wesentlich zugenommen. Im Jahr 1877 betrug die Zahl der von Impfgegnern eingereichten Petitionen nur 21, im Jahre 1891 dagegen 2951 mit 90.661 Unterschriften.
Die Wochenzeitschrift vergisst nicht, auf folgende Tatsache hinzuweisen:
Bemerkenswerth ist, dass die Unterschriften grösstentheils aus den Kreisen ungebildeter oder halbgebildeter Laien stammten, dass dagegen Aerzte nur sehr spärlich darunter vertreten waren.
Gegen Impfungen aufzutreten bot sogar politische Vorteile, wie die Grazer Tagespost am 16. Mai 1876 berichtet:16
Vom Schweizer Anti-Impfverein erhalte ich die Nachricht, daß die Glarner Landgemeinde den Impfzwang beinahe einstimmig abgeschafft habe und daß die anderen Kantone bald nachfolgen dürften. Auch in England haben die Impfgegner bei den letzten Wahlen der Quardians glänzend gesiegt; In Reighley wurden 13 Impfgegner von 15, in Dewsberg 21 Impfgegner von 25 gewählt.
Mehrere Jahrzehnte lang fanden Impfgegnerkongresse statt, der vermutlich letzte seiner Art im Jahr 1914 in Rom, auf dem ein Büchlein mit einem Verzeichnis von ausgewählten Impfgegnern aus ganz Europa zusammengetragen worden war. Gleich 1.171 Namen sind darin aufgeführt – mit der Entschuldigung des Autors, dass er nicht die vollständige Liste mit mehr als 20.000 Mitgliedern hier anführen könne.17
Wie man sieht, stand die Vereinsmeierei der Schweizer, Österreicher und Deutschen schon damals in voller Blüte und ist keine Erfindung unserer Zeit. Und Fake News auch nicht. Keine der drei in dieser Nachricht vom Schweizer Anti-Impfverein genannten Orte existieren in England.
Nur wenige Wochen nach dem Impfgegnerkongress in Rom lagen die Heere der europäischen Länder einander schon in den Schützengräben gegenüber und Impfungen sollten den Zoll, den dieser vier Jahre währende Weltkrieg den Ländern abverlangen sollte, reduzieren. Millionen mehr Soldaten wären an Krankheiten auf den Schlachtfeldern verreckt, hätte es nicht die Impfungen gegeben. Die Spanische Grippe, die am Ende des Krieges sich auszubreiten begann, zeigte, welch verheerende Folgen eine Krankheit haben kann, wenn man keine Impfstoffe dagegen hat.
Aber vielleicht darf man Impfgegnern gar keinen Vorwurf wegen deren Abneigung machen. Es könnten andere Gründe für ihren Widerstand vorliegen, die sie vielleicht gar nicht so gerne an die große Glocke hängen möchten und deshalb andere Gründe vorschieben. Der Schauspieler Jackie Chan, der uns vor allem durch seine todesverachtenden Stunts und seinen Humor in wilden Kung-Fu-Filmen bekannt ist, verliert beim Anblick von Impfnadeln und Spritzen nicht nur seinen Humor, sondern wird sofort ohnmächtig. Ein fünfzehn Meter tiefer Fall vom Uhrturm? Kein Problem. Einen Faustschlag auf die Nase? Gib mir mehr! Eine Impfnadel? Jackie Chan muss wiederbelebt werden.18
Wenn es Müll auf den Regenschirm regnet
Du hast deinen Kopf auch nur, damit es dir nicht in deinen Hals regnet.
Karl Farkas als der „G’scheite“ zu Ernst Waldbrunn als dem „Blöden“ in einer ihrer Simpl Doppelconférencen.
Man stelle sich den Anblick vor, den der Kaufmann und Reiseschriftsteller Jonas Hanway amüsierten Londonern bot. Nach vielen Jahren in Lissabon, Russland und Persien hatte er nach einem Aufenthalt in Frankreich eine neuartige Gerätschaft mitgebracht. Einen „Parapluie“, der in Anlehnung an den fernöstlichen „Parasol“ nicht vor der Sonne, sondern vor Regen schützen sollte.
Der Pariser Kaufmann Jean Marius war ein anerkannter Taschenmacher und hatte bemerkt, wie regnerische Tage seinen adeligen Kundinnen die aufwendig gestalteten Perücken ruinierten.19 Friseure und Perückenmacher galten damals als Künstler und entsprechend hoch waren die Preise, die man für eine Frisur zahlen musste. Zwar gab es bereits erste Regenschirme, diese waren aber so sperrig und schwer, dass sie kaum jemand benutzen wollte oder konnte. Marius verbesserte die Konstruktion und schuf im Jahr 1709 eine leichtgewichtige Version. Dieser weniger als ein Kilogramm schwere Schirm konnte zusammengefaltet, in drei Teile zerlegt und damit bequem getragen werden. Als Luxusartikelhersteller, der die Geschmäcker seiner Pariser Kundinnen kannte, wusste Marius, dass nur ein elegant aussehender Parapluie Anklang finden würde. Er wählte gediegene Materialien und verarbeitete sie kunstvoll und fein, sodass sie zur aktuellen Mode seiner Klientel passten. Diese Gerätschaft war dann auch der letzte Schrei in Paris, mit dem Jean Marius selbst den Sonnenkönig Ludwig XIV. als prominenten Kunden gewinnen konnte.
Die französische Entstehungsgeschichte und der Enthusiasmus der Franzosen mag erklären, warum Jonas Hanway in London ein ziemlich rauer Wind entgegenblies, als er um das Jahr 1750 das Mitbringsel aus Paris zum ersten Mal ausführte. Seine Landsleute machten sich lustig über ihn. Es war den empörten Londonern schnuppe, dass Hanway seinen Parapluie nicht aus reiner Eitelkeit benutzte, sondern um seine Perücke und seine Gesundheit zu schonen. Es half ihm allerdings, dass er ohnehin Exzentriker war und sich keinen Deut um den Spott und Hohn seiner Mitbürger kümmerte. Selbst als ihm wiederholt das für Briten wohl übelste Schimpfwort entgegenschallte, nämlich „Franzose“, ging er unbeirrt mit dem Regenschirm seinen Weg. „Franzose sein“ kam für echte Briten im 18. Jahrhundert einem „Weichei“, „Unterhosenbügler“ und „Hedonisten“ gleich.
Ebenso stand der Regenschirm für einige Moralapostel seiner Zeit als ein Zeichen, dass der Träger eines solchen schlicht und einfach vulgär sei. Entweder könne man sich eine Kutsche oder Sänfte leisten oder man stehe zu seiner Armut, trage seinen Mantel und werde klitschnass. Wo kämen wir in diesem Weltbild hin, wenn sich jemand keine Kutsche leisten könnte, aber im Regen trotzdem trocken bliebe, anstatt sich eine aufrichtige und ehrliche Lungenentzündung zu holen?
Der größte Widerstand dieser „unbritischen“ mobilen Gerätschaft kam von den Kutschern. Wollte man in London trockenen Fußes seiner Wege gehen, kamen nur eine zweirädrige Mietskutsche oder eine Sänfte infrage. Die Kutscher und Träger sahen ihr Geschäft bedroht, das besonders bei feuchtem Wetter anzog. So einfach wollten sie sich ihr Einkommen nicht streitig machen lassen. Wann immer sie Hanway mit seinem Regenschirm ansichtig wurden, überschütteten sie ihn mit Beleidigungen und Müllresten. Ein Kutscher versuchte, ihn sogar zu überfahren, und bekam von Hanway dafür eine Tracht Prügel mit dem vielseitig einsetzbaren Parapluie.20

Abbildung 4: Jonas Hanway (1712 – 1786) im Londoner Regen mit Parapluie. Illustration von Richard Caton Woodville (1825 – 1855)
Warum der Regenschirm ausgerechnet in Großbritannien, wo man doch eigentlich erwarten könnte, dass aufgrund des Klimas eine solche Erfindung mit offenen Armen aufgenommen werden müsste, auf Ablehnung stieß, ist heute nur mehr schwer nachvollziehbar. Nichts sieht für uns heute britischer aus als ein Gentleman mit Melone auf dem Kopf und Schirm unter dem Arm. Jeder Schauspieler mit Baskenmütze und einem Baguette unter dem Arm geklemmt wird sofort als Franzose erkannt. Setzt er eine Melone auf und klemmt sich einen Schirm unter den Arm, ist er Brite. So verankert sind diese Stereotypen für uns, dass wir darüber gar nicht mehr nachdenken. Doch im 18. Jahrhundert sah die Welt anders aus.
Formen des Parasols waren schon mindestens 2.000 Jahre früher in China, im alten Ägypten, bei den Griechen und Römern und auch im Aztekenreich bekannt, um vor Sonne zu schützen. Vor allem adelige Frauen benutzten ihn, um ihre weiße Haut zu bewahren. Als Brite mit dem Selbstverständnis, (bald) einen Großteil des Erdballs zu beherrschen, war das Wetter ein Bestandteil, der die „echten“ Engländer und Schotten erst ausmachte und abhärtete. Die Insellage und das Wetter formten den Körper und den Geist und führten dazu, dass Briten robust, unabhängig und einfach anders waren als andere Völker. Die Verwendung eines Regenschirms bedrohte diese Körper- und Charakterbildung.
Die Regenschirmskeptiker hatten – genauer betrachtet – noch umfassendere Gründe vorzubringen. Von Wind und Wetter umgeben zu sein schien das Natürliche. Alle Anstrengungen, diese vom Körper abzuhalten und ihn vor der Natur zu isolieren, indem man wind- und wetterfeste Kleidung schuf und anzog, ließ die „Luft“ außen vor. Das schien unnatürlich. Selbst damalige Krankenschwestern in Krankenhäusern weigerten sich, Frischluft durch Ventilatoren in die Patientenzimmer zu pumpen, weil die „Kontrolle von Luft“ als blasphemisch galt. Eine gab zu Protokoll, dass sie „die allmächtige Luft bevorzuge, nicht die künstliche“.21 Aufmerksamen Beobachtern fällt dazu sofort der moderne Widerstand konservativer Fanatiker in den USA ein, die Schutzmasken während der Coronakrise mit der Begründung ablehnten, dass das „gottgegebene Atmungssystem“ nicht behindert werden solle.
Nicht nur im regnerischen Britannien stieß der Parapluie auf Ablehnung. Waren die Gründe in London eher geschäftlicher Natur und darüber hinaus der stark im englischen Selbstverständnis verankerten Feindschaft zu den Franzosen geschuldet, so fiel es in anderen Ländern mehr unter die Kategorien „Status“ und „Macht“. Während Ludwig XIV. kein Problem damit hatte, dass sein Hof und seine Untertanen sich das Gerät zunutze machten, war das in Persien ganz anders: Derselbe Jonas Hanway hatte bei einem Vorbeizug eines persischen Prinzen in einer aufwendigen Prozession diesen mit einem Parasol vor der Sonne geschützt gesehen. Hanway, der später zurück in London – trotz all der negativen Erfahrungen mit seinen Mitmenschen – ein Philanthrop werden sollte, erkannte darin früh eine Möglichkeit, den Menschen in Persien Gutes zu tun und so nebenbei ein Geschäft zu machen. Er ließ eine verkleinerte Form des Parasols anfertigen und sie unter das Volk bringen. Mit einem etwas anderen Ausgang, als er sich das erhofft hatte. Ein Parasol war im persischen Reich ein Zeichen von königlichem Status und Macht. Dass nun jeder Standeslose auch so ein Ding besitzen sollte, kam einer Majestätsbeleidigung gleich. So sehr hatte sich Hanway verschätzt, dass er überstürzt Persien verlassen musste, um einer Gefängnisstrafe zu entgehen.
Selbst heute noch kann ein Regenschirm zu politischer Aufregung führen. So echauffierten sich die konservativen Pundits in den USA, als im Jahr 2013 der amerikanische Präsident Barack Obama bei einer Ansprache im Freien sich und seinen Staatsgast, den türkischen Premier Recep Tayyip Erdoğan, von Marinesoldaten durch Regenschirme schützen ließ.22 Das hatte dem Uniformprotokoll der Marinesoldaten widersprochen, die in Uniform keinen Regenschirm benutzen dürfen.
Ausgenommen sind interessanterweise Frauen in Uniform. In den Uniformprotokollen fast aller Armeen der Welt spiegelt sich hier ein nach wie vor gültiges Männlichkeitsverständnis wider und das deutet implizit an, dass Regenschirme unmännlich seien. Oder eben französisch, wie schon Jonas Hanway im Jahr 1750 erfahren musste. Und dabei wollen wir einmal außer Acht lassen, dass Regenschirme von Agenten immer wieder eingesetzt werden – nicht, um sich vor Regen zu schützen, sondern um unerkannt einem Staatsfeind eine Giftmischung durch die Regenschirmspitze zu verabreichen. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wenn Teddybären Nationen bedrohen
Der Teddybär ist eng mit deutscher Wirtschaftsgeschichte verbunden. Margarete Steiff, eine ihr Leben lang an Kinderlähmung leidende Schwäbin, hatte damals für eine Frau – noch dazu für eine behinderte Frau – etwas Ungewöhnliches getan: Sie wurde Unternehmerin und schenkte den Kindern der Welt den Teddybären. Im Jahr 1902 hatte ihr Neffe Richard den ersten Teddybären entwickelt, bereits im Jahr 1907 wurden fast eine Million davon gekauft. Speziell in den USA war das Plüschtier, das seinen Namen dem amerikanischen Präsidenten Theodore „Teddy“ Roosevelt, einem leidenschaftlichen Bärenjäger, verdankte, ein Riesenerfolg.
Die Zeitungen berichteten ausführlich darüber. Eine ganze Seite des The San Francisco Sunday Call vom 18. November 1906 widmete sich reich illustriert dem Teddybärphänomen. Viel öffentliche Aufmerksamkeit erhielt die Omnipräsenz von Teddybären in Kinderhänden. Vor allem überraschen uns aber Berichte, dass Teddybären offenbar bei erwachsenen Frauen der letzte Schrei waren.
Sommerbesucher in einem bestimmten Pariser Hotel waren es gewohnt, ein oder zwei besonders schöne Französinnen mit Teddybären als Begleiter ins Restaurant kommen zu sehen, die an den Seiten der Damen platziert waren, während der einstige Lieblingshund, die französische Bulldogge, mit Fledermausohren oben allein seine Gefühle pflegte. Seine arme kleine Nase – oder was es davon noch gibt – ist ziemlich beleidigt, und er fragt sich, wie lange sein lächerlicher Rivale noch regieren wird.
Auch über eine der neuesten Mode nach elegant gekleidete junge Dame wird berichtet, die von einem Knuddelbären als Kompagnon begleitet wurde, der mit ernster Miene auf dem Beifahrersitz ihres elektrisch angetriebenen Columbia Victoria saß, während sie mit „äußerster Unbekümmertheit“ durch den Central Park in New York preschte.
Das Mädchen sah völlig ahnungslos aus, dass sie irgendetwas Ungewöhnliches oder Erstaunliches tat, als sie an den Scharen von Fußgängern vorbeirollte und sich ihren Weg durch das Gewirr von Fahrzeugen bahnte, die sich in einer langen Prozession bewegten. Sie wurde augenblicklich zum Mittelpunkt für jedes Augenpaar, und der Gedanke, der in den Köpfen derer aufblitzte, für die dieser Anblick eine Neuheit war – hat der Teddybär nun sowohl den Platz des Pudels als auch den der Puppe eingenommen?
Was uns die offizielle Geschichtsschreibung des Steiff’schen Plüschtierimperiums verheimlicht, ist die Kontroverse, die Teddybären in den USA auslösten. So erschien in den Zeitungen des Landes ein Abdruck einer Predigt, die Pfarrer Michael G. Esper am Sonntag, dem 7. Juli 1907 in der katholischen Pfarrei St. Joseph in Michigan gehalten hatte:23
Rassenselbstmord, die größte Gefahr, der sich diese Nation heute gegenübersieht, wird von der Marotte gefördert und ermutigt, die guten alten Puppen unserer Kindheit durch das schreckliche Ungeheuer namens Teddybär zu ersetzen. Die eigentlichen Mutterinstinkte eines heranwachsenden Mädchens werden abgestumpft und oft zerstört, wenn dem Kind erlaubt wird, ein unnatürliches Spielzeug dieser Art mit der liebevollen Zuwendung zu überhäufen, die so schön ist, wenn sie einer Puppe zuteilwird, die ein hilfloses Kind darstellt. Mir bot sich noch nie ein ekelhafterer Anblick als das Schauspiel eines kleinen Mädchens, das diese Pseudo-Tiere streichelt, liebkost und sogar küsst. Es ist eine Schande für das amerikanische Volk, das unter der Verkümmerung des Mutterinstinkts der zukünftigen Frauen leiden wird, durch diesen Ausbund an Abscheulichkeiten, die schädlichste und abstoßendste Naturfälschung, die je begangen wurde.
Diese Predigt wurde in den nächsten Wochen in sämtlichen US-Zeitungen abgedruckt, sie ging viral.
In der Washington Post vom 8. Juli 1907 wurde von einem weiteren Zwischenfall mit einem Teddybären berichtet. Ein vierjähriger Knabe namens Edward N. Hackett war aus einem Fenster im dritten Stock in Brooklyn gekippt und auf eine darunterliegende Markise gefallen. Von der war er abgerollt. Weil er sich dabei die ganze Zeit an seinen Teddybären festgeklammert hatte, hielt er diesen auch noch, als er am Boden ankam. Beim Aufprall bremste das Plüschtier seinen Sturz und der kleine Edward kam unversehrt davon. Während diese gute Teddybärennachricht im Blattinneren versteckt war, befand sich auf der Titelseite derselben Ausgabe aber Espers Predigt unter der Schlagzeile: „Die Teddybär-Modeerscheinung zerstört den mütterlichen Instinkt und führt zum Rassenselbstmord!“ Schon damals galt das Motto „Nur schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten“.
Und das war der Auftakt zu einer großen Kontroverse um die knuddeligen Teddybären, die als so gefährlich angesehen wurden, dass sie eine ganze Zivilisation ins Verderben stürzen können. Nur, woher kam dieser Widerstand?
Dazu muss man wissen, dass Kinder als Miniaturversionen von Erwachsenen betrachtet wurden. Es war selbstverständlich, dass man sie zur Arbeit heranzog und Spielzeug und Kinderbücher einen moralischen und erzieherischen Unterton hatten. Wir bemerken das, wenn wir alte Kinderbücher und Märchen lesen. Alles war darauf ausgelegt, Kinder auf ihre zukünftige Rolle in der Gesellschaft und Arbeitswelt vorzubereiten. Mädchen erhielten Spielzeug, das Fähigkeiten vom Bügeln, Nähen bis zum Aufziehen von Kindern vermittelte. Knaben machten sich mit dem Schießgewehr vertraut. Kinderbücher sollten erwünschte und „richtige“ Verhalten aufzeigen.
Genau deshalb war ein Teddybär so kontrovers. Während Puppen Mädchen auf ihre Rolle als Mutter vorbereiteten – also somit erzieherisch „wertvoll“ waren –, stellten Teddybären ein abstraktes, unnatürliches Wesen dar, das gemäß den Moralaposteln dieser Zeit auf keine gesellschaftlich nützliche Aufgabe vorbereitete. Und die jungen Damen, die in Teddybärenbegleitung Pariser Restaurants besuchten oder einen als Beifahrer in ihren Elektroautos in New York ausführten, bestätigten nur die Befürchtungen. Gebärfähige Frauen, von denen erwartet wurde, dass sie den Fortbestand der Zivilisation sicherten, indem sie endlich heirateten und Kinder gebaren, widmeten sich lieber einem monströsen Plüschtier. Und das kam noch dazu aus Deutschland.
Wir als moderne Menschen sind selbstverständlich darüber erhaben, dank des Fortschritts schmunzeln wir nur mehr über die Rückständigkeit und den Eifer dieser Frömmler. Wer sieht heute noch Teddybären als Gefahr für den Erhalt der Rasse und Symbol des Niedergangs unserer Zivilisation?
Aber die Dämlichkeit der Teletubbies, die Gewaltorgien bei „Tom und Jerry“, die Spinnereien von Pippi Langstrumpf, die einen Aufstand gegen die Erwachsenenwelt macht, Videospiele, die Kinder einsam und gewaltbereit machen, das sind heute selbstverständlich absolut berechtigte Sorgen vor dem Zusammenbruch unserer Zivilisation. Das ist etwas ganz anderes!