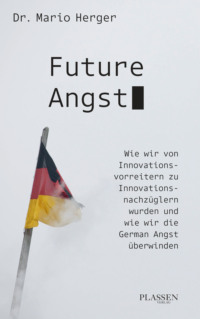Kitabı oku: «Future Angst», sayfa 8
Von Weinfässern, Napoleon und dem Stethoskop
So wie die Melone und der Regenschirm für den Engländer und die Baskenmütze und das Baguette unter dem Arm für den Franzosen stereotypisch sind, ist es für den Arzt der weiße Kittel und das Stethoskop um den Nacken. Dieses heute nicht wegzudenkende und so einfache medizinische Gerät fand nicht von Anfang an Anklang bei der Ärzteschaft.
Selbst der weiße Kittel war bis ins 19. Jahrhundert eigentlich schwarz und üblicherweise völlig verdreckt gewesen. Die Ärzte waren stolz auf das getrocknete Blut, den Eiter und andere Verunreinigungen, die von ihrer Arbeit und ihren Heilkräften zeugten. Erst durch den österreichisch-ungarischen Arzt Ignaz Semmelweis, der erkannt hatte, dass Ärzte, die in einem berüchtigten Wiener Krankenhaus aus der Pathologie kommend zur Geburtenstation wechselten und wegen fehlender Desinfektion zur erhöhten Sterblichkeit bei Gebärenden beitrugen. Verursacht durch den sogenannten Kindbetttod und durch die Entdeckung der Keimtheorie durch Louis Pasteur wurde man sich so langsam bewusst, dass verschmutzte schwarze Kittel ein schlechtes Zeichen für Hygiene waren.
Auf die Idee zum Stethoskop war der französischen Landarzt René Marie Théophile Hyacinthe Laënnec durch den österreichischen Arzt und Librettisten Johann Leopold Auenbrugger gekommen. Letzterer hatte die Perkussion als medizinische Technik zur Untersuchung von Lungenkrankheiten erfunden. Die Inspiration dazu erhielt er aus seiner Kindheit. Der Vater schickte den Grazer Gastwirtssohn immer in den Weinkeller und trug ihm auf, den Füllstand der Weinfässer durch Klopfen auf das Fass zu bestimmen. Daran erinnerte er sich, als er als Arzt in Wien begann, die Brustkörbe seiner Patienten abzuklopfen. Dabei gelang es ihm, die ersten Diagnosen bei Lungenkrankheiten zu stellen. Wie musikalischer und damit wienerischer kann man eine solche Untersuchungsmethode benennen, die als Perkussion Eingang in das medizinische Werk finden sollte? Kein Wunder: Auenbrugger hatte nicht nur ein Libretto für das Singspiel „Der Rauchfangkehrer“ von Antonio Salieri geschrieben, sondern war im Jahr 1775 auch dessen Trauzeuge gewesen.
Die Übersetzung von Auenbruggers Behandlungsmethode aus dem Lateinischen ins Französische durch Jean-Nicolas Corvisart, niemand Geringerem als der Leibarzt Napoleons, aus dem Jahr 1808 fiel Laënnec in die Hände. Er las die Schrift Auenbruggers mit Interesse und sie kam ihm im Jahr 1816 bei der Visite einer stark übergewichtigen jungen Patientin mit Herzproblemen wieder in den Sinn. Die übliche Methode, sein Ohr an den Brustkorb zu legen und abzuhören, kam aufgrund der starken Beleibtheit und der Keuschheit der jungen Frau nicht infrage.
Er entsann sich Auenbruggers Schrift, rollte ein Blatt Papier und schnürte es zusammen. Diese Rolle legte er mit einer Öffnung an die Brust der Patientin. An das andere Ende presste er sein Ohr und konnte somit den Atemgeräuschen und dem Herzrhythmus lauschen. Das war die erste primitive, aber nützliche Version des Stethoskops, das Laënnec zuerst einmal „Pectoriloque“ taufte.
Ich erinnerte mich zufällig an eine einfache und bekannte Tatsache in der Akustik … die große Deutlichkeit, mit der wir das Kratzen einer Stecknadel an einem Ende eines Holzstücks hören, wenn wir unser Ohr an das andere Ende anlegen. Auf diese Anregung hin rollte ich sofort eine Papierrolle zu einer Art Zylinder und brachte ein Ende davon im Bereich des Herzens und das andere Ende an meinem Ohr an. Ich war nicht wenig überrascht und erfreut, als ich feststellte, dass ich dadurch die Tätigkeit des Herzens in einer Weise wahrnehmen konnte, die viel klarer und deutlicher war, als ich es je durch das unmittelbare Anbringen meines Ohres hätte tun können.

Abbildung 5: Laënnecs hölzernes Stethoskop, wie es sich im Science Museum in London befindet.
Laënnec hatte die Bedeutung seiner Erfindung erkannt und verwendete sehr viel Zeit darauf, sie weiterzuentwickeln, bis er die praktischere und heute bekannte Form des Stethoskops vor sich hatte. Sein neues medizinisches Gerät bot einige Vorteile. Neben dem Abhören des Brustkorbs erlaubte es auch seinen weiblichen Patienten, ihre Keuschheit zu bewahren. Laënnec musste nicht mehr sein Ohr auf die Brust seiner Patientinnen pressen, um Lungenuntersuchungen durchzuführen, mit dem Stethoskop hielt er sie auf Distanz. Auch konnte ein Arzt die Ansteckungsgefahr verringern, indem er nicht selbst den Patienten berühren musste. Und so nebenbei wurde damit die bisher alternativ eingesetzte Methode der Uroskopie abgelöst. Das war nichts andere als das Lesen aus einer Urinprobe durch einen „Experten“. Die Harnschau galt übrigens schon bei den alten Griechen als Scharlatanerie, dank der Arbeit von Auenbrugger und Laënnec zog die physische Diagnose in den medizinischen Alltag ein.
So viele Vorteile, die diese Erfindung brachte, und so viele Probleme, die auf einen Schlag gelöst wurden, führten sicher unweigerlich zu einem Begeisterungssturm unter den Ärzten dieser Zeit? Nicht so schnell. Wir können bereits vermuten, dass dem sicher nicht so gewesen war. Doch welche Gründe waren wohl gegen den Einsatz des Stethoskops gefunden worden?
Es sollte 20 Jahre dauern, bis das Stethoskop Anklang bei der Ärzteschaft finden sollte. Die verzögerte Akzeptanz spiegelte die konservative Natur der älteren Ärzte wider, die dagegen waren, Herztöne lernen zu müssen. Sie wollten auch kein Instrument zwischen ihre „heilenden Hände“ und den Patienten kommen lassen. Ein Zitat des englischen Arztes John Forbes aus dem Jahr 1821 zeigt das deutlich:
Dass es ungeachtet seines Wertes jemals in den allgemeinen Gebrauch kommen wird, ist äußerst zweifelhaft; weil seine nutzbringende Anwendung viel Zeit erfordert und sowohl dem Patienten als auch dem Arzt einige Schwierigkeiten bereitet; weil sein Farbton und sein Charakter fremd sind und im Gegensatz zu all unseren Gewohnheiten und Assoziationen stehen.
Forbes hatte Laënnecs Buch „De l’auscultation médiate: ou traité du diagnostic des maladies des poumons et du cœur, fondé principalement sur ce nouveau moyen d’exploration“ („Von der mediatrischen Auskultation: Oder die diagnostische Behandlung von Krankheiten der Lunge und des Herzens, basierend auf dem neuen Untersuchungsgerät“) aus dem Französischen ins Englische übersetzt. Diese Arbeit hätte sich Forbes vermutlich nicht angetan, wäre das Buch eine reine Abhandlung über das Stethoskop gewesen. So übersetzte er das gesamte zweibändige Werk und fühlte sich verpflichtet, in seinem Vorwort als Übersetzer seine Skepsis zum neuen Untersuchungsgerät für die Ewigkeit auszudrücken. Den Siegeszug trat das Instrument dann aber doch an. Dieser wurde vor allem durch die jungen Ärzte ermöglicht.
200 Jahre später und in die Jahre gekommen, ist das Stethoskop nach wie vor eines der wichtigsten Instrumente für die Ärzteschaft. Und das, obwohl es bereits bessere neue Instrumente gäbe, die es ersetzen könnten. KI-unterstützte Ultraschallgeräte in der Größe eines Handys, die den Herzschlag und die Lungenfunktion nicht nur hörbar machen, sondern auch die Herzkammern anzeigen und zusätzlich noch die Flüssigkeitsmenge in der Lunge errechnen, kosten verhältnismäßig wenige Tausend Euro. Trotzdem hängen die Ärzte an ihren analogen Stethoskopen.24 Warum? Weil es finanziell einträglicher ist, die Patienten mit teuren und stationären Echokardiogrammen und Ultraschallgeräten vom Spezialisten untersuchen zu lassen. Damit fallen pro Jahr Milliarden an Mehrkosten für Versicherungen und damit für uns Patienten an. Bevor wir über die Ärzteschaft von vor 200 Jahren und deren Widerwillen schmunzeln, sollten wir uns fragen, was moderne Ärzte davon abhält, neue Technologien einzusetzen. Und die Gründe scheinen um einiges verwerflicher zu sein als diejenigen ihrer Kollegen um das Jahr 1800.
Die tragische Ironie der Geschichte ist, dass ausgerechnet er, der Erfinder des modernen Stethoskops, René Laënnec, im Alter von 45 an einer Lungenkrankheit – Tuberkulose – erkrankte und mit einer mittelalterlichen Methode, dem Aderlass, behandelt wurde. Das gab ihm, der immer unter einer angeschlagenen Gesundheit gelitten hatte, den Rest. Wie es seiner jungen, übergewichtigen Patientin ergangen war, bei der er zum ersten Mal seine spontane Erfindung ausprobiert hatte, hat uns die Chronik nicht überliefert.
Spieglein, Spieglein an der Wand
Man kann keinen unbenutzten Spiegel kaufen.
Das Bedürfnis, sich selbst betrachten zu können, wird dem eitlen Narziss aus der griechischen Mythologie zum Verhängnis. Nachdem er stolz mehrere Verehrerinnen abgewiesen und sich eine von ihnen enttäuscht das Leben genommen hat, wird Narziss von Nemesis, der Göttin des (gerechten) Zornes, dazu verdammt, sich in sein eigenes Spiegelbild zu verlieben, von dem er seinen Blick nicht mehr abwenden kann, was ihn letztendlich zu Tode bringt.
Einige Tausend Jahre vorher schon, nicht unweit davon in der heutigen Türkei, wurden vulkanische, glasartige Gesteine glattgeschliffen. Der sogenannte Obsidian ist ein Überbleibsel von rasch abgekühlter Lava, der dank seiner Kristallstruktur teils durchsichtig und, wenn geschliffen, reflektierend sein kann. In Grabesstätten im heutigen Çatalhöyük wurden mehrere dieser Obsidianspiegel als wertvolle Grabbeigaben entdeckt. Diese waren nicht größer als ein Handteller und filterten wegen ihrer natürlichen Färbung die meisten reflektierten Farben heraus. Diese primitiven Spiegel, in denen man sich selbst erkennen konnte, wurden vor allem Frauen als Grabbeigabe beigelegt.
Es ist nicht bekannt, ob die Menschen die Spiegel verwendeten, um sich selbst darin zu betrachten, ob sie bei religiösen Ritualen Verwendung fanden oder vielleicht, um die Zukunft vorherzusagen. Tatsächlich ist im Fachbuch „The Wiccan’s Dictionary of Prophecy and Omens“ der neureligiösen Wicca-Bewegung – so eine Art moderner Hexer- und Hexenverband – der Begriff „Katoptromantie“ zu finden, der unter anderem die Weissagung und die Aufschlüsselung verborgener Geheimnisse aus der Vergangenheit aus Spiegeln beschreibt. Wie auch immer, bei der Betrachtung meines zerknautschten Morgengesichts im Spiegel entschlüsselt sich für mich immer das Geheimnis, was ich gestern gemacht haben muss, um so auszusehen, und ich kann weissagen, was ich heute sicher nicht machen werde.
Spiegel fanden sich in allen Zivilisationen. Die Römer hatten welche, bei den Olmeken im heutigen Mexiko wurden Spiegelsteine gefunden, ebenso bei den Maya, den Etruskern, den Ägyptern und bei den Bewohnern einer Pfahlbausiedlung am Neuenburgersee in der heutigen Schweiz. In China wurden vor etwa 4.000 Jahren die ersten Spiegel aus Metallen gefertigt. Selbst Jahrtausende später und nach einigen technologischen Weiterentwicklungen waren Spiegel aus Stein, Glas oder Metall vor allem klein und teuer. Mehr als sein Gesicht konnte man nicht erkennen. Sich selbst betrachten konnten sich ausschließlich Adelige mit dem notwendigen Bargeld.25
Um das Jahr 1400 begannen mit Zinnblech hinterlegte und mit Quecksilber beschichtete Glasspiegel aus Venedig Europa zu erobern – und das für saftige Preise. So kostete ein reichlich verzierter und in einem Silberrahmen angefertigter Spiegel mit 8.000 Pfund mehr als die Gemälde des begehrtesten Künstlers der Hochrenaissance Raffael, die es schon für Schnäppchenpreise ab 3.000 Pfund gab. Kein Wunder, dass Venedig die Fertigungstechniken der Spiegelproduktion als Staatsgeheimnis hütete und die Spiegelmacher als Künstler betrachtete und mit einigen Privilegien bedachte.26
[Venedig] schützte und überwachte [die Spiegelmacher] und gewährte ihnen viele Privilegien wie das Recht, Töchter von Adligen zu heiraten.
Das konnte der Sonnenkönig Ludwig XIV. nicht ausstehen, der wohl für damalige Zeiten mit seinem französischen Hofstaat den Zenit der Eitelkeit darstellte. Er lobte eine hohe Prämie aus, wenn es gelänge, venezianische Spiegelmacher nach Frankreich zu locken. Anfang 1660 gelang das auch und mehrere Spiegelmacher zogen aus der Lagunenstadt nach Frankreich. Doch damit begann eine neue Episode des „Spiegelkriegs“. Schon einige Jahre später erkrankten und verschieden gleich drei der Künstler. Die Franzosen vermuteten eine gemeine Giftattacke der eifersüchtigen Venezianer, und das nicht ganz unbegründet. Im Jahr 1547 hatten zwei abtrünnige Spiegelmacher, die nach Deutschland ziehen wollten, ein vorzeitiges Ende gefunden, und die Familienmitglieder anderer Abtrünniger waren zu Strafarbeiten verurteilt worden. Die nächsten Jahrzehnte hatte es einige Gewalt gegen Spiegelmacher und deren Familien gegeben, die aus Venedig wegziehen und ihre Betriebsgeheimnisse mitnehmen wollten.
Durch eifriges Experimentieren fanden die Franzosen schließlich den Schlüssel zur Spiegelmacherei und mit der Einweihung des Spiegelsaals in Versailles im Jahr 1684 wurde es den Venezianern klar, dass ihr gut gehütetes Geheimnis gelüftet war. Dass es dazu gekommen war, war dem französischen Finanzminister Jean-Baptiste Colbert zu verdanken, der im Jahr 1665 die königliche Spiegelmanufaktur „Manufacture Royale de Glaces de Mirroirs“ eingerichtet hatte, um das Wirtschaftswachstum anzutreiben und Frankreich bei der Produktion von Luxusgütern vom Ausland unabhängig zu machen. Sobald die Produktion aufgenommen worden war, wurde der Import von venezianischen Gläsern und Spiegeln untersagt.
Die Todesursache der beiden ersten Venezianer in den Diensten des Sonnenkönigs hatte allerdings nichts mit Attentätern aus Venedig zu tun. Der Tod war vielmehr durch die giftigen Substanzen bei der Herstellung von Spiegeln bedingt, bei der unter anderem das giftige Quecksilber zum Einsatz kam. Nicht nur das Quecksilber wurde als Gift angesehen. So beschrieben Zeitgenossen bei der Einweihung des Spiegelsaals den Effekt der endlosen Reihen an Spiegeln:
In Versailles haben die Wände Augen, und die mit Spiegeln bedeckten Galerien schaffen eine beängstigende Sicht. … Der Spiegel ersetzt die Realität durch seine eigene symmetrische Nachbildung, ein Theater der Reflexion und des Kunstgriffs.
Erst durch die vom deutschen Chemiker Justus von Liebig im Jahr 1835 erfundene Silberschicht, die auf eine Glasfläche kostengünstig aufgetragen und mit einem Schutzlack versehen werden konnte, sanken die Preise bei der Herstellung von Spiegeln und sie konnten kostengünstig großformatig hergestellt werden.
Die Erfindung des Spiegels, vor allem, wenn er so groß war, dass man sich vollständig darin betrachten konnte, war für die Menschen, die sich zum ersten Mal darin sahen, augenöffnend. Wie es uns heute geht, wenn wir unsere Stimme zum ersten Mal auf einem Tonband oder einer Videoaufnahme am Computer hören, ging es den Menschen mit ihrem Ebenbild. Die innere Vorstellung, wie man selbst aussieht, kollidiert mit dem wirklichen Bild. Es gestattet eine realistische Einschätzung und den Vergleich mit anderen, der nicht unbedingt zum eigenen Vorteil ausfallen muss.
Der aus Israel stammende Professor für Psychologie und Verhaltensforschung an der Duke University Dan Ariely berichtet von seiner Jugend, als er eine solche Erkenntnis durchleben musste. Als er seinen Wehrdienst bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften absolvierte, war eine Kiste mit Leuchtgranaten, in deren Nähe er sich befunden hatte, in Brand geraten und explodiert. Die brennenden Trümmer hatten ihn getroffen und ihm schwere Brandverletzungen zugefügt. Er musste mehrere Jahre im Krankenhaus bleiben und einen äußerst schmerzhaften Heilungsprozess durchleben. Einige Monate nach dem Unfall, als er das erste Mal wieder auf eigenen Beinen humpeln konnte, ging er den Krankenhausflur entlang und kam an einem Spiegel vorbei. Er blickte nur kurz hinein und sah eine verstümmelte, hagere Person in Bandagen und mit halb verbranntem Gesicht. Erst einige Augenblicke später wurde ihm klar, dass er sein eigenes Spiegelbild sah. In seiner Vorstellung war er nach wie vor der junge, gutaussehende Israeli und nicht dieser Krüppel gewesen. Innerlich war er derselbe geblieben, aber sein Körper hatte eine schreckliche Transformation durchgemacht, die Einfluss auf seine Chancen beim anderen Geschlecht und letztendlich auch auf seine Berufswahl haben sollte.
Mit der Erfindung des Spiegels manifestierten sich auch andere Widerstände, speziell, wenn ein Spiegel nicht zur Ausübung religiöser Zeremonien oder zur Weissagung diente. Man begann, vom langsamen Gift zu sprechen, das die zwanghafte Betrachtung des eigenen Spiegelbilds bei manchen Menschen auslöste. Sie konnten sich davon nicht mehr lösen. Diese Menschen waren laut den Kritikern vor allem Frauen.
In den Galerien und Museen der Welt hängen Hunderte Gemälde von Frauen, die ihren Blick in ihrer Reflexion im Spiegel verloren haben. Manche gehen sogar so weit, dass sie ihr eigenes Spiegelbild küssen. Was die vorwiegend männlichen Künstler den weiblichen Subjekten in ihren Werken vorwarfen, traf auf die Künstler selbst klarerweise nicht zu. Wenn sich Männer im Spiegel betrachteten, dann war das rein künstlerischen Zwecken zuzuschreiben. Eitelkeit war ihnen zufolge ein Laster der Weiblichkeit. Dabei verewigten sich die Maler selbst immer wieder durch Spiegel in ihren Gemälden. In Selbstporträts als spitzbübischer Künstler, der Frauen bei der Anprobe betrachtet und sich ironisch ins Bild schummelt, oder einfach, um seine Fähigkeit als Künstler zu demonstrieren, wenn es sich um einen spiegelnden Gegenstand handelt, der das Ebenbild verzerrt darstellt. Also ein Mann vor dem Spiegel: Ironie und Kunst. Eine Frau vor dem Spiegel: Eitelkeit.

Abbildung 6: Eitelkeit von Auguste Toulmouche, circa 1870
Mitte des 19. Jahrhunderts zogen Spiegel in immer mehr Haushalte ein und wurden somit für breitere Bevölkerungsschichten zum Alltagsobjekt. Und das rief, wie nicht anders zu erwarten, die Moralapostel der damaligen Zeit auf den Plan, deren Kritik sich vor allem gegen die Weiblichkeit wandte. In einer Zeitung namens The New York Ledger von 1890 fand sich folgender Satz in einer Abhandlung zum Spiegel:
Frauen sind eine Spezies der Selbstanhimmlung.
So findet sich in der Ausgabe des Chicago Record aus dem Jahr 1895 folgendes Zitat:
Die Eitelkeit wurde geboren, als der Spiegel entdeckt wurde.
Und so ging es weiter. Der Spiegel wurde als Problem, als Ablenkung, als korrumpierendes Element und als Peinlichkeit betrachtet. Was uns heute selbstverständlich und fast schon omnipräsent erscheint, etwas, woran wir keine Gedanken mehr verschwenden, war damals genauso neu wie kontrovers und wurde zum Anlass genommen, anderen Menschen zu erklären, was Sünde sei, welche moralische Gefahr durch die Eitelkeit bestehe und wer daran Schuld habe.
Mit all der – vorwiegend männlichen – Kritik wird ein wesentlicher Punkt übersehen. Frauen wurden und werden nach wie vor vor allem aufgrund ihres Äußeren bewertet. Trotz all des Gelabers um „innere Werte“, erfahren besonders Frauen diese Diskriminierung tagein, tagaus. Ein Blick in den Spiegel ermöglicht es ihnen, selbst „ihren Wert abzuschätzen“, oder anders ausgedrückt, wie sie von anderen – nämlich Männern – bewertet werden. Schon in den meisten Märchen werden Gut und Böse mit Schönheit und Hässlichkeit gleichgesetzt, ein dominierendes Narrativ unserer Kultur.
Weil die Diskussion um die Eitelkeit mit der weiten Verbreitung von Spiegeln ab Mitte 1800 einsetzte, müssen auch die Umweltbedingungen berücksichtigt werden. In den Berichten der zeitgenössischen Blätter wird immer wieder auf den Ruß und den Schmutz hingewiesen, der mit dem Einsetzen der industriellen Revolution und der Transportmittel in der Luft lag und sich wie ein Film über die Kleidung und das Gesicht legte. Durch einen raschen Blick in einen Taschenspiegel konnte man prüfen, ob der Umweltschmutz schon seinen Tribut an das Aussehen gefordert hatte.
Spiegel gab es bald in allen Formen, selbst auf Handschuhrücken waren sie angebracht. Die Eitelkeit war bei Weitem nicht auf Frauen beschränkt. Denn wie rasierten sich denn Männer und woher wussten sie, ob ihr Schnauzbart richtig gezwirbelt war? Ein Ladeninhaber in Chicago bestätigte das auf Anfrage. Im Jahr 1885 war ein Artikel mit dem Titel „Die Eitelkeit der Männer“ erschienen, der in vielen Zeitungen nachgedruckt werden sollte. Der Reporter fragte den Ladeninhaber, wer denn all die Kunden seien, die diese kleinen Taschenspiegel und Pflegesets kaufen. Nicht die Frauen sind unsere besten Kunden, meinte der Inhaber, es seien Männer, egal, ob „sie Affen oder Apollon“ seien, es wäre gleich.
Auch andere Gefahren gingen von Spiegeln aus, und damit sind nicht eventuelle Schnittwunden an zerbrochenen Spiegelscherben oder das laut Aberglauben damit verbundene siebenjährige Pech gemeint. Die Chicago Tribune vom 8. Dezember 1912 warnte in einem Beitrag mit der dramatisch klingenden Schlagzeile „Diese kleinen tödlichen Spiegel“ von einer gefährlichen Begebenheit eines jungen Fräuleins namens Helen, die mit einen jungen Herrn namens Jack verabredet gewesen war. Als sie ihn auf der anderen Seite der vielbefahrenen Straße erblickt hatte, „zückte sie ihren Spiegel und Puderdose und begann, ihr rosa Näschen zu pudern“. Weil sie das gedankenverloren mitten auf der Fahrbahn getan hatte, konnte sie von Glück sagen, dass der Verkehr vor ihr knapp zum Halt gekommen war. Ein Einzelfall? Nicht wirklich, laut der Chicago Tribune, die eifrig versicherte, dies passiere in Chicago tausendmal pro Tag.
Daran hat sich bis in die Gegenwart nichts geändert. Heute ist es weniger der Spiegel als vielmehr das Smartphone, das seinen Platz bei den Kritikern und Moralaposteln eingenommen hat. Das Selbstbildnis hat einen neuen Namen erhalten: Selfie. Und wer kriegt wieder sein Fett ab? Frauen. Influencerinnen, YouTuberinnen, Make-up-Künstlerinnen und weibliche Instagramer sind die neuen Ziele der Eitelkeitsverdammer. Die Besessenheit vom Selbstbild, Selbstverliebtheit und die exhibitionistische Zurschaustellung des eigenen Körpers und Ebenbildes sind Ziele der Attacken. Und wie damals schon befürchten Kritiker den moralischen Verfall und den Zerfall der Zivilisation. Doch eigentlich geht es um etwas anderes: Es geht um den weiblichen Körper und wer diesen kontrollieren darf.
Dass es ebenso viele männliche Vertreter in der Kategorie Eitelkeit gibt, geht fast schon unter. Ebenso, dass die meisten Follower der weiblichen Influencer Männer sind. Nur ist die Rolle hier umgekehrt. War Narziss noch derjenige, der seine weiblichen „Follower“ abblitzen ließ, so sind die weiblichen Instagramerinnen für die männliche Gefolgschaft unerreichbar. Verspätet, aber doch trifft die männlichen Kritiker der gerechte Zorn der Nemesis.