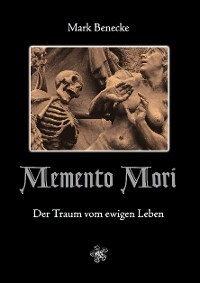Kitabı oku: «Memento Mori», sayfa 3
Multiplizierte Wurmleben
Wenn jede Zelle zu einer festgesetzten Zeit stirbt, sollte auch ein ganzer Körper zu einem vorhersagbaren Zeitpunkt sterben. Bei Menschen ist der Tod einzelner Zellen jedoch schwer festzustellen. Außerdem sind menschliche Zellen während des Lebens zu vielen Einflüssen ausgesetzt, die einen genetisch vorprogrammierten Todestermin verändern können. Stress und Rauchen führen beispielsweise zu einem verfrühten Tod, ein geruhsameres Leben kann den Verschleiß des Körpers hinauszögern.
Es gibt jedoch Lebewesen, die der Beobachtung besser zugänglich sind. Sie erblicken nur für wenige Tage das Licht der Welt. Eines dieser Tiere ist der Fadenwurm Caenorhabditis elegans. Seine Todeszeit ist vorhersagbar.
Die kleinen Würmer kommen auf der ganzen Welt vor. In Blumenerde trifft man sie genauso an wie auf Äckern und Wiesen. Sie sind buchstäblich überall. Da sie nur einen halben Millimeter lang und zudem durchsichtig sind, fallen sie nicht auf. Biologen haben sich die Mühe gemacht, diese Tiere zu züchten und zu ermitteln, wie lange sie leben. Normalerweise sind es einundzwanzig Tage.
Spannend wurde es, als um 1990 C.-elegans-Würmer vollkommen gleichen Aussehens auftauchten, die im Schnitt einen halben Tag länger lebten. Die C.-elegans-Forscher in aller Welt entdeckten weitere Tiere, die nach 33, 25 oder 12,5 Tagen sterben. Der Forscherinstinkt war geweckt, und so suchte man nach der Ursache der veränderten Lebenszeit. Eine noch nicht ausgereifte Erklärungsmöglichkeit besagt, dass eine bestimmte Grundeinheit von Lebenstagen mit einer genetisch festgelegten Zahl, die größer oder kleiner als eins sein kann, multipliziert werden könnte. Woraus die Zellzeitmultiplikatoren bestehen, ist noch ungewiss. Vielleicht liegt das Geheimnis des verlängerten oder verkürzten Lebens in ausgewählten Bereichen der Erbsubstanz, die man »Todesgene« nennen könnte.
Einige Todesgene sind schon bekannt
In Caenorhabditis elegans, aber auch in der Taufliege Drosophila melanogaster konnten Genetiker bereits mehrere Gene finden, die gezielt Zellen des eigenen Körpers umbringen. Besonders berühmt sind zwei Selbstmordgene namens ced-3 und ced-4, die in jeder Körperzelle des Fadenwurms stecken.
Während der junge Fadenwurm heranwächst, sterben in ihm bestimmte Zellen zu vorhersagbaren Zeitpunkten ab. Das ist wenig dramatisch – derselbe Vorgang findet statt, wenn sich Menschenfinger bilden: Ohne programmierten Zelltod würden sich zwischen unseren Fingern Schwimmhäute spannen.
Wenn man zwei der Selbstmordgene im Wurm ausschaltet (das ist problemlos möglich), dann überleben sämtliche Zellen, darunter auch solche, die bei der Normalentwicklung sterben, um Raum für neu entstehende Organe zu schaffen. Thomas Johnson gelang es schon Anfang der Neunzigerjahre an der Universität Colorado, ein Todesgen des Fadenwurms auszuschalten und die Lebenszeit der Tiere dadurch zu verdoppeln. Ganz ähnliche Gene gibt es in den Zellkernen der Säugetiere. Besonders erwähnenswert sind auch so genannte Überlebensgene wie das Gen p53. Sie verhindern den programmierten Zelltod, ohne dass Todesgene ausgeschaltet werden müssten.
Einige US-amerikanische Entwicklungsgenetiker denken schon heute laut darüber nach, Medikamente für Menschen zu entwickeln, die Todesgene beeinflussen. Dieser Vision sind zumindest Taufliegen- und Fadenwurmforscher schon recht nahe.
In der Taufliege wurde beispielsweise ein Gen namens reaper (Sensenmann) entdeckt. Es leitet den kontrollierten Zelltod ein, sobald eine bestimmte Menge von Todessignalen in die Zelle gelangt. Schaltet man das Sensenmanngen aus, können selbst beschädigte oder kranke Zellen weiterleben. Medizinisch (das heißt beim Menschen) wäre so etwas nicht von Nutzen, denn beschädigte Zellen müssen unbedingt aufgelöst werden.
Bessere Kandidaten im Hinblick auf eine medizinische Altersvorbeugung könnten andere Todesgene wie der DNA-Abschnitt apo E sein. Man hat das Gen zwar noch nicht ausgeschaltet, aber an der Universität Harvard fand Thomas Perls Arbeitsgruppe heraus, dass sehr alte Menschen, denen das apo-Gen E4 von Natur aus fehlt, besonders gesund und lebensfroh sind. Natürlich kann man sich nicht ganz sicher sein, dass das Fehlen von apo E4 und das Altersglück wirklich zusammengehören. Wenn man aber die Ergebnisse psychologischer Tests, die das Wohlbefinden prüfen, mit molekularen Tests für das Fehlen von apo E4 vergleicht, gibt es Übereinstimmungen: Menschen ohne apo E4 geht es oft besser.
Sicher ist jedenfalls, dass es einen engen Zusammenhang zwischen dem Altern, das streng genommen ab dem fünfundzwanzigsten Lebensjahr beginnt, und dem Programm unserer Gene gibt, die das Altern fest vorschreiben.
Selbstmord der Zelle
Die Zeiger der Lebensuhr bestehen aus DNA. Wie aber funktioniert das von Genen gesteuerte Altern in der einzelnen Zelle?
Am Altern sind viele Zellvorgänge beteiligt. Einer der bekannteren ist das »Kappentragen«. Auf beiden Enden der DNA-Moleküle der einzelnen Chromosomen sitzt jeweils eine Art Kappe aus Wiederholungen der Basen folge TTAGGG, welche die DNA vor zersetzenden Stoffen schützt. Die Kappe ähnelt in ihrer Wirkung einem Ritterhelm, der Schwerthiebe abwehrt. Jedes Mal, wenn sich eine Zelle teilt und vermehrt, wird die Kappe vorübergehend abgenommen und nach vollendeter Teilung rasch wieder aufgesetzt. In alternden Zellen beobachtet man manchmal, dass die Schutzkappe von Teilung zu Teilung weniger haltbar zu werden scheint. In sehr alten Zellen ist sie bereits ziemlich brüchig oder verkürzt. Vielleicht wird sie von der Zelle absichtlich beschädigt. Das hat zur Folge, dass DNA-zerstörende Substanzen zuletzt ihren tödlichen Streich gegen die ungeschützte Erbsubstanz führen können.
So könnte sich auch erklären, warum sich alte Zellen nur noch schlecht züchten lassen und nach einer genau festgelegten Anzahl von Teilungen aufhören, sich zu vermehren: Die Schutzkappe der DNA ist zerstört. Selbst Sauerstoff und Wachstumsfaktoren nützen dann nichts mehr.
Doch warum weihen sich Zellen selbst dem Tod? Dafür gibt es drei Gründe. Der erste wurde bereits angesprochen. Beim Heranwachsen einer menschlichen Hand sind Selbstmordopfer notwendig, um die Finger herauszumodellieren. Es ist das gleiche Verfahren, mit dem auch ein Bildhauer aus einem Steinbrocken eine Figur entstehen lässt. Erst das Wegschlagen von Gestein führt zu den Formen des gewünschten Modells. Genauso ist es beim jungen menschlichen Embryo, der noch Schwimmhäute besitzt. Während die Finger und Zehen entstehen, sterben die dazwischenliegenden Hautbereiche ab. Das ist genetisch vorprogrammiert und sinnvoll.
Der zweite Grund für den absichtlichen Zelltod besteht darin, dass stark beanspruchte Zellen ersetzt werden müssen. Das gilt zum Beispiel für Hautzellen, die starkem Abrieb ausgesetzt sind. Aber auch die Zellen der Leber, die das Blut entgiften, können sich abnutzen. Früher oder später werden sie durch frische Leberzellen ersetzt. Alle Zellen des Körpers, die erschöpft sind und nicht mehr voll funktionieren, werden abgeschaltet und durch neue, frische Zellen ersetzt.
Auf diese Weise wird fast unser gesamter Körper mehrmals im Laufe unseres Lebens erneuert. Diese Generalüberholung geht in verschiedenen Organen allerdings verschieden schnell vonstatten. Besonders kurzlebig sind rote Blutzellen: 2,4 Millionen von ihnen sterben in jeder Sekunde in unserem Körper und werden sofort ersetzt. Leber- und Knochenzellen bleiben immerhin einige Jahre funktionstüchtig.
Lebensdauer einiger Zelltypen
| Mittlere Lebensdauer | |
| Magenzellen | 1,8 Tage |
| Luftröhrenzellen | 47,5 Tage |
| Lungenzellen | 81,1 Tage |
| Rote Blutkörperchen | 120,0 Tage |
| Haut des Ohres | 34,5 Tag |
| Haut auf den Lippen | 14,7 Tage |
Während eines Jahres bilden sich rein rechnerisch neu:
228 Dünndarmwände
192 Magenausgänge
25 Hautbedeckungen der Lippen
18 Lebern
8 Luftröhren
6 Harnblasen
Nach etwa sieben Jahren sind wir im wahrsten Sinne des Wortes neue Menschen; nur Nerven und Muskeln werden praktisch nicht erneuert. Dass wir dennoch nicht alle sieben Jahre zart wie Neugeborene aussehen, liegt daran, dass sich erstens nicht alle Zellen gleichzeitig und aufeinander abgestimmt erneuern und dass zweitens ein anderes »Programm« das »Erneuerungsprogramm« überlagert. Es heißt Altern und Sterben, und es führt dazu, dass die Erneuerungsrate und -güte abnimmt.
Gäbe es Letzteres nicht, so könnten sich menschliche Körper möglicherweise sehr lange oder gar ewig erneuern und zellulär verjüngen. Warum also muss der mühsam aufgebaute Organismus nach einigen Jahrzehnten sterben?
Die Antwort auf diese Frage ist der dritte Grund für das in der Erbsubstanz programmierte »freiwillige« Sterben der Lebewesen.
Auch wenn es einem lebenden Erwachsenen nicht einleuchtet, dass er zugunsten seiner Art sterben muss, ist das sozial notwendige Geschehen – eben Altern und Sterben – in seiner DNA vorherbestimmt. Der Grund dafür ist, dass sich während der Entwicklung des Lebens ein über dem Einzelnen stehendes Prinzip entwickelt hat: das der Anpassung an veränderte Umweltbedingungen. Unsterbliche Einzelmenschen könnten diese Anpassung nicht leisten, denn sie würden immer wieder nur sich selbst aus der immer gleichen Erbsubstanz herstellen.
Ändert sich die Umwelt, so können möglicherweise nur solche Nachkommen überleben, die wegen der Vermischung des Erbgutes der Eltern und vielleicht auch durch kleine Zufallsabwandlungen (Mutationen) des Erbgutes besser als ihre Ahnen in das neue Umgebungsgefüge passen. Da niemand vorhersagen kann, welche Art von Veränderung stattfindet – Hitze, Kälte, Wind, Umweltgifte oder vermehrte UV-Einstrahlung –, ist die natürlicherweise auf gut Glück betriebene Zeugung von Nachkommen mit verschiedenen Eigenschaften oft erfolgreich. Eltern, die vielgestaltige Nachkommen in die Welt gesetzt haben, sterben zwar, um ihren Nachkommen im wahrsten Sinne des Wortes Platz zu machen, aber ihre Gene, die sie zum (Groß-)Teil vererbt haben, überleben in den Kindern.
Diese treibende Kraft der Arterhaltung – das Erschaffen und Hegen leicht abgewandelter Nachkommen – steht weit über den privaten Interessen der Einzelnen. Deshalb tragen alle in der heutigen Welt lebenden mehrzelligen Wesen das übergeordnete Hauptprogramm in sich, das es ihnen ermöglicht, zu sterben und zuvor Kinder zu zeugen, die ihnen zwar ähneln, aber nicht völlig gleichen. Dieses Programm ist so fest in der Erbsubstanz verankert, dass es, allgemein gesprochen, nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.
Wie mächtig diese Grundkraft ist, kann man auch daraus erahnen, dass viele Menschen, die keine leiblichen Kinder haben können, einen dringenden Kinderwunsch verspüren.
Es ist die »Stimme der Erbsubstanz«, die dieses Verlangen bewirkt, der oft so genannte biologische Imperativ. – Doch keine Regel ohne Ausnahme. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass Lebewesen eine Art Unsterblichkeit erlangen.
Wesen, die nicht sterben
Je weiter Biologen und Erdgeschichtsforscher in die Vergangenheit blicken, umso mehr wundern sie sich. Einst wurde die Welt von seltsam aussehenden Tieren und Pflanzen bevölkert. In urzeitlichen Meeren schwamm beispielsweise ein Krebs mit Namen Marrella splendens, der hinter seinen Facettenaugen furchtbare Hörner, so groß wie sein ganzer Körper, trug. Sein Rücken wurde von einem Paar gezackter Gestänge überdeckt, und seine Kiemen ragten seitlich aus der Körpermitte hervor. Übergroße gebogene Antennen erforschten die unwirtliche Umwelt. Das Tier passt in kein gängiges Schema der Biologie. Dabei lebte es vor nur fünfundsechzig Millionen Jahren, im Vergleich zur gesamten Erdgeschichte also vor recht kurzer Zeit. Die Dinosaurier waren gerade ausgestorben, als dieser skurrile Meeresbewohner auf der Bildfläche erschien.
Ein nicht weniger verwunderliches Wesen, das weder Tier noch Pflanze war, lebte weit früher im heutigen Australien, China und England. Es maß über einen Meter im Durchmesser und war vollkommen platt, zehnmal dünner als eine flach auf den Tisch gelegte Hand.
Die Oberfläche dieser Kreatur war ein wenig gefurcht, und in der Mitte war eine Längsachse zu erahnen. Das war alles. Auf der glatten Oberseite waren weder Kopf noch Antennen, Augen, Mund oder Schwanz zu erkennen. Vielleicht hat sich dieses Geschöpf wie unser heutiger Regenwurm fortbewegt – als riesige platte, gerunzelte Scheibe, die sich zusammenzog und wieder streckte. Nach Regenwurmart liefen ihr dabei vielleicht Muskelwellen über den Körper.
Diese Wurmscheiben krochen vor über sechshundert Millionen Jahren unter Wasser auf dem Grund umher, Millionen von Jahren, bevor es Dinosaurier oder gehörnte Krebse gab. Noch nicht einmal Insekten hatten sich zu jener Zeit in die Luft erhoben, und von Fischen war erst recht noch nichts zu erahnen.
Marrella-Krebse und Wurmscheiben erscheinen uns in Gestalt und Lebensweise bereits absonderlich. Aber schauen wir noch weiter in die Geschichte des Lebens zurück: Zu Urzeiten lebten Wesen, die eine noch weitaus merkwürdigere Eigenschaft besaßen. Sie waren beinahe unsterblich.
Das ewige Leben dieser Tiere birgt allerdings einen Widerspruch. Einerseits sterben »ewige Tiere« tatsächlich nicht (wenn sie nicht gewaltsam getötet werden). Es gibt bei ihnen keine Leichen. Andererseits jedoch besteht das einzelne Lebewesen als solches nicht dauernd fort. Alle Nachkommen der unsterblichen Urtiere sind Kopien desselben gemeinsamen Muttertiers, das sich schlichtweg aufteilt. Die kopierten Nachkommen gleichen der Mutter in allem: Vom Körperumriss bis hin zu ihrer Reaktion auf einen bestimmten Reiz, zum Beispiel eine Erschütterung oder einen Lichtblitz. Sie sind perfekte Abbilder ihrer Vorgängerin. Weil man die Nachkommen durch nichts voneinander und von ihrer Mutter unterscheiden kann, nennt man solche Lebewesen Klone (siehe Box »Klonen und Klonieren«).
Die unsterblichen Überlebenskünstler gibt es heute noch. Man begegnet ihnen tagtäglich, ohne es zu bemerken. In einem Tropfen aus einer Pfütze beispielsweise kann man eines dieser Urwesen auch ohne Vergrößerungsglas gerade noch erkennen: die Hydra. Das vielarmige Wesen kann nahezu jede Verletzung wieder ausgleichen, indem es die zerstörten Teile neu bildet.
Der Name der Hydra stammt aus der griechischen Sagenwelt. Dort gibt es ein Fabelungeheuer, dem für jeden ab geschlagenen Kopf mehrere neue wachsen. Auch in anderen Sagenkreisen taucht diese Idee auf, beispielsweise in den Heldengeschichten der Drachentöter. Diesen Sagen liegt eine Beobachtung zugrunde, die man offenbar schon vor einigen tausend Jahren machte. Auch wenn die antiken Berichterstatter mit der Größe des Monsters übertrieben, waren ihre Beschreibungen eine gute Vorlage für die Namensgebung des echten Tieres. In der Wirklichkeit ist es tatsächlich wie in der Sage: Den Hydren bereitet ein abgeschnittener Kopf keine Sorgen – er wächst einfach nach. Man kann eine Hydra sogar in fast beliebig viele Stücke zerschneiden oder durch ein feines Sieb drücken. Aus den kleinen Stückchen entstehen neue Hydren, oder die Stücke finden wieder zu einem gemeinsamen Körper zusammen.
Hydren vermehren sich, indem sie ab und zu kleine Ausstülpungen an ihrem Stiel bilden. Die Knospen wachsen zu neuen Tieren heran, lösen sich vom Elterntier und setzen sich irgend wo fest. Das Elterntier selbst überdauert die Jahrtausende nicht als einzelnes Wesen. Es überlebt in zahlreichen Teilen an verschiedenen Orten.
Eine andere Sorte unsterblicher Geschöpfe könnten so genannte Kugeltiere der Gattung Volvox sein.
Auch sie leben in Tümpeln und Pfützen. Da sie den Blattfarbstoff Chlorophyll in sich tragen, können sie sich mit Hilfe des Sonnenlichts ernähren. Manchmal vermehren sich die hohlen Kugeltiere in Massen und lassen dann ganze Gewässer grün erscheinen. 1981 entdeckten Jeffrey Pommerville und Gary Kochert, zwei Botaniker an der Universität von Georgia, dass jeder Einzelne der kugeligen Teichbewohner nach vier bis sieben Tagen eines natürlichen Todes stirbt.
Zuvor geben die hohlen Kreaturen in ihr Inneres Tochter-Volvoxe ab. Die Mutterkugel geht zugrunde und entlässt ihre Nachkommen, die dann heranwachsen und in sich wiederum Tochterkugeln bilden. So kann es vermutlich bis in alle Ewigkeit weitergehen, wenn keine Katastrophe dem Treiben Einhalt gebietet. (Hinzu kommt jedoch, dass auch Volvox eine innere Uhr zu haben scheint, die nach mehreren Generationen abläuft.) Der einzige offensichtliche Unterschied zwischen der Unsterblichkeit der Hydra und der des Kugeltieres ist, dass Hydra ihre Töchter nach außen abgibt, das Kugeltier dagegen nach innen. Alle Lebewesen, die in der Erdgeschichte vor den Kugeltieren entstanden sind, teilen sich bei ihrer Vermehrung in zwei neue Tiere auf. Vom Elterntier bleibt keine Spur. Volvox ist das erste Lebewesen, bei dem die Mutter zunächst erhalten bleibt und erst später stirbt. Deshalb sagt man, dass mit der Entstehung der Volvox-Hohlkugeln auch die ersten Leichen auf der Erde entstanden.
Die Teilungen ins ewige Leben – mit oder ohne Leiche – ähneln denjenigen von kopierten Menschen, die in diesem Buch an anderer Stelle vorgestellt werden (Seite 163ff.). Wenn es Wissenschaftlern oder Firmen demnächst gelingt, identische Menschen herzustellen, wiederholen sie im Grunde ein Experiment, das die Natur bereits in den Urtagen des Lebens vorgenommen hat. Der Unterschied: Die Natur hat diese Idee schon vor langer Zeit wieder aufgegeben. Und das aus gutem Grund.
Ewiges Leben hat einen entscheidenden Nachteil
Im Laufe der Jahrmillionen ging vielen Organismen die Vergänglichkeit verloren. Zwar leben auch heute noch zahlreiche solcher Wesen (vor allem Bakterien), aber je komplizierter die Lebewesen auf der Erde ausgetüftelt wurden, desto seltener kam das Unsterblichkeitsprogramm zum Einsatz. Warum ist das so? Und: Kann man, wenn man dieses Rätsel löst, den Zustand des ewigen Lebens wiederherstellen? Um das zu beantworten, nahmen Forscher die offenbar dem Jungbrunnen entstiegenen Tiere genau unter die Lupe.
Seit diese Lupe, in Form des Mikroskops, stark genug war, beobachtete man zum Beispiel »dies höchst merkwürdige, dem bloßen Auge völlig unsichtbare Geschöpf, bei dem sich Wunder auf Wunder häufen. Keine strenge Kälte, keine sengende Hitze soll es töten, und ein Tropfen Wassers das längst vertrocknete Leben zurückrufen.« Diese Beschreibung stammt aus dem vorletzten Jahrhundert. Was der Autor gesehen hatte, waren so genannte Rädertiere. Man bewunderte ihre Fähigkeit, gleichsam aus dem Staube aufzuerstehen. Der Pionier der Mikroskopie, Antony van Leeuwenhoeck, verfasste darüber 1673 in einfachen Worten einen berühmten Bericht für die Londoner Royal Society. Leeuwenhoeck hatte ein wenig Schmutz aus seiner Regenrinne in Wasser gelöst und darin die »Entstehung« winzigster Lebewesen direkt beobachtet. Weit über hundert Jahre lang konnte sich niemand erklären, woher die Tiere kamen. Viele Forscher wiederholten den Versuch mit Staub, den sie über mehrere Jahre in absolut dicht verschlossenen Gefäßen knochentrocken aufbewahrt hatten. Alle Forscher kamen zum gleichen Ergebnis. Aus der toten Materie »entstand«, wenn man sie anfeuchtete, innerhalb kürzester Zeit Leben.
Heutzutage erfreut sich jedes Schulkind daran, Heu oder Schmutz mit Wasser zu übergießen und nach einigen Tagen die nicht entstandenen, sondern auferstehenden Wesen zu beobachten. Es wundert niemanden, dass Tiere aus dem Heu zum Leben erwachen. Die winzigen Wesen verharren dort getrocknet und eingekapselt in ihrem Ruhestadium und warten nur darauf, dass ein Tropfen Wasser sie aus ihrem Dornröschenschlaf, dem latenten Leben, erweckt. Kaum ist das geschehen, beginnen sie zu fressen und sich fortzupflanzen. Damit haben sie es sehr eilig, denn eine erneute Trockenperiode könnte sie ja schon im nächsten Moment überraschen.
Wir wissen also, dass die einzelligen Tiere aus ihren Ruhekapseln hervorkriechen und nicht aus Wasser und Luft entstehen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit sind sie direkte Nachkommen von Tieren, die vor vielen hundert Millionen Jahren lebten: Eine Mutterzelle ist gewachsen und hat sich zweigeteilt. Die beiden Töchter haben gefressen, sind groß geworden und haben sich ebenfalls geteilt. Aus den so entstandenen vier Zellen wurden acht und so weiter. Dazwischen gab es durch Trockenheit erzwungene Ruhepausen und echte Katastrophen, die fast alle Nachkommen der Mutterzelle zerstörten. Doch einige Zellen überlebten und vermehrten sich umso schneller.
Diese Vermehrung durch direkte Teilung geht erstaunlich schnell vonstatten. Wenn eine Mutterzelle sich wohl fühlt, bringt sie innerhalb eines Tages mehr Nachkommen hervor, als es Menschen auf der ganzen Erde gibt.
Das ist ein Zustand ewigen Lebens. Obwohl die Mutterzelle als solche nicht mehr existiert, leben Bestandteile von ihr in allen Tochterzellen weiter. Bei Volvox und Hydra verhält es sich ebenso. Warum also pflanzen sich die meisten heutigen Lebewesen nicht mehr auf diese schnelle und praktische Art fort?
Schnelligkeit ist eben nicht der einzige Maßstab bei der Fortpflanzung. Je nach Lebensform beziehungsweise Lebensraum kann es wichtig sein, dass die Nachkommen in der Umwelt, in die sie entlassen werden, gut zurechtkommen. Die Schwierigkeit: Eltern können nicht wissen, wie die Umwelt ihrer Nachkommen aussehen wird. Wesen, die Kopien ihrer selbst herstellen, leben in ihren identischen Nachkommen zwar ewig weiter, es könnte aber sein, dass die gleichförmigen Zelltöchter sich in einer veränderten Umwelt nicht mehr wohl fühlen und krank werden. Schon eine kleine Änderung der Umgebungstemperatur kann den Stoffwechsel der Tiere gründlich durcheinander bringen. (Andererseits überleben kopierte Tiere viele kleinere Umweltschwankungen oft durch extrem hohe Nachkommenzahlen.)