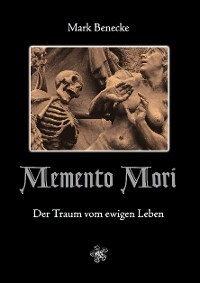Kitabı oku: «Memento Mori», sayfa 5
»Was ist das jetzt für ein Schlaf,
der dich gepackt?«
Die Menschen früherer Kulturen verstanden nicht, was »Tod« bedeutet. Erst unsere naturwissenschaftliche Sicht liefert die Erklärung: Der Körper und / oder das Gehirn arbeiten nicht mehr.
Vermutlich lag es aber nicht an fehlendem Wissen, dass unsere Vorfahren den Tod nicht als biologisches Ereignis begreifen konnten. Vielleicht war auch die Kultur dieser Menschen insgesamt noch nicht so weit entwickelt, dass sie eine Betrachtung des eigenen Todes erlaubte. Das leitet man aus einem Text ab, der vor etwa hundert Jahren bei Ausgrabungen in der ehemaligen Stadt Ninive am Fluss Tigris zum Vorschein kam. In der Bibliothek des Assyrerkönigs Assurbanipal, der etwa 650 v. Chr. lebte, fanden sich Steintafeln, die in Keilschrift die Geschichte von Gilgamesch erzählen – das Gilgamesch-Epos. Der Inhalt dieser Geschichte ist derart überraschend und lässt so weitreichende Rückschlüsse auf die Entwicklung der Menschheit zu, dass ich etwas ausführlicher darauf eingehen möchte.
Lassen wir Kurt Aram, der sich zu Beginn dieses Jahrhunderts mit sehr alten Überlieferungen beschäftigte, vom Gilgamesch-Epos3 berichten:
In der Hauptsache dreht sich der Mythos um die Erschütterung des Gilgamesch, als er zum ersten Mal an seinem Freund Engidu den Tod kennenlernt und verzweifelte Anstrengungen macht, diesem ihm ganz unverständlichen Schicksal zu entgehen. Das Erlebnis ist so neu und unbegreiflich, daß es ganz im Mittelpunkt des Mythos steht, der bis zum Schluß nicht davon loskommt.
Fassungslos steht Gilgamesch vor dem toten Freund:
»Was ist das jetzt für ein Schlaf, der dich gepackt?
Finster siehst du aus und hörst nicht auf mich.«
Doch der erhebt nicht mehr sein Auge.
Gilgamesch berührt sein Herz, doch es schlägt nicht mehr. Da deckt er den Freund zu wie eine Braut.
Einem Löwen gleich brüllt er laut,
Einer Löwin gleich, die ihrer Jungen beraubt ist.
Er wendet sich hin dem Toten zu,
Er rauft sich die Haare.
Engidu, der Freund, ist jünger als Gilgamesch, er hatte schon Träume mit Todesahnungen, die Gilgamesch einfach nicht versteht. Gilgamesch scheut keine Mühe, keine Gefahr, kein Hindernis, um zu seinem Ahnen Ut-napischti zu gelangen, der nicht hat sterben müssen. Vielleicht kann er ihm gegen den Tod helfen. Als der Ahn ihn kommen sieht, sagt er zu sich selbst:
Warum fährt einer im Schiff, der nicht zu mir gehört?
Der da kommt, ist doch gar kein Mensch,
Die rechte Hand eines Mannes hat er doch nicht?
Ungetröstet kehrt er nach Uruk, seiner Heimat, zurück. Nun will er wenigstens wissen, wie es in der Unterwelt zugeht. Er bittet Ea, den einzig menschenfreundlichen unter den altbabylonischen Göttern, Engidus Geist aus der Unterwelt zu beschwören. Folgendes Zwiegespräch entspinnt sich zwischen Gilgamesch und Engidus Geist:
»Sag an, mein Freund, sag an, mein Freund,
Die Satzungen der Unterwelt, die du schautest, sag an.«
»Ich kann es dir nicht sagen, mein Freund, ich kann es dir nicht sagen,
Wollte ich dir die Satzungen der Unterwelt ansagen,
die ich geschaut habe,
Würdest du dich den ganzen Tag weinend hinsetzen müssen.«
»So will ich denn den ganzen Tag mich weinend hinsetzen.«
»Siehe den Leib, den du anfasstest, dass dein Herz sich freute,
Den frisst das Gewürm wie ein altes Kleid,
Mein Leib, den du anfasstest, dass dein Herz sich freute,
Ist dahingeschwunden, ist voll Staub.
In Staub ist er niedergekauert.
In Staub ist er niedergekauert.«
»Fragen wir nach dem Sinn des Ganzen, so faßt ihn die Wissenschaft mit dem etwas kümmerlichen Satz zusammen, daß gegen den Tod eben kein Kraut gewachsen ist.«
Bruchstücke des Gilgamesch-Epos sind bereits aus Urzeiten bekannt. Schon aus der Zeit der ersten babylonischen Dynastie (2000 v. Chr.) gibt es Niederschriften des Epos, und die Überlieferung selbst reicht bis in die vorbabylonisch-sumerische Zeit zurück, also bis in das 6. Jahrtausend v. Chr. Vermutlich ist die Geschichte aber noch viel älter. Der Archäologe Edgar Dacqué verglich das Gilgamesch-Epos mit den ihm bekannten Abbildungen von Maya-Handschriften (und mit Versteinerungen von Wassertieren aus der Zeit der Dinosaurier, dem Mesozoikum). Dacqué meint aus diesem Vergleich in Uta-napišti einen älteren Menschentyp zu erkennen.
Diese Menschen hatten ein anderes Verständnis von der Umwelt als wir: Sie dachten noch nicht »logisch«, also nicht folgerichtig-mathematisch. Deshalb sind auch ihre Erzählungen unlogisch.
Das Naturbild dieser Menschen bezeichnet man als natursichtig-magisch. Dazu noch einmal Kurt Aram:
Gestorben sind diese Menschen natürlich damals so gut wie heute, aber sie wurden sich dessen nicht bewußt, sowenig sich eine Biene dessen bewußt ist, was wir Tod nennen. Über den Zustand, daß einer wie im Schlaf daliegt, ohne wieder wach zu werden, daß Gewürm den Leib frißt wie ein altes Kleid, wehklagt und jammert auch der vorlogische Mensch, sowie der Tod als konkreter Fall ihm vor die Sinne kommt, aber über ihn reflektieren, sich Gedanken über ihn machen, wie wir es tun, vermochte er nicht. Nicht einmal so weit reicht die Reflexion bei Gilgamesch, daß auch ihn dieser Schlaf, aus dem man nicht wiederaufsteht, unter allen Umständen so gut wie Engidu ereilen wird. Er hofft vielmehr bei dem Ahnen, der nicht starb, auch für sich das Mittel gegen den Tod zu finden. Sonst würde er gar nicht die lange, abenteuerliche Fahrt, die immer wieder gerade das bedroht, was er retten will, nämlich sein Leben, bis zum Ende der Welt und über die Wasser des Todes unternehmen.4
Die uralte Legende ähnelt in vielen Punkten einem Traum.
Träume entstehen, »wenn das Großhirn müde ist«, und so folgerte man früher sogar, dass auch das traumähnliche Epos entstand, als die Menschen noch ein anders ausgeprägtes Großhirn hatten. Tatsächlich ist genau dieser Teil des Hirns die wesentliche Fortentwicklung auf dem Weg zum Homo sapiens sapiens – im Großhirn sitzt unser Geist. (Von allen Säugetieren hat der Mensch das verhältnismäßig größte Hirnvolumen. Dies macht uns Menschen nicht besser oder schlechter als alle anderen Lebewesen, ist aber der Grund für unsere derzeitige Macht über viele andere Geschöpfe.)
In unserem hoch entwickelten Denkapparat schlummern aber auch noch diejenigen Hirnanteile, die unsere frühen Vorfahren in sich trugen. Oft unterdrückt das Großhirn die Meldungen aus diesen tieferen Schichten. So erklärt es sich vielleicht, dass wir heute den Tod medizinisch verstehen und – soweit dies eben möglich ist – im Griff haben. Gleichzeitig fürchten wir uns jedoch wie unsere unlogisch denkenden Vorfahren vor dem rätselhaften Ereignis des Todes und vor allem davor, »wie ein altes Kleid vom Gewürm zerfressen« zu werden.
Den Körper für das Jenseits erhalten
Wie alt die Beschäftigung mit dem Tod ist, zeigt der Totenkult im Alten Ägypten. Die Ägypter nahmen zwar ein Weiterleben nach dem Tod ganz selbstverständlich an und fürchteten den Tod deshalb vielleicht nicht so stark wie andere Völker. Sie mumifizierten aber die Leichname, um den Verstorbenen eine schützende Körperhülle zu erhalten. Im Jenseits – so glaubten die Ägypter – erhielten diese dann einen neuen Leib.
Beim Leichenschmaus sang man sogar: »Das schöne Geschick ist eingetreten.« Dennoch grämten sich die Angehörigen aber wohl über den Tod eines lieben Menschen.
Das Vorbild der Mumienmacher und der beteiligten Priester war seit dem Mittleren Reich (um 2050-um 1570 v. Chr.) der tote Osiris. Auf Befehl des Sonnengottes Re war der Totengott Anubis vom Himmel herabgestiegen und hatte Osiris‘ Leiche für die Auferstehung hergerichtet. Die Seele des Mumifizierten war danach nur noch locker an den Körper gebunden.
Die Eingeweide des Verstorbenen wurden bei der Mumifizierung herausgenommen und mit Salz und Natron ausgetrocknet – Salze entziehen dem Gewebe das Wasser. In den Kanopen, besonderen Krügen, wurden die Eingeweide außerhalb des Körpers bestattet. Zur Einbalsamierung des restlichen Körpers dienten Harze, Öle und aromatische Substanzen. Zuletzt wurden Beigaben in den Körper gelegt, zum Beispiel Leinenpäckchen, Wachsfiguren und Nachbildungen von Skarabäuskäfern. Amulette aus Wachs deckten die Einschnittstellen ab, und goldene Körperauflagen schützten Lippen, Zunge, Finger und Zehen. Danach wurde die Leiche mit Unmengen von Leinenbinden umwickelt, in die weitere Amulette gebracht werden konnten. Um der Mumie ein möglichst lebensnahes Aussehen zu geben, wurde sie mit einer Kopfmaske und bemalten Kartonagen versehen. Herodot berichtet, eine komplette Einbalsamierung habe im Schnitt siebzig Tage gedauert. (Die aufwändige Methode eignet sich übrigens im Grunde, um Erbsubstanz zu erhalten. Besonders gegen Austrocknung ist DNA nicht besonders empfindlich, solange nicht andere, störende Einflüsse hinzukommen.)
Der auffallend gute Erhaltungszustand ägyptischer Mumien verleitete europäische Ärzte des Mittelalters bis ins 19. Jahrhundert dazu, Mumia vera aegyptica, Mumienstückchen oder -pulver, als Medikament zu verkaufen. In einigen Apotheken wurde Mumienpulver sogar noch bis zu Beginn des Zweiten Weltkrieges angeboten.
Die Wunderkräfte der Mumia-Substanz hielten sich in Grenzen. Arabische und persische Ärzte, von denen die Heilmethode stammte, hatten übersehen, dass die teerähnlichen Balsamierungsstoffe der Ägypter nichts mit den wirklich heilkräftigen Asphaltprodukten zu tun hatten, denen sie ähnlich sehen. Durch Zufall könnten Quecksilbersalze, die zur Einbalsamierung von Mumien verwendet wurden, tatsächlich einmal als Medikament gegen Krankheiten geholfen haben. Für diese Annahme spricht auch, dass »grüne Mumien« – mit grün werdenden Kupfersalzen behandelte Leichen – nicht zu Mumiapulver verarbeitet wurden. Das Kupfer hätte sich im Gegensatz zum Quecksilber vielleicht nicht für Kuren geeignet.
Ein weitverbreiteter Irrtum besagt, gut erhaltene Leichen, die in der Nähe von radioaktiver Strahlung (vor allem in Kirchen, etwa verursacht durch Bleiplatten) liegen, seien wegen der Strahlung konserviert. Das stimmt nicht. Alle Leichen dieser Art liegen an belüfteten Orten; es handelt sich aus rechtsmedizinischer Sicht um eine gewöhnliche Mumifizierung durch Austrocknung. Die Radioaktivität hat mit dem guten Erhaltungszustand nichts zu tun.
Wie die Ägypter, so hat jede Kultur ihre eigenen Gebräuche im Umgang mit den Toten. In Neuguinea werden die Leichen sogar in eigens entlaubten Baumkronen bestattet. Von einer solchen Baumbestattung berichtet Wulf Schiefenhövel. Der Mediziner, Völkerkundler und langjährige Mitarbeiter des Verhaltensforschers lrenäus Eibl-Eibesfeld lebte zwei Jahre lang (von 1974 bis 1976) im Hochland von Irian Jaya in Neuguinea. Dort, im Dorf Munggona unter etwa hundertachtzig Menschen des Stammes der Eipo, beobachtete er Folgendes:
Der etwa zweiundzwanzig Jahre alte Eipo Ebna stirbt am Nachmittag des 2. Juni 1975. Früh am nächsten Morgen beginnen »etliche Männer und Buben« damit, einen Bestattungsbaum, der etwa fünfhundert Meter vom Dorfkern entfernt wächst, herzurichten. Sie bauen ein Gerüst und schlagen die belaubten Äste ab; in der Krone des Baumes errichten sie ein Sitzgestell. »Kaberob, führender Mann vor allem für den sakralen Bereich des Dorflebens, drängt zur Bestattung«, berichtet Schiefenhövel. »Der Tote wird von den Männern, die die letzten Vorbereitungen am Baum vorgenommen hatten, etappenweise in die Höhe gezogen und so in das BestattungsgesteIl gesetzt, daß das Gesicht in die Bergregion Mangedelo zeigt. Dort befindet sich nach Eipo-Überlieferung das Geisterdorf des Mekdumanang-Klans, zu dem Ebna gehörte. Der Tote wird nun in dieser Stellung festgebunden und mit einer Hülle aus Farn und Kwelilya-Blättern (Pandanus adinobotrys) umgeben, so daß der Leichnam ganz bedeckt ist. Noch stehengebliebene Äste des Bestattungsbaumes werden eingekerbt und abgebrochen.« Vier Tage später, am 7. Juni, entfernen Stammesangehörige die Hülle aus Farn und Blättern, nehmen die Leiche aus dem Sitzgestell und versuchen, die Leiche in ein Tragenetz in der Baumkrone zu bringen. Dies misslingt, und so wird die Leiche an den Fuß des Baumes gereicht, dort in das Netz gebunden und vom Bruder des Toten in den Garten des lebenden Bruders getragen. Dort wird die Leiche erneut in einen Baum – »eine stattliche Casuarine« gezogen und in Hockstellung in der Krone bestattet. »All diejenigen«, schreibt Schiefenhövel, »die mit der Leiche in Berührung gekommen sind, die bereits deutlich Zeichen der Verwesung aufweist, reiben sich nach der Neubestattung die Hände und andere Hautpartien mit Brennesselblättern (beb, Laportea decumana).« Etwa ein Jahr später wird Ebna ein weiteres Mal bestattet. Ebnas Bruder und einige Helfer bringen die nun mumifizierte Leiche in ein eigens errichtetes Gartenhäuschen in einen Holzschrein. Dort skelettiert die Leiche endgültig. Manchmal überführen die Eipo ihre Toten nach dem völligen Zerfall unter überhängende Felsen, wo dann Schädel und Knochen ihre letzte Ruhestätte finden.
Die ewig Ruhelosen
Während also der tote Eipo irgendwann seine letzte Ruhestätte findet, berichten viele Mythen und Märchen von Menschen, die nicht sterben können, obwohl sie sich danach sehnen. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte des Grafen Dracula. Diese erst im 19. Jahrhundert entstandene Sagengestalt gründet sich nicht nur auf den historischen Fürsten Vlad Tepeš, der im 15. Jahrhundert einen Angriff der türkischen Heere mit vielen Kriegslisten zurückschlug. Auch alte Gerüchte und Gedichte über Vlad sowie die unterschwellig sexuelle Bedeutung, die den Vampirgeschichten in viktorianischen Zeiten innewohnte, trug zu ihrem Entstehen bei.
Die ursprüngliche Idee von Vampiren, die auf der Suche nach Opfern einsam umherstreifen, geht vermutlich auf eine wesentlich lebensnähere, wenn auch weniger romantische Beobachtung zurück. Diese Beobachtung können heute nur noch wenige Menschen machen, weil unsere Kultur den direkten Kontakt mit Leichen fast vollkommen vermeidet. Früher wurden Leichen nahezu immer bei Raumtemperatur aufgebahrt, damit Angehörige und Bekannte von der oder dem Toten Abschied nehmen konnten. Vor der Aufbahrung richteten Bestatter oder Verwandte den toten Körper her: Die Leiche wurde je nach ihrem Zustand gekämmt, geschminkt und angekleidet. Wenn sich die Sehnen zusammengezogen hatten und die Gliedmaßen gekrümmt waren, streckten so genannte »Leichenweiber« etwa die Knie mit aller Kraft durch und beschwerten sie mit einem Stein. Auch den bei vielen Toten geöffneten Mund pressten sie zu und klemmten ein Buch unter das Kinn. Vor der endgültigen Aufbahrung entfernten sie diese Hilfsmittel. Sehr häufig konnte man zu einem späteren Zeitpunkt beobachten, dass die Beine unvermittelt wieder zusammenklappten oder sich der Mund schmatzend »wie bei einem Vampir« öffnete. Der Arzt Christoph Hufeland bezeugt diese Vorgänge. Mehr als einmal dürften diese Phänomene dazu geführt haben, dass eine Leiche noch einmal gründlich untersucht wurde. Das tat man allerdings nicht aus Furcht vor Gespenstern, sondern um sicherzustellen, dass der oder die Verstorbene nicht scheintot war.
Besonders im 19. Jahrhundert war die Angst vor dem Scheintod sehr groß, und ganze Bücher beschäftigten sich mit der Frage, wie man einen Scheintoten richtig ins Leben zurückholen muss. Die Rezepte reichten vom »Einblasen von Luft in den Mund« über das »Öffnen einer Ader« bis zu »Senfwickeln mit Spanischer Fliege«. Bei solchen Rettungsversuchen musste man den Körper zwangsläufig bewegen. Dabei sahen die erstaunten Zuschauer gelegentlich, dass der oder dem Toten eine blutige Flüssigkeit aus dem Mund floss; die gleiche Beobachtung machen noch heute die Rechtsmediziner, wenn sie Leichen routinemäßig auf Messerstiche im Rücken untersuchen und sie zu diesem Zweck aufsetzen.5
Eine andere Erklärung dafür, weshalb blutrünstige Vampire erfunden wurden, liefert David Dolphin, Chemieprofessor an der Universität von British Columbia. Nach Dolphins Meinung war eine erbliche Krankheit, die im späten Mittelalter gehäuft in osteuropäischen Adelsfamilien auftrat, der Ursprung der Vampirsagen. Durch die verbreiteten Eheschließungen zwischen Verwandten wurden bestimmte veränderte, krankmachende Erbanlagen immer wieder zusammengebracht und so verstärkt ausgeprägt. Es handelt sich um die Krankheit namens Porphyrie oder Porphyria erythropoetica, bei der sich unter anderem die Oberlippe zurückzieht, während gleichzeitig die Haut rissig wird und blutet. Die Krankheit äußert sich besonders stark, wenn der oder die Erkrankte dem Sonnenlicht ausgesetzt ist. Ärzte des Mittelalters sollen den Kranken geraten haben, in abgedunkelten Räumen, also daheim in ihren Schlössern zu bleiben und zum Ausgleich für den eigenen Blutverlust Tierblut zu trinken. Jahrhunderte später behandelte man Porphyriekranke häufig mit dem Aderlass. Um den Lebenssaft zu ersetzen, mussten die armen Menschen, wie schon ihre Leidensgenossen im Mittelalter, Rinderblut trinken.
Auf einem Bild J.-F. Gueldrys aus dem 19. Jahrhundert, das den Titel Les buveurs de sang (Die Bluttrinker) trägt, ist das Leid der Porphyriekranken festgehalten. Man sieht einen Schlachter, der einem von seinem Kollegen gefesselten Rind warmes Blut aus dem Hals entnimmt, in einen Trinkbecher füllt und der ersten Kranken in einer Reihe von sechs oder sieben weiteren Unglücklichen reicht. Der Ausdruck des Ekels und Entsetzens, aber auch der Schicksalsergebenheit auf den Gesichtern der Geplagten ist offensichtlich. Dass Porphyriker blass sind und einen veränderten Zahnwuchs, dabei aber zugleich rote Zähne und Lippen haben können, macht verständlich, warum man die Kranken einst für Vampire gehalten hat.
Eine Übersicht über die Merkmale, die Tote wie Vampire erscheinen lassen können, hat 1997 der englische Naturforscher David Pescod-Taylor in der Zeitschrift Bizarre zusammengestellt. Pescod geht davon aus, dass eine ganze Reihe von Hautkrankheiten und so genannten späten Leichenerscheinungen wie Fäulnis, Hautablösung und -vertrocknung, Zahnausfall und Mumifizierung einzeln oder gemeinsam zu den erschreckenden Trugschlüssen geführt haben. (In den Jahren 2000 und 2001 sammelte die Transylvanian Society of Dracula auf Kongressen in Rumänien weitere spannende Erklärungen um Vampirlegenden, siehe http://tsdracula.org. Literatur zum Thema gibt es vom Autor ebenfalls: Vampire unter uns! Band I Rh.pos. & Band II Rh.neg., erschienen in der Edition Roter Drache).
Auch heute würde manch einer eine schmatzende Leiche, die im Sarg verschiedene Körperhaltungen einnimmt und aus deren Mund Blut rinnt, für einen Vampir halten. Genauso verständlich ist es, dass reiche, unnahbare Adelige, die mit geschürzten Lippen Blut tranken, Anlass zu Gerede gaben. Der Arzt Christoph Hufeland war um 1800 einer der Ersten, die diesem Irrglauben entgegentraten.
Der eigentliche Vampirmythos wurde hierzulande erstmals bekannt, als 1733 aus dem Dorf Servien an der damaligen türkischen Grenze von Toten berichtet wurde, die nachts aus den Gräbern stiegen und Blut saugten. Buchstäblich ganz Deutschland war beunruhigt und wurde – schon damals – von der Presse auf dem Laufenden gehalten. Schließlich ließ der Kaiser selbst die fraglichen Leichen ausgraben. Sie wurden durch ihr Herz gepfählt, geköpft und anschließend verbrannt – man wollte wirklich sichergehen. Ein im Auftrag des Kaisers erstelltes schriftliches Gutachten des Forschers Beyer wurde leider geheim gehalten und ist bis heute verschollen. Michael Ranft, der diesen Fall als Zeitzeuge erlebte, war aber fest davon überzeugt, dass es sich bei den vermeintlichen Vampiren um Scheintote handelte.
Er beschrieb die Erlebnisse dieser Umherwandelnden schon 1734 so:
Und wenn nun dieser erwachte Scheintote ein zärtlicher Haus- und Familienvater ist, wenn er nur mit höchster Anstrengung seiner kaum wiederkehrenden Lebenskraft der Gruft entging und kaum bis zu den Seinigen auf schwachen Füßen hinzuschwanken im Stande war – wenn dieser Ohnmächtige nun wahrnimmt, wie seine urplötzliche Rückkehr aus dem Gebiete der Gräber nichts als Entsetzen, Tod und Verderben unter den geliebten Seinigen verursacht: Wird er nicht teilnehmend selbst wieder dahinsinken und so hilfsbedürftig und verlassen und hilflos, wie er ist, vor Schmerz und Trauer auf der Stelle ebenfalls eine Beute des Todes sein, dem er als Scheinleiche nur zu seinem und der Seinigen Verderben auf kurze Zeit entgangen war?
Die literarische Figur des Grafen Dracula stammt aus Bram Stokers Buch The Undead von 1897. Als Vorlage für den Roman dienten zwei Bücher, die als Produkt einer verregneten Nacht im Jahr 1817 am Genfer See entstanden waren: Mary Shelleys Frankenstein (Shelley war damals gerade zwanzig Jahre alt) und Polidoris The Vampyre. Bram Stoker bezog sich jedoch im Gegensatz zu seinen Vorbildern Shelley und Polidori auf den rumänischen Prinzen der Walachei, Fürst Vlad Tepeš (»Vlad der Pfähler«). Vlad lebte im 15. Jahrhundert und war durch seine erfolgreichen und listig-grausamen Verteidigungskämpfe gegen ottomanische Soldaten berühmt geworden. Nachdem er in seiner Jugend bei den Türken gefangen war, regierte er mit exilbedingten Unterbrechungen von 1448 bis 1476. Sein Wissen um den Feind machte ihn im Krieg umso erfolgreicher.
Vlads Vater (Vlad der Dritte, Vlad Dracul) war ein »Dracul«, ein Ritter des Drachenordens des Heiligen Römischen Reiches. Da die Endung »-a« so viel wie »Sohn von« bedeutet, erhielt Vlad der Vierte den Namen »Dracula«, Sohn des Dracul. Im Volksmund wurde Vlad Dracul weniger würdevoll und wohl durch die Ähnlichkeit des Wortes mit »dracul« für »Teufel« mit dem Bösen in Verbindung gebracht. Immerhin sind von Vlad junior alle Gräueltaten überliefert, die ein Feldherr gegen seine Feinde verüben kann. Heute wissen wir aber, dass viele dieser Geschichte Lehrmärchen waren, die über die Stadt Buda an den Vatikan und von dort nach Zentraleuropa überliefert wurden.
In den Gebieten des heutigen Rumänien lebte die Überlieferung von Draculas Taten noch zu Bram Stokers Zeiten (und bis heute) fort. Der Theaterautor nutzte den scheinbar wahren geschichtlichen Hintergrund für seine Vampirgeschichte, und erst er gab dem Urvater aller Filmvampire seinen Namen: Dracula.
Dass der Glaube an Dracula auch heute noch erstaunlich verbreitet ist (oder von den örtlichen Tourismusbehörden gezielt gefördert wird), zeigt eine Meldung der rheinischen Tageszeitung Express, die beispielsweise unter der Schlagzeile »Dracula wieder aktiv« schrieb: »Für die einen sind es schlichte Feuchtigkeitsflecken auf Steinen, für die anderen grinst das Gesicht des Grafen Dracula von der Schloßmauer.
Echte Vampire
Eine Sorte von Vampiren gibt es wirklich. Sie leben aber nicht in Osteuropa, und sie tragen den putzigen Beinamen »Kleinfledermäuse«. Drei der Vampir-Fledermausarten ernähren sich tatsächlich durch Blutsaugen. So schleicht der nur zehn Zentimeter lange Gemeine Vampir Desmodus rotundus nachts auf allen vieren an seine Opfer (Säugetiere) heran und schneidet ihnen mit seinen messerscharfen Zähnen die Haut ein. Dann streckt er seine Zunge so weit wie möglich heraus und rollt sie seitlich nach unten zu einer Röhre. Durch diese spuckt er seinen Speichel, der gerinnungshemmende Substanzen enthält, in die Wunde und saugt Blut. Der Gemeine Vampir benötigt nur gelegentlich eine Blutmahlzeit von etwa einer Stunde, die dem Wirtstier kaum schadet, es sei denn, dass die Fledermaus Krankheitserreger, zum Beispiel Tollwut, verschleppt. Namensvettern der sogenannten Echten Vampire sind unter anderem der Kubanische Blütenvampir und der Jamaika-Fruchtvampir. Letzterer ernährt sich, wie der Name schon sagt, von Früchten und zeichnet sich durch ein wenig furchteinflößendes Merkmal aus: Er ist eines der Säugetiere mit der schnellsten Verdauung.
Ort der ›Erscheinung‹ ist ein Schloß im rumänischen Sighišoara, wo im 15. Jahrhundert der walachische Fürst Vlad Tepeš wohnte.« (Express, 4. Mai 1996) Der Autor hat den Ort besucht – es handelt sich in Wahrheit um eine Zeichnung des Fürsten, die unter dem Putz eines Restaurants auf der alten Mauer gefunden wurde.
Auch in Deutschland hört man gelegentlich von Menschen, die sich scheinbar wie Vampire verhalten. Fritz Haarmann und Peter Kürten, die bekanntesten deutschen Serienmörder, stillten ihren Blutrausch am Hals der Opfer. Beide mordeten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Kürten war vom »Rauschen des Blutes« seiner erstochenen Opfer hingerissen; er trank 1930 im Düsseldorfer Hofgarten erregt das Blut eines Schwanes, dem er den Kopf abgeschnitten hatte. Fritz Haarmann behauptete stets, er habe seine Opfer, meist Jugendliche, im Liebestaumel am Hals »totgebissen«. Nachweisen oder widerlegen konnte man ihm das »Totbeißen« nicht, da Haarmann die Leichen zerlegte und beseitigte. – Auch Blätter wie die Münchner Abendzeitung nutzen das Stichwort »Dracula« und melden unverdrossen: »Ein fünfundsiebzig Jahre alter Mann ging mit seinem Dachshund Jockei in Berlin spazieren, als ihn ein dreiundvierzig Jahre alter Mann mit dem Ruf ›Ich bin Dracula!‹ in den Hals biß. Der offenbar betrunkene Angreifer konnte überwältigt werden. Eine Stunde, nachdem der Hundehalter wieder nach Hause gegangen war, starb er – an Herzversagen.« (AZ, 6. April 1995)
Jenseits der Anekdoten sticht in der Geschichte von Graf Dracula mehr als alles die Last des ewigen Lebens und Umherirrens hervor; das nicht endende Leben macht die gräfliche Kreatur vor allem zutiefst unglücklich. Dracula ist dabei kein Einzelfall. Die meisten alten Geschichten von Untaten, einschließlich Poltergeistern und Zombies, sind beherrscht von Schwermut und Leid.
Auch der Fliegende Holländer ist ein unglückliches, einsames Wesen, das sich nach dem Tod sehnt. Der namenlose Kapitän soll um 1680 zu den ostindischen Niederlassungen Hollands bei Batavia gesegelt sein. In der Überlieferung war er ein guter Seemann, aber ein böser Mensch. Auf der Rückreise nach Holland tobte in der Nähe des Kaps der Guten Hoffnung ein Sturm, der Segel und Ruder des Schiffes beschädigte. Daher gelang es dem Kapitän trotz all seiner Kunst nicht, das Schiff um das Kap zu segeln. In seinem Zorn flüsterte ihm der Teufel ein, dass Gott selbst den Seemann an der Kapumsegelung hindere. Der Kapitän schwor daraufhin, dass er Gott trotzen und niemals den Kurs wechseln wolle, auch wenn er in alle Ewigkeit weitersegeln müsse. Seitdem ist der Fliegende Holländer, dessen Schwur als Strafe wahr wurde, unzählige Male gesehen worden. Zuletzt soll der einsame Ostindienfahrer im September 1942 gesichtet worden sein, als er von Kapstadt aus in die Tafelbucht fuhr. Davor will der englische König Georg V. als Leutnant nicht nur das Schiff des Fliegenden Holländers erblickt, sondern auch einen altmodisch gekleideten Herrn, der am Heck des fremden Seglers stand, gesehen haben.6
Viele Ungeheuer spiegeln auch zeittypische Ängste und Begebenheiten wider: Das Besondere an Viktor Frankensteins Leid ist, dass er ursprünglich von den Schriften der alten Ärzte und Naturkundler Cornelius Agrippa von Nettesheim, Albertus Magnus und Paracelsus zur Suche nach einem Lebenselixier angeregt wird. Er verwirft dann die Lehren dieser ihm »vorwissenschaftlich« erscheinenden Männer und wendet sich beim Studium an der Universität Ingolstadt den modernen Naturwissenschaften zu.
Die alten Ärzte wurden zu Shelleys Zeiten angesichts des Aufkeimens der modernen Naturwissenschaften gerne hart gerügt. So schrieb Christoph Wilhelm Hufeland, ein Zeitgenosse von Mary Shelley, über Paracelsus, der von etwa 1520 bis 1540 als Arzt arbeitete: »Aber er hatte die Gabe, seinen Unsinn in einer so dunklen und mystischen Sprache vorzutragen, dass man die tiefsten Geheimnisse darinne ahndete und noch hie und da darinnen sucht und daß es wenigstens ganz unmöglich war, ihn zu widerlegen.« Eine herbe Abfuhr an die alte Medizin, wie sie auch heute noch zu hören ist.
An dieser Schwelle von der altüberlieferten Heilkunst zum modernen Naturverständnis steht Frankenstein. Die ursprüngliche Idee – Leben zu erschaffen – behält Frankenstein aber auch nach seiner inneren Abkehr von den alten Ärzten bei; er benutzt vielmehr die modernen Naturwissenschaften, um seinen ursprünglichen (Alp-)Traum zu verwirklichen.
Genau auf dieser Ebene zwischen Wissen, Wahn und Wirklichkeit liegt auch der heutige Wunsch nach Unsterblichkeit. Viktor Frankenstein musste schmerzlich erkennen, wohin ihn dieser Wunsch geführt hatte. Als ein Schiff den verzweifelten Forscher kurz vor dessen Tod am Nordpol an Bord nimmt, erwähnt der Kapitän, dass auch er auf der Suche nach »der Herrschaft über die elementaren Feinde der Menschheit« sei, also auf der Suche nach einem Mittel gegen den Tod. Frankenstein antwortet ihm darauf: »Unseliger! Haben Sie aus diesem Giftbecher getrunken? Hören Sie mich an – ich will Ihnen meine Geschichte enthüllen, und Sie werden den Becher von Ihren Lippen schleudern!«
Es ist kein Zufall, dass alle Schöpfer untoter Figuren diese als ewig Gestrafte darstellen. Denn was wäre das ewige Leben anderes als Wiederholung, Leere, Müdigkeit und Langeweile? Was biopsychologisch höchst wahrscheinlich ist, machen Schriftsteller damit zur Gewissheit: Begrenzt nicht der Tod das Leben, so verliert es seinen Wert. Dass Künstler dies stärker empfinden, mag daran liegen, dass sie sich in ihren manchmal extremen Leben freier mit dem Sterben auseinander setzen müssen als viele andere Menschen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.