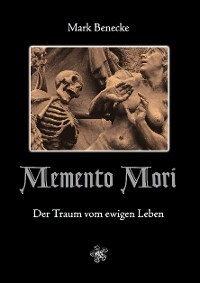Kitabı oku: «Memento Mori», sayfa 4
Artensterben und Umweltveränderung
Viele Menschen sind besorgt über das Aussterben von Tierarten als Folge von Umweltveränderungen, wie sie oben beschrieben wurden. Das Artensterben an sich ist jedoch für Biologen nichts Ungewöhnliches. Seit es Leben gibt, verschwinden manche Arten unwiderruflich, während andere neu entstehen. Von allen jemals entstandenen Arten (insgesamt fünf bis fünfzig Milliarden) lebt heute nur noch jede tausendste. Zurzeit nimmt die Geschwindigkeit, mit der Arten aussterben, jedoch vermutlich stark zu: Die derzeit aussterbenden Arten sind an die neuen, oft von Menschen geschaffenen Umweltverhältnisse nicht mehr angepasst.
Ewiger Schlummer
Nicht nur Tiere, auch Pflanzen können in Ruhestadien leben oder schlummern. Pflanzen verkapseln jedoch nur ihre Samen, während einfach gebaute Tiere als Ganzes ins Ruhestadium übergehen können (zum Beispiel Amöben als »Zysten« oder Moostierchen als »Tönnchen«). Die Höchstlebensdauer von Pflanzensamen ist dabei nicht minder erstaunlich als die Überlebensleistungen verkapselter Tiere. So können Nachtkerzensamen länger leben als manche Menschen – sie werden bis zu achtzig Jahre alt. Auch Mais, Zwiebeln, Sellerie und Tabak bringen Samen hervor, die immerhin ein halbes menschliches Leben begleiten können. Die bislang bekannten »Bestleistungen« von Pflanzen, die nach überstandenen Samenruhen wieder erblühten:
| Wiesenklee | 100 Jahre |
| Kartoffel | 200 Jahre |
| Indische Lotosblume | 250 Jahre |
| Kriechender Hahnenfuß | 600 Jahre |
| Feldspark7 | 1700 Jahre |
Nun übertreffen allerdings die lebenden Pflanzen – in krassem Gegensatz zu lebenden Tieren – ihr eigenes Ruhestadium bei weitem. 400 Jahre alte Kirschbäume, 900 Jahre alte Rotbuchen, 1900 Jahre alte Linden und 4600 Jahre alte Borstenkiefern gibt es wirklich. Die Eiche, deutscher Inbegriff für Knorrigkeit und Beständigkeit, bringt es auf 1300 Jahre. Diese Höchstalter sind natürlich die Ausnahme. Eine »normale« Eiche wird nicht viel älter als 200 bis 300 Jahre und eine gewöhnliche Rotbuche nicht älter als 140 Jahre.8
Pflanzen leben also oft länger als ihre Ruhekapseln. Außerdem kann die lebende Pflanze zahlreiche weitere Keimzellen herstellen, das Ruhestadium nicht.
Auch ein Tier, das sich in sein Ruhegehäuse zurückzieht oder sich komplett in ein solches umbildet, bringt in dieser Zeit keine Nachkommen hervor.
Auch vor unserer Zeit gab es Perioden großer Umweltveränderungen, in deren Folge im Schnitt 65 Prozent aller Arten starben. Eine dieser Katastrophen trat kurz vor der »Kambrischen Explosion« ein. Eine unbekannte Ursache hat damals, auf der Grenze vom Präkambrium (vor sechshundert Millionen Jahren) zum Kambrium (vor etwa fünfhundertsechzig Millionen Jahren), fast das gesamte Leben der Erde ausradiert und eine komplette Lebenswelt, die Biophyten, vernichtet. Die Biophyten, vermutlich weder Pilze noch Pflanzen, noch Tiere, kennen wir nur noch aus präkambrischen Gesteinsabdrücken. Wir sehen in den Fossilien dieser fernen Zeit »Seefedern« oder »scheibenförmige Wurmtiere«, wissen aber nichts über die Biologie dieser Lebensformen.
Mit dem Kambrium verbreiteten sich die Vorläufer der heutigen Lebewesen sehr rasch. Daher die Bezeichnung »Kambrische Explosion«. Ob es zuvor eine wirkliche Explosion auf der Erde gab, die das Massensterben bewirkte, wissen wir nicht. Weitere Massensterben gab es beispielsweise im Mesozoikum vor etwa zweihundertsechzig Millionen Jahren, nach dem Trias vor etwa zweihundertacht Millionen Jahren und während des Übergangs von der Kreidezeit zum Tertiär vor etwa fünfundsechzig Millionen Jahren.
David Raup, Professor für Geophysik an der Universität Chicago, vermutet, dass Meteoriteneinschläge der Grund für diese Katastrophen waren. Im Abstand von etwa sechsundzwanzig Millionen Jahren, so glauben Raup und viele andere Forscher, können erdgeschichtliche Massensterben belegt werden. Als der Physiker Luis Alvarez aus Berkeley im Jahre 1980 erstmals die Idee des Massensterbens durch Meteoriteneinschläge veröffentlichte, glaubte ihm niemand. »Es war«, berichtet Raup, »als hätte jemand behauptet, die Dinosaurier seien von kleinen grünen Männchen aus einem Raumschiff erschossen worden.« Der verblüfften Ablehnung folgte aber rasch eine ernsthafte Diskussion. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass riesige, bis zu hundert Kilometer weite Krater genau aus der Zeit dreier der fünf großen erdgeschichtlichen Massensterben stammen. Vielleicht erweisen sie sich eines Tages als Zeugen der vermuteten Meteoriteneinschläge.
Das Massensterben ist aber nicht nur eine Katastrophe, sondern es hat auch einen biologischen Nutzen. So verficht David Raup in seinem Buch Extinction. Bad Genes or Bad Luck (1991) die Idee, dass die treibende Kraft der Evolution durch stufenweise Anpassung neuer Arten an die Umwelt (adaptive Radiation) nur deswegen möglich war und ist, weil nach Massensterben regelmäßig Platz für die neuen, besser angepassten Arten entsteht. Ohne Massensterben, ist sich Raup sicher, wäre die enorme Artenvielfalt auf der Erde nicht zu verstehen.
Für manche Lebewesen sind extreme Umweltveränderungen also Krisen oder Katastrophen, für andere gerade das Gegenteil. Besonders stark betroffen von katastrophalen Umweltveränderungen sind aber immer die von uns so genannten unsterblichen Tierarten, weil sie vollkommen gleichartige, nicht angepasste Nachkommen haben. Andere Lebewesen überleben Umweltveränderungen, weil sie ein Leben mit Sex führen.
Sex wird erfunden
Die geschlechtliche Fortpflanzung ist nicht nur wegen der damit verbundenen sinnlichen Erfahrungen von Vorteil. Eigentlich sind diese auch nur ein biologischer Trick, um Lebewesen dazu zu bringen, sich der biologisch vorteilhaften Arterhaltungsmethode zu bedienen.
Der eigentliche Witz der sexuellen Fortpflanzung besteht darin, dass die durch sie entstehenden Nachkommen nicht mit einem Elternteil identisch sind, sondern sich sowohl untereinander als auch von den Eltern unterscheiden. Bei Menschen ist das äußerlich gut zu erkennen. Bei anderen Lebewesen, deren Aussehen uns nicht vertraut ist, fällt es oft nicht auf. Wenn wir solche Tiere, zum Beispiel Fische, einem Test unterziehen, können wir deren Unterschiede aber trotzdem feststellen, zum Beispiel mit einem »genetischen Fingerabdruck«.
Betrachten wir eine einbrechende Eiszeit: Sinkt die Wassertemperatur eines Meeres dabei zum Beispiel um zehn Grad Celsius, so droht den meisten darin lebenden Fischen der Erfrierungstod. Einige Fische jedoch überleben den andauernden Kälteeinfluss. Sie tragen eine Eigenschaft in sich, die mit bloßem Auge nicht sichtbar ist: die Fähigkeit, ein Gefrierschutzmittel herzustellen. Die Frostschutzflüssigkeit ist anders zusammengesetzt als die Mittel, die im Winter dem Kühlwasser von Autos zugesetzt werden. Solche technischen Flüssigkeiten enthalten Verbindungen, die Alkohol ähneln, während der tierische Frostschutz durch ein Eiweiß (Protein) funktioniert. Man nennt es einfach Frostschutzprotein, abgekürzt FSP. Die Natur hat tatsächlich gefriergeschützte Fische hervorgebracht. Sie leben in den Eismeeren der Welt und zeugen Nachkommen, die sich immer noch voneinander unterscheiden. Es findet aber eine begünstigende Auswahl der Gefrierschutzeigenschaft statt. Kältefeste Fischeltern vererben das Gen für das Gefrierschutzmittel (meist) an ihre Kinder. Die Kinder sind deshalb besonders kältefest.
Gelegentlich besitzen aber einige Abkömmlinge der »Frostschutzeltern« keinen oder einen anders zusammengesetzten Frostschutz. Wäre es in diesem Moment nicht praktisch, wenn alle Nachkommen völlig gleich wären, so wie die Nachkommen der unsterblichen Räder- und Kugeltiere? So würde doch sichergestellt, dass der erwünschte Schutz nicht verloren ginge.
Nein, es wäre nicht praktisch. Eine Zeit lang könnten sich die gefriergeschützten Tiere auf diese Art zwar schnell vermehren. Aber die nächste Umweltveränderung kommt bestimmt, und an sie könnten sich die identischen Tiere ohne Sex nicht mehr anpassen. Deshalb ist es wichtig, dass stets einige Nachkommen genetisch ein wenig abgewandelt sind. Nur so können Erbeigenschaften auf Probe entstehen, die vielleicht – irgendwann einmal nützlich sein werden. Das gilt auch für Menschen.
Als Erste erkannten Charles Darwin und Alfred Russel Wallace diese Zusammenhänge. Am 1. Juli 1858 ließ Darwin vor der Königlichen Linne-Gesellschaft in London (Linnean Society of London) die Grundzüge der Evolutionstheorie vorlesen, die auf zwei Erkenntnissen beruht. Erstens: Alle Arten neigen zur Bildung leicht abgewandelter Einzeltiere, das heißt Mutanten (entweder durch Sex oder, bei unsterblichen Tiere in viel geringerem Maß, durch die in allen Lebewesen auftretenden, plötzlichen, kleinsten chemischen Veränderungen der Erbsubstanz). Zweitens: Auf Mutanten wirken im Laufe vieler Generationen auslesende Umwelteinwirkungen. Dadurch passen sich Arten der Umwelt an. Jedes neue Lebewesen einer Art kann dieser biologischen Fortentwicklung etwas Neues hinzufügen und ist damit die kleinste Einheit der natürlichen Auslese. Nur weil sich manche Mitglieder einer Art von anderen unterscheiden, kann sich das Leben fortentwickeln, an veränderte Umweltverhältnisse anpassen und neue Lebensräume für sich erschließen.
Sexuelle Tätigkeit ist dazu im Grunde nicht zwingend notwendig: Mutanten können auch, wie beschrieben, bei nichtsexuellen Zellteilungen durch plötzliche Mutationen entstehen. Der große Vorteil der Sexualität liegt aber darin, dass ständig und häufig neue Zusammenstellungen verschiedener Erbeigenschaften erprobt werden. So bleibt die Umweltanpassung auch bei Wesen erhalten, die nur wenige Nachkommen haben. Aber auch Tiere mit nach wie vor hoher Nachkommenzahl nutzen den Vorteil sexueller Vermehrung: Wasserflöhe etwa schalten bei für sie schlechten Umweltbedingungen von der Jungfernzeugung (nichtsexuell, identische Nachkommen) zeitweise auf die sexuelle Fortpflanzung um. Hier wird die Idee des Sex besonders klar: Umweltanpassung.
Sogar manche Bakterien bedienen sich der aktiven Vermischung von Erbgut als geeigneten Mittels zur genetischen Zukunftsvorsorge. Die scheinbar einfache Form des Bakteriensex besteht darin, über kurzerhand gebildete Zell-zu-Zell-Brücken kleine DNA-Stücke mit einem anderen Bakterium derselben Art auszutauschen und sich später mit der so veränderten Erbinformation zu vermehren.
Mehrzellige Lebewesen haben es da schwerer. Sie können einzelne ihrer Zellen nicht mit denen anderer Mitglieder ihrer Art durch Brücken verbinden. Daher setzen Mehrzeller auf ihre Nachkommen und kombinieren die Erbsubstanz von Spermien und Eizellen.
Um die Art mit genügender genetischer Vielfalt auszustatten, werden manche mehrzelligen Organismen, beispielsweise manche Fadenwürmer und Schnecken, sogar zu Zwittern, die sowohl Eizellen als auch Spermien in sich bilden. Diese nutzen sie zur gegenseitigen Befruchtung (und damit vorbeugender Neukombination von DNA), in Notfällen aber manchmal auch zur Selbstbefruchtung.
1 Erste Zellen sind vor etwa drei Milliarden Jahren entstanden, was deren versteinerte Abbilder belegen. In der Zeit davor, also in höchstens einer Milliarde von Jahren, entstanden Biobausteine. Wenn man die gesamte Zeit, seit es lebende Zellen gibt, einem Jahr gleichsetzt, sind menschenähnliche Wesen erst an Silvester um Viertel nach drei nachmittags auf der belebten Erde erschienen. Vor ihnen, im Oktober dieses einen Jahres, gab es bereits alle großen Gruppen wirbelloser Tiere, und um den 17. Dezember herum starben die Dinosaurier aus.
2 Dekker, H. (1913) Alexis Carrelund die Züchtung von Geweben erwachsener Warmblüter außerhalb des Organismus, Kosmos Handweiser für Naturfreunde 10 (1), S. 57.
3 Ebd., S. 61.
4 Nemilow, A. W. (1927) Leben und Tod, Leipzig, S. 99.
5 Die Beobachtung, dass Zellen das Alter des sie umgebenden Körpers kennen, hat man nicht nur an Fibroblasten, sondern auch bei Lungen-, Haut-, Leber-, Arterienwand-, Augenlinsen- und T-Zellen (einer bestimmten Zellsorte des Immunsystems) gemacht. Man benutzte sicherheitshalber Gewebe von abgetriebenen Föten bis hin zu Zellen neunzigjähriger Greise. Es bestätigte sich, dass alle Zellen – auch losgelöst von ihren ursprünglichen Nachbarzellen – ihr Zellalter kennen. Zellen aus jungen Körpern vollführten bis zu sechzig Teilungen, Gewebe von älteren Menschen teilte sich mit zunehmendem Lebensalter der Spender immer seltener.
6 Meine Rechnung: Ein Zuckerwürfel wiegt drei Gramm, das entspricht 1022 Zuckermolekülen (Zuckerteilchen). Die Meere enthalten insgesamt 1021 Liter Wasser. Das verrührte Würfelchen ergibt für jeden Liter Meerwasser zehn und damit pro Tasse zwei Zuckerteilchen.
Aus einem 1933 gehaltenen Vortrag des deutschen Chemikers Otto Hahn, des Mitentdeckers der Kernspaltung, stammt ein weiterer schöner Vergleich, der die Größenordnungen in der Botenstoff- und Teilchenwelt veranschaulicht: »Stellen Sie sich eine gewöhnliche Glühbirne vor. In dieser herrscht ein Vakuum. Würde man ein so winziges Loch in die Glühbirne bohren, dass pro Sekunde eine Million Luftmoleküle in das Vakuum gesaugt würden, so würde es mehr als 100 Millionen Jahre dauern, bevor im Inneren der Glühbirne derselbe Luftdruck (und damit dieselbe Luftteilchenzahl) herrschte wie auf der übrigen Erde.«
7 Sparke sind Adler-Blumenpflanzen (Spergulaceen), eher kleine, oft krautförmige, zweikeimblättrige Pflanzen. Die Samen sind kreisrund und ringsum geflügelt.
8 Die vermutlich älteste lebende Pflanze ist laut dpa eine Huon-Kiefer im tasmanischen Bergland, die möglicherweise dreißigtausend Jahre alt ist.
ZWEITER TEIL
Niemand will sterben

„Wir sind alle sterblich und werden es bleiben. Was die medizinische Forschung erreicht, ist nichts weiter als eine Veränderung in der Statistik der Todesursachen.“
Max Delbrück
Am Ende des Tunnels sah ich ein Licht
Viele Menschen sind davon überzeugt, dass es nach dem Tod weitergeht. Dafür scheint es Beweise zu geben. Menschen, die dem Tod knapp entkommen sind, berichten von Bildern, die deutlich zu zeigen scheinen, dass der Tod nur eine Pforte in eine unbekannte Zukunft ist. Meistens ist von einem »dunklen Tunnel« die Rede, an dessen Ende ein Licht aufscheint. Die Berichte ähneln sich in verblüffender Weise:
Ich fühlte mich leicht und glücklich. Als ich auf das verheißungsvolle Licht zuging, war ich zeit- und schwerelos. Ich sah verschwommen die Umrisse einer Person. Kurz bevor ich an meinem Ziel ankam, hörte ich meinen Namen. Als ich wieder zu mir kam, lag ich in einem Krankenbett und schaute in die Gesichter meiner Angehörigen. Ich konnte und wollte noch nicht sprechen. Den Keim des Glückes und Friedens, den ich in den Minuten auf dem Weg ins Jenseits erlebte, trage ich noch immer in mir. Mein Leben hat sich verändert. Ich habe keine Angst mehr zu sterben.
Solche Schilderungen sind nicht neu. Schon der römische Rechtsanwalt Apuleius (geb. um 125 n. ehr.) beschrieb in seinem Roman Der goldene Esel ein ähnliches Erlebnis: »Ich ging bis zur Grenze des Todes. Um Mitternacht sah ich die Sonne mit hellweißen Lichtstrahlen, vor die unteren und oberen Götter trat ich hin, von Angesicht zu Angesicht, und betete sie aus nächster Nähe an.«
Ein weiteres, häufig wiedergegebenes Szenario ist dieses:
Ich spürte, wie ich mich von meinem Körper löste. Langsam stieg mein Geist in die Höhe, und ich konnte auf meinen eigenen Körper herabschauen. Ich sah alles wie durch einen Schleier; sogar meine Angehörigen konnte ich erkennen, die um mich herumstanden. Ich war nicht verwundert, sondern seltsam entfremdet. Alles war verändert, aber dennoch wirklich.
Erlebnisse dieser Art scheinen mit der heutigen naturwissenschaftlich geprägten Sicht der Welt nicht zusammenzupassen. Doch Naturwissenschaftler und Mediziner erklären solche Erfahrungen ohne den Glauben an Übersinnliches. Sie vertrauen einer Deutung, die ihnen wissenschaftlich schlüssiger, das heißt belegbarer erscheint. (Das tun sie stets so lange, bis jemand eine überzeugendere Erklärung anbietet.)
Es ist natürlich kaum möglich, dass vollkommen unterschiedliche Menschen unter ganz verschiedenen Umständen und in verschiedenen Kulturen das gleiche merkwürdige Erlebnis haben. Ob sie nun gottesfürchtig, atheistisch, wichtigtuerisch, phantasiebegabt, schüchtern oder nichts von alledem sind, immer berichten sie von mindestens einem der beiden Todesmotive, dem Tunnel oder dem Über-dem-Körper-Schweben. Dass es sich um erfundene Geschichten handelt, ist also nicht wahrscheinlich. Es sollte einen Vorgang geben, der in allen Menschen gleich oder zumindest ähnlich abläuft, wenn der Tod naht. Wir wissen, dass der Körper bei jeder erdenklichen Gelegenheit Substanzen bildet, die gerade gebraucht werden. Wenn Sie Ihre Nase berühren, schütten die Nervenenden Stoffe aus, welche das Gehirn befähigen, die Nachricht »Nase berührt Finger« und »Finger berührt Nase« zusammenzusetzen. Erblicken Sie einen sexuell anziehenden Menschen, gibt eine Drüse Moleküle ab, die bewirken, dass Ihr Herz schneller schlägt und Ihre Gedanken sich verändern. Verlieren Sie etwas, das Ihnen teuer ist, führt das Zusammenspiel vieler ausgeschütteter Substanzen dazu, dass Sie sich ärgern und sich auf die Suche nach dem Verlorengegangenen begeben. Viele dieser Substanzen, etwa Hormone, sind bekannt und genau untersucht. Manche werden auch als Medikamente verwendet. Andere sind körpereigene Rauschgifte, die dem Morphium ähneln. Möglicherweise schüttet der Körper in Momenten größter Todesnähe eine Substanz aus, welche die beschriebenen Bilder hervorruft. Diese Todesmotive, so stellt man sich vor, sind den Menschen als eine Art Denkschablone von vornherein mitgegeben. Sie müssen nur noch abgerufen, das heißt erzwungen werden.
Offenbar ist dieser Mechanismus erblich und wird von Generation zu Generation weitergegeben. Zwei Gründe sprechen dafür, dass es ihn tatsächlich gibt. Der erste: Etwas Ähnliches wie Denkschablonen kennen wir aus einem anderen Zusammenhang, dem der Wahrnehmung von Dingen. Der entwicklungsgeschichtlich bedingte Aufbau unseres Gehirns erzwingt ständig bestimmte Bilder in unserem Kopf, die der Wirklichkeit so nicht entsprechen. Dies betrifft etwa die Farb-, Helligkeits-, Form- und Größenwahrnehmung. Durch eine getönte Sonnenbrille nehmen wir eine Buchseite immer noch als weiße Seite wahr, und im Abendlicht unterscheiden wir die Farben so wie am Tage, weil unser Hirn aus den »verfälschten« Daten die reine Information gewinnt.1 Und unser Hirn nimmt die mit einem Zeichenstift flüchtig angedeuteten Umrisse eines menschlichen Körpers als solchen wahr. Die Nerven des Gehirns flicken fehlende Stückchen Linie von selbst hinzu. Das Gehirn informiert uns bewertend, sozusagen parteiisch, über unsere Außenwelt. Vieles sehen wir gar nicht, anderes wird hinzugefügt.
Augenfällig bewiesen wurde das von den beiden Forschern David Hubel und Torsten Wiesel. In zwanzigjähriger enger Zusammenarbeit an der Harvard Medical School hatten die Wissenschaftler festgelegte Wahrnehmungen bei Affen und Katzen beschrieben. Hubel und Wiesel zeigten durch Experimente an fein aufgebohrten Schädeln lebender Tiere, dass die Sehrinde ihrer Versuchstiere auf bestimmte Formen, Umrisse und Farben mit festgelegten, das heißt vorhersagbaren Signalen antwortete. Diese Signale werden an Zellen weitergeleitet, die nicht mehr nur nach einem vorgegebenen Schema antworten, sondern auch zusätzliche Informationen benachbarter Gehirnbereiche verwerten.
Weil der grundlegende Aufbau der Gehirne von Katzen und noch mehr der von Affen sich nur geringfügig vom menschlichen Hirn unterscheidet, schließt man daraus, dass auch der Mensch zumindest auf der unteren Verarbeitungsebene des Denkens wie ein Automat funktioniert.
Mit seinen Versuchen drängte das Forscherteam aus Harvard das mögliche Vorhandensein der Seele weit zurück. Im Einklang damit sagte Hubel, nachdem er 1981 erfahren hatte, dass er und sein Kollege Wiesel den Nobelpreis für Medizin bekommen sollten:
Man hat bisher immer gesagt: Ein Gehirn kann sich selbst beziehungsweise das [im Hirn gelegene, M. B.] Bewusstsein nicht verstehen, weil das dasselbe wäre, als zöge man sich am eigenen Schopf aus dem Wasser. Wir halten das für Unsinn. Man kann ein Gehirn genauso gut untersuchen wie eine Niere.2
Das Erstaunen über die Entdeckung der beiden Forscher war groß und hielt viele Jahre an. Danach war der Weg gebahnt für die Vorstellung, dass der Mensch nicht völlig frei denkt, sondern zumindest in manchen Situationen von Denkschablonen gelenkt werden kann.
Der zweite Grund, der für den beschriebenen Mechanismus spricht: Es gibt tatsächlich Stoffe, die der Körper beim Eintreffen oder beim Nahen des Todes herstellt. Sie führen zu einer vollständigen Entspannung der Muskeln. Deshalb hängen beispielsweise Mäuse, die von einer Katze ergriffen werden, schlaff in deren Maul.
Das angenehme, schwebende Gefühl, das manche dem Tode entronnenen Menschen beschreiben, rührt also von einer Lockerung der Muskulatur durch körpereigene Entspannungsstoffe her.
Auch das Glücks- und Friedensgefühl, das viele »Zurückgekehrten« empfinden, mag auf die Wirkung körpereigener Substanzen zurückgehen. Es ist bekannt, dass der Organismus sich selbst gelegentlich mit drogenähnlichen Stoffen versorgt. Sie können Schmerzen unterdrücken oder angenehme, lustvolle Gefühle hervorrufen. Wir versuchen oft, bewusst oder unbewusst, in Situationen zu gelangen, in denen unser Körper Glücksstoffe herstellt. Er produziert sie nicht nur bei Sonnenschein, Ruhe oder Sex, sondern unter Umständen auch bei übermäßiger Arbeit. Nicht umsonst bezeichnen wir Arbeitswütige als Workaholics.
Wenn der Körper in Todesnähe solche Drogen ausschüttet, um Schmerzen zu unterdrücken, die Muskulatur und den Geist zu entspannen, findet ein letztes Mal das Zusammenspiel von Körper und Geist in höchster Vollendung statt. Ein solcher Tod ist friedvoll und mild.
Warum der Mensch dieses Programm in sich trägt, ist allerdings unklar. Vielleicht ist der Tod für den Körper nur einer von vielen Alarmzuständen, die er alle mit einer ähnlichen Reaktion beantwortet.