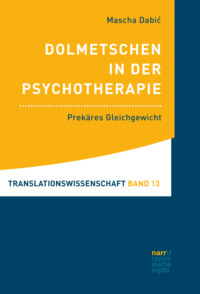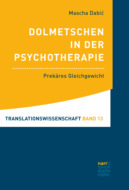Kitabı oku: «Dolmetschen in der Psychotherapie», sayfa 4
3.1 Definition
Auch wenn die Begriffe Trauma und davon abgeleitete Adjektive („traumatisiert“, „traumatisch“) mitunter inflationär oder gedankenlos verwendet werden1 , so ist Trauma keineswegs ein neumodisches Phänomen, sondern reicht in die Antike zurück (Smolenski 2006: 7f.).
Smolenski bietet einen Überblick über die historische Entwicklung der Traumatherapie und erwähnt u.a. entsprechende Schilderungen bei Homer über Achilles, die auf eine psychotraumatische Symptomatik hinweisen. Im 20. Jahrhundert waren es insbesondere die beiden Weltkriege, die zu massenhaften Traumatisierungen führten. Nach dem 2. Weltkrieg war das Sprechen über die traumatischen Erlebnisse deutscher Soldaten und der Zivilbevölkerung jedoch zunächst noch tabuisiert, und erst als die zahlreich auftretenden posttraumatische Belastungsstörungen bei Rückkehrern aus dem Vietnam-Krieg auch medial Beachtung fanden, gab es neue Entwicklungsimpulse für die Traumabehandlung. Die Diagnose der Posttraumatischen Belastungsstörung fand 1980 Eingang in das „Diagnostic and statistical manual of mental disorders“, und 1992 wurde dieses Krankheitsbild in die ICD-10 („International classification of diseases, injuries and causes of death“) der Weltgesundheitsorganisation WHO aufgenommen (vgl. Smolenski 2006: 15).
Darin wird Trauma folgendermaßen definiert:
(…) ein belastendes Ereignis oder eine Situation kürzerer oder längerer Dauer, mit außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigem Ausmaß, die bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde (z. B. Naturkatastrophe oder menschlich verursachtes schweres Unheil – man-made disaster – Kampfeinsatz, schwerer Unfall, Beobachtung des gewaltsamen Todes Anderer oder Opfersein von Folter, Terrorismus, Vergewaltigung oder anderen Verbrechen). (ICD-Code, Stand 25.5.2017)
Die Rede ist also von einem Ereignis, bei dem die natürlichen Schutzmechanismen versagen, weil es keine Möglichkeit gibt, sich den äußeren (gewaltsamen) Einwirkungen zu entziehen. Der Mensch erlebt Hilflosigkeit und Ohnmacht, mitunter auch Scham, in einem extremen Ausmaß. Wie es in der Definition heißt, würden diese Ereignisse „bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen“, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die KlientInnen nicht im eigentlichen Sinne „krank“ sind, jedenfalls nicht notwendigerweise, sondern von krankmachenden Ereignissen und Erlebnissen so schwer gezeichnet sind, dass die Symptome über das Ereignis hinaus sich immer wieder bemerkbar machen können. Dabei ist von Menschen verursachtes Unheil psychisch schwerer zu bewältigen als Naturkatastrophen, weil sich im ersten Fall stets Fragen von Schuld, Unrecht, Gerechtigkeit oder Rache stellen, ebenso wie die tendenziell mit Selbstvorwürfen behaftete Frage, ob es möglich gewesen wäre, das traumatische Ereignis zu vermeiden (wenn man sich rechtzeitig zur Flucht entschlossen hätte, wenn man dies oder jenes getan oder unterlassen hätte).
Zobel empfiehlt bei der Diagnose einer posttraumatischen Belastungsstörung mit einem Zahlenstrahl zu arbeiten, also einer Skala, um das Ausmaß der Belastung besser einschätzen zu können, bzw. die Auswirkungen des Traumas im Hier und Jetzt. Um vage Aussagen zu vermeiden (wie „ein bisschen“, „kaum“ oder „sehr viel“), empfiehlt Zobel, die Frage folgendermaßen zu formulieren: „Wenn Sie heute an dieses Ereignis denken, wie belastend empfinden Sie es auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 bedeutet ’keine Belastung, neutral‘ und 10 ‚die für Sie maximal vorstellbare Belastung‘?“ (2006: 33). Zobel betont, dass es aus der Sicht des Psychologen wichtig ist, nicht nur auf den Inhalt des erzählten Ereignisses zu achten, sondern auch darauf, wie erzählt wird: Kann der Patient den Ablauf schildern, ohne dass es zu Affekten kommt? Kann der Patient Anfang, Verlauf und Ende schlüssig berichten? Erscheint das Erlebnis und die Art, wie der Patient es schildert, kongruent? Gibt es Hinweise darauf, dass er Patient aufkommende Emotionen unterdrückt? (2006: 34). Es ist notwendig, dass DolmetscherInnen in der Psychotherapie diesen Anspruch an die Gesprächsqualität nachvollziehen können: Es zählt nicht nur das, was gesagt wird, sondern auch, wie es gesagt wird.
3.1.1 Trauma oder belastendes Lebensereignis?
Huber legt Wert auf eine Unterscheidung zwischen einem Trauma und einem belastenden Lebensereignis (2005: 37ff.): Auch wenn innere Konflikte großen Stress bedeuten können, ist ein Trauma davon zu unterscheiden, nämlich dahingehend, dass es sich bei traumatisierenden Erlebnisse um „tatsächliche, extrem stressreiche äußere Ereignisse“ handelt (Huber 2005: 38). Die Überflutung mit „aversiven Reizen“ überfordert sämtliche Bewältigungsmechanismen des Opfers und verändert das Leben für immer. „Von jetzt an wird es nie mehr so sein wie zuvor“ (2005: 41) – diesen Aspekt gilt es zu verstehen, um begreifen zu können, warum die Traumatisierung eine Zäsur im Leben des Opfers (bzw. des Überlebenden) darstellt und warum Traumatherapien oft mehrere Jahre in Anspruch nehmen und weshalb selbst nach Abschluss einer Therapie, die man als „gelungen“ bezeichnen kann, nicht davon auszugehen ist, dass die Wirkkräfte des Traumas für immer gebannt sind.
Ereignisse, die mit tödlichen Bedrohungen einhergehen, lösen einen von zwei Reflexen aus: fight or flight. Ob Menschen eher mit Fluchtversuchen oder Kampfbereitschaft reagieren, scheint situations- und personenspezifisch ausgeprägt zu sein. Huber äußert die Vermutung, dass Frauen tendenziell eher zur automatischen Fluchtreaktion neigen, während Männer eher auf aggressives Verhalten zurückgreifen (2005: 43).
Traumatisierend ist ein Ereignis dann, wenn die oben genannten Reaktionsmöglichkeiten Kampf oder Flucht1 nicht mehr gegeben sind und die überwältigende Einwirkung von außen hingenommen werden muss. Die Fachausdrücke dazu lauten freeze und fragment (ebda.): Freeze meint eine Lähmungsreaktion und eine Entfremdung vom Geschehen. Mit Fragment ist gemeint, dass die Erfahrung zersplittert wird und dass es keine zusammenhängende Erinnerung mehr an das äußere Ereignis gibt.
Ein solches Ereignis bzw. eine länger andauernde traumatisierende Situation oder eine Kette von Ereignissen und Situationen können zur Entwicklung einer Posttraumatischen Belastungsstörung führen.
3.2 Posttraumatische Belastungsstörung
3.2.1 Definition und Symptome
Für DolmetscherInnen, die mit kriegs- und fluchttraumatisierten1 Menschen arbeiten, ist es von Vorteil, sich zumindest in groben Zügen mit den psychotherapeutischen Konzepten im Hinblick auf die Posttraumatische Belastungsstörung vertraut zu machen, zum einen, um ein umfassenderes Verständnis von der Problematik der KlientInnen zu erlangen, und zum anderen, um die Fragen und Interventionen der PsychotherapeutIn besser nachvollziehen (und also präziser in der anderen Sprache wiedergeben) zu können.
Auf körperlicher Ebene macht sich eine Posttraumatische Belastungsstörung durch massive Schlafstörungen bemerkbar – daher drehen sich psychotherapeutische Gespräche häufig um dieses Thema, und es wird gemeinsam mit der KlientIn versucht, sämtliche Möglichkeiten auszuloten, die Schlafprobleme in den Griff zu bekommen und auf diese Weise dem Organismus zu der dringend notwendigen Regeneration zu verhelfen. Einige Symptome, die vermutlich auf eine manifeste Depression hindeuten, können für DolmetscherInnen von konkreter Relevanz sein, nämlich dann, wenn die KlientInnen so antriebs- und teilnahmslos sind, dass der depressive Gesamtzustand sich auf ihre Sprechfähigkeit auswirkt: Es kommt vor, dass KlientInnen auf Grund ihrer schlechten psychischen Verfassung sehr leise sprechen und dadurch kaum verständlich sind, wodurch die Gefahr steigt, dass es zu Missverständnissen kommt. In solchen Fällen ist es wichtig, die PsychotherapeutIn auf diese Problematik hinzuweisen, und nicht etwa zu versuchen, auf eigene Faust zu erraten, was gesagt wurde. Eine deutschsprachige PsychotherapeutIn ist möglicherweise nicht in der Lage selbst abzuschätzen, wie stark die Sprechfähigkeit der depressiven KlientIn in Mitleidenschaft gezogen wurde, und ist in diesem Fall auf die Expertise der DolmetscherIn angewiesen. Mehrmaliges Nachfragen mag aus der Sicht der DolmetscherIn unangenehm sein, ist jedoch dem Impuls, den Inhalt auf gut Glück zu erraten und zu ergänzen jedenfalls vorzuziehen.
Es ist die Aufgabe der PsychotherapeutIn, sich ein möglichst genaues Bild vom psychischen Zustand der KlientIn zu machen. Dazu gehört die oben erwähnte körperliche Ebene (Schlaf, Nahrungsaufnahme, Energiehaushalt, Gesundheitszustand), aber auch die Frage nach der Konzentrationsfähigkeit und dem Umgang mit belastenden Erinnerungen: Können diese kontrolliert werden, oder ist die KlientIn ihren Erinnerungen mitunter hilflos ausgeliefert? Um über alle diese Aspekte so umfassend wie möglich informiert zu sein, muss die PsychotherapeutIn in der Regel viele Fragen stellen, denn die KlientInnen sind sich ihres eigenen Zustands meistens gar nicht bewusst und reflektieren oft erst als Reaktion auf das Nachfragen der PsychotherapeutIn über ihre etwaigen Fehlleistungen im Alltag (z. B. an der falschen Station aussteigen in öffentlichen Verkehrsmitteln etc.) und ihren Umgang mit Erinnerungen.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO beschreibt eine Posttraumatische Belastungsstörung folgendermaßen:
Typische Merkmale sind das wiederholte Erleben des Traumas in sich aufdrängenden Erinnerungen (Nachhallerinnerungen, Flashbacks), Träumen oder Albträumen, die vor dem Hintergrund eines andauernden Gefühls von Betäubtsein und emotionaler Stumpfheit auftreten. Ferner finden sich Gleichgültigkeit gegenüber anderen Menschen, Teilnahmslosigkeit der Umgebung gegenüber, Freudlosigkeit sowie Vermeidung von Aktivitäten und Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten. Meist tritt ein Zustand von vegetativer Übererregtheit mit Vigilanzsteigerung, einer übermäßigen Schreckhaftigkeit und Schlafstörung auf. Angst und Depression sind häufig mit den genannten Symptomen und Merkmalen assoziiert und Suizidgedanken sind nicht selten. Der Beginn folgt dem Trauma mit einer Latenz, die wenige Wochen bis Monate dauern kann. Der Verlauf ist wechselhaft, in der Mehrzahl der Fälle kann jedoch eine Heilung erwartet werden. In wenigen Fällen nimmt die Störung über viele Jahre einen chronischen Verlauf und geht dann in eine andauernde Persönlichkeitsänderung über. (ICD-Code, Stand 25.5.2017)
Bei Huber sind u.a. folgende posttraumatische Belastungsreaktionen angeführt: Angstzustände und Schreckhaftigkeit, Alpträume und Schlafstörungen, häufiges Wiedererleben von Teilen des Traumas, Vermeidung von Reizen, die mit dem Trauma zu tun haben, Gefühle von Empfindungslosigkeit, Einsamkeit, Entfremdung von Nahestehenden, Kontaktunwilligkeit, Beeinträchtigung der Wahrnehmung der Umwelt, des eigenen Körpers, der eigenen Gefühle, Konzentrations- und Leistungsstörungen (Huber 2005: 68). Eine kompakte Zusammenfassung des Erscheinungsbilds der posttraumatischen Belastungsstörung ist auch bei Vogelgesang zu finden (2006: 68ff.), ebenso bei Preitler (2006: 157ff.).
Zu bedenken ist, dass Menschen lange Zeit nach dem Trauma gut funktionieren können, so als hätten sie das Trauma gut integriert; eine erneute Traumatisierung, ausgelöst durch einen Trigger2 (z. B. durch einen Jahrestag des traumatischen Ereignisses) kann zum Ausbruch der Posttraumatischen Belastungsstörung führen (Huber 2005: 70).
Die Ungewissheit eines langwierigen Asylverfahrens, das wie ein Damoklesschwert über den Asylwerbern schwebt und dem sie trotz rechtlichen Beistands im Grunde genommen hilflos ausgeliefert sind, kann wie eine erneute Traumatisierung wirken, ebenso ein Gefängnisaufenthalt im Rahmen der Schubhaft.
3.2.2 Folter und Trauma
„Folter bedeutet absoluten Kontrollverlust, daher ist es in der Arbeit mit diesen Menschen notwendig, ihnen möglichst viel Autonomie und Kontrollmöglichkeit einzuräumen“, stellt die in der Traumaarbeit erfahrene HEMAYAT1-Psychotherapeutin Preitler (2006: 165) fest und macht diese Kontrolle unter anderem an folgenden konkreten Faktoren fest: Da der Raum der Therapie oft der erste Ort für einen traumatisierten Menschen ist, in dem die Angst keinen Zutritt hat, braucht es Zeit, bis Vertrauen entstehen kann; daher soll den KlientInnen die Möglichkeit eingeräumt werden, den TherapeutInnen und auch den Dolmetscherinnen Fragen zu stellen, sie dürfen sich ihren Platz im Raum selbst aussuchen und gegebenenfalls auch die Lichtsituation im Raum kontrollieren, also beispielsweise die Vorhänge zuziehen. Für DolmetscherInnen kann es hilfreich sein, Bescheid zu wissen, warum KlientInnen solche Vorrechte eingeräumt werden und warum sie, die DolmetscherInnen, sich beispielsweise nicht einfach so, wie in einer anderen, alltäglicheren Situation ihren Sitzplatz selbst aussuchen dürfen.
Marcussen plädiert dafür, die Folter stets vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Verhältnisse und der globalen Widersprüche zu reflektieren: Welche Ziele verfolgten die Folterer? Welche Methoden wurden angewandt? (Marcussen 1990: 67ff.). Der durch die Folter zugefügte psychische Schmerz, die Ungewissheit, die Angst, die Demütigungen, die Drohungen und der Umstand, aller mitmenschlichen Kontaktmöglichkeiten beraubt zu sein, scheinen schlimmer als die offensichtlichen körperlichen Folgen zu sein (1990: 71).
Rauchfleisch bietet in seinem Beitrag einen Überblick über unmittelbare Reaktionen auf das Foltererlebnis, so wie auf die Kurzzeitfolgen und Spätfolgen (Rauchfleisch 1990). Wertvolle Praxiserfahrungen von erfahrenen ExpertInnen aus den Gebieten der Psychologie, Psychotherapie, Medizin und Sprachwissenschaften sind bei Siroos & Schenk (2010) nachzulesen.
Aus der Sicht der DolmetscherInnen ist im Zusammenhang mit dem Thema Folter wichtig nachvollziehen zu können, warum bei Folterüberlebenden ein besonders behutsames Vorgehen in der Therapie notwendig ist, warum es mitunter sehr viel Zeit und Geduld braucht, bis mit Folter im Zusammenhang stehende Inhalte zur Sprache gebracht werden können und also zum Gegenstand in der Therapie werden.
3.3 Arbeiten mit traumatisierten Menschen
3.3.1 Die therapeutische Beziehung und Therapieziele
Die knappe Beschreibung einer therapeutischen Beziehung bei Vogelgesang kann für DolmetscherInnen in diesem Kontext hilfreich sein:
Die Einhaltung der adäquaten Distanz prägt die therapeutische Beziehung entscheidend mit: Sie ist je nach den situativen Erfordernissen flexibel zu gestalten. Absolut zu meiden sind jedoch die folgenden beiden Extrempole: einerseits die Überidentifikation, die unter völliger Selbstaufgabe und evtl. sogar bei Überschreiten der professionellen Grenzen den Patienten um jeden Preis retten möchte, sowie andererseits die übergroße Distanzierung, die ein echte Beziehung erst gar nicht entstehen lässt. (2006: 71)
Es ist unabdingbar für DolmetscherInnen in diesem Kontext, die Charakteristik und Spezifik einer therapeutischen Beziehung nachvollziehen und mitgestalten zu können: Die Mitgestaltung kann sowohl durch aktive Teilnahme erfolgen, als auch durch bewusste Zurückhaltung und Unterlassungen. Das Ringen um die „adäquate Distanz“, die Vermeidung einer „Überidentifikation“ ebenso wie einer „übergroßen Distanzierung“ sind Anforderungen, die die DolmetscherInnen im gleichen Maße wie die PsychotherapeutInnen betreffen. Eine „Grenzen überschreitende Verschwesterung mit den Betroffenen“ sei nicht nur unprofessionell, sondern auch im höchsten Grade dysfunktional (S. 72).
Vogelgesang spricht außerdem davon, dass die Arbeit mit traumatisierten Menschen auch für die Therapeutin sehr belastend sein kann und sowohl von menschlicher als auch von professioneller Seite her besondere Anstrengungen verlangt, da die eigene Welt- und Selbstsicht entscheidend verändert werden kann und auch eigene traumatische Erfahrungen aktualisiert werden können. Eine gute Ausbildung, Supervision, eine Stärkung der eigenen Ressourcen sowie eine gute Kenntnis der eigenen Biographie im Bezug auf Traumata (Stichwort: Selbsterfahrung) können diesbezüglich Abhilfe schaffen. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass DolmetscherInnen in der Regel ohne eine solche Ausbildung, oft auch ohne Supervision und ohne entsprechende Selbsterfahrung die Narration der traumatisierten KlientIn aus erster Hand vernehmen. Daran anknüpfend ist unbedingt die Forderung nach Supervision für DolmetscherInnen in den entsprechenden Einrichtungen zu stellen, wenn auch dazu angemerkt sei, dass solche Angebote mitunter auch an der fehlenden Bereitschaft der DolmetscherInnen selbst scheitern bzw. ihr volles Potenzial nicht zur Entfaltung bringen können, da DolmetscherInnen prekär beschäftigt sind, ihnen also für solche Angebote häufig die Zeit oder der Wille fehlt; möglicherweise ist es auch die Furcht vor der Konfrontation mit eigenen problematischen Inhalten, die DolmetscherInnen davon abhält, Supervisionsstunden in Anspruch zu nehmen, auch dann, wenn diese von der Organisation im ausreichenden Ausmaß angeboten werden.
Zu Beginn dieses Kapitels (Punkt 3.) wurde bereits darauf hingewiesen, dass die DolmetscherInnen durch ihre Präsenz und ihre Mitarbeit daran beteiligt sind, den therapeutischen Rahmen als einen „sicheren“ Raum für die KlientInnen mitzugestalten. Da DolmetscherInnen in erster Linie für den sprachlichen Transfer in diesem Rahmen zuständig sind, ist ihre Rolle bei der Erreichung eines der impliziten Therapieziele nicht hoch genug einzuschätzen, nämlich bei der Herstellung einer „sprachlich codierten Erinnerung“ (Vogelgesang 2006: 70).
Im Hinblick auf das Ziel der Psychotherapie ist es notwendig, eine realistische Perspektive einzunehmen – dies ist auch für DolmetscherInnen wichtig nachzuvollziehen, um keine übersteigerten Erwartungen an die Therapien und den jeweils eigenen Beitrag daran zu knüpfen:
Heilung im Sinne von Wiedergutmachung ist nicht möglich. Was geschehen ist, kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Die toten Familienangehörigen und Freunde sind unwiederbringlich verloren, die körperlichen Verstümmelung (sic!) und Narben bleiben sichtbar. Das Grauen der Folter wurde ein überdimensionaler Bestandteil der Lebensgeschichte. Ziel der psychologischen und psychotherapeutischen Intervention kann es aber sein, die Zeitdimensionen wieder richtig zu stellen: Die Folter muss nicht mehr jede Nacht in Albträumen und tagsüber in ständig wiederkehrenden Erinnerungen wieder erlebt und erlitten werden. (Preitler 2006: 165)
Eine Therapie gilt dann als abgeschlossen, wenn es den KlientInnen gelungen ist, verlorene Menschen und Lebensbezüge zu betrauern, neue Beziehungen aufzubauen und Strategien für ein Leben im neuen Land praktisch umzusetzen. Allerdings können Retraumatisierungen immer wieder auftreten, sodass KlientInnen beim Abschied immer das Angebot erhalten, auch später noch Kontakt aufzunehmen, sollte eine Krisenintervention oder eine nochmalige Kurztherapie notwendig sein.
3.3.2 Dynamiken in den Einrichtungen für Kriegs- und Foltertraumatisierte
Der Arzt, Psychotherapeut und Mitbegründer und Leiter des Behandlungszentrums für Folteropfer in Berlin Christian Pross hat eine umfassende Analyse von Dynamiken und Belastungen, denen MitarbeiterInnen von Einrichtungen für kriegstraumatisierte Menschen ausgesetzt sind, vorgelegt (Pross 2009). Er untersuchte an Hand von Interviews Strukturen, kommunikative Muster, Handlungsabläufe, Lebenszyklen und Phänomene wie Burn-Out und Zerwürfnisse innerhalb des Teams und kam zu der Erkenntnis, dass in Arbeitsstellen, in denen traumatisierte Menschen behandelt werden, häufig destruktive Dynamiken auftreten, wie etwa Konflikte, Ausschließung einzelner MitarbeiterInnen oder Mobbing, hohe Fluktuation usw. Als Ursachen führt Pross unter anderem folgende Faktoren an: hoher Identifikationsdruck im Spannungsfeld der Extreme von Opfer und Täter, Einteilung der Welt in Gut und Böse, Überidentifikation mit den Opfern, Größenfantasien, Grenzüberschreitungen, mangelnde Distanz zu sich selbst, das Unvermögen, das eigene destruktive Handeln zu reflektieren, etc. (2009: 270). Konflikte und Kämpfe in Teams führen in die Reinszenierung des Traumas, und ohne Reflexion und (Selbst-)Korrektur agieren MitarbeiterInnen eigene Verletzungen aus bzw. wiederholen unbewusst die pathologischen Verhaltensmuster ihrer PatientInnen.
Da der Arbeitsauftrag der DolmetscherInnen in solchen Zentren sehr klar definiert ist, nämlich zu bestimmten, im Voraus ausgemachten Zeiten zu dolmetschen, sind DolmetscherInnen von solchen destruktiven Dynamiken tendenziell weniger betroffen. In der Regel sind DolmetscherInnen nicht angehalten, die Repräsentation der Einrichtung nach außen aktiv mitzugestalten, SponsorInnen zu gewinnen oder die Positionierung der Einrichtung innerhalb des Netzwerks staatlicher und nichtstaatlicher Akteure im Asylbereich zu verhandeln. Die Verantwortung der DolmetscherInnen gegenüber der Einrichtung beschränkt sich in der Regel auf die möglichst korrekt, zuverlässig und kontinuierlich ausgeübte Dolmetschtätigkeit; damit geht ein relativ beschränkter Gestaltungsraum einher, zugleich sind DolmetscherInnen den Konflikten innerhalb des Teams weniger ausgesetzt und müssen nicht inhaltlich Stellung beziehen.
Dennoch sind manche Aspekte, mit denen Pross sich differenziert auseinandersetzt, für DolmetscherInnen ebenfalls relevant und sollen daher im vorliegenden Kapitel Erwähnung finden.