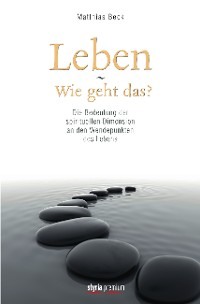Kitabı oku: «Leben - Wie geht das?», sayfa 2
2. Die Vieldimensionalität des Lebens und der Selbststand
Das menschliche Leben hat viele Dimensionen. Das ist eine triviale Aussage. Spannend aber wird die Frage, wie diese Dimensionen sich gegenseitig im Leben durchdringen. Wissenschaftstheoretisch müssen die verschiedenen Ebenen von Naturwissenschaft, Medizin, Psychologie, Soziologie, Philosophie und Theologie genau auseinandergehalten4 werden und greifen doch im konkreten Leben ineinander. Die Naturwissenschaften versuchen, die Welt und die Einzeldinge in ihrer Ausdehnung und Messbarkeit zu erfassen (res extensa bei René Descartes), die Geisteswissenschaften befassen sich mit dem Nicht-Ausgedehnten und Nicht-Messbaren des menschlichen Geistes (res cogitans). Diese Sichtweise des Descartes impliziert zwar einen Leib-Seele-Dualismus in der Unterscheidung von Geist und Materie, aber diese Unterscheidung ist zunächst geeignet, um die unterschiedlichen Perspektiven aufzuzeigen. Sie wachsen heute mehr und mehr zusammen.
Es gibt Phänomene im Leben, die sich der Messbarkeit und Wägbarkeit entziehen. Es wäre unsinnig, das Gewicht oder die Zentimeter von Gedanken oder von Liebe und Treue bestimmen zu wollen. Im menschlichen Lebensvollzug existiert beides zugleich: die messbaren physiologischen Veränderungen im Organismus (Zellveränderungen, Blutwerte, Hormone) und die nichtmessbaren Phänomene wie Liebe, Treue, Vertrauen, Wahrheit. Außerdem gibt es noch die emotionale Gefühlsebene, die von der Psychologie betrachtet wird. Alle Dimensionen sind im Menschen gleichzeitig „da“, sie dürfen wissenschaftlich gesehen nicht vermischt, im Lebensvollzug aber auch nicht von einander getrennt werden. Auch hier gilt: unvermischt und ungetrennt.
Eine naturwissenschaftlich geprägte Welt geht oft davon aus, dass nur das existent ist, was messbar ist und übersieht dabei, dass die größere Zahl von alltäglichen Vollzügen des menschlichen Miteinanders gerade nicht messbar ist. Es sind dies die geistigen Vollzüge und die täglichen personalen Begegnungen. Jeder Gedanke, jedes Versprechen, jede Liebe und Treue sind in dem Sinne zunächst nicht messbar. Zwar versucht die Hirnphysiologie immer wieder, auch den Vollzug des Denkens messbar zu machen und die hirnphysiologischen Veränderungen beim Denken und Fühlen darzustellen. Aber mit diesen Messungen erfasst man nur die „Außenseite“ eines Gedankens oder eines Gefühls, nicht aber den Gedanken, das Gefühl oder das Phänomen der Liebe selbst. Das Messbare ist die objektive Sicht auf ein Phänomen (auch als die „Dritte-Person-Perspektive“ bezeichnet), während das subjektive Erleben und der subjektive Vollzug („Erste-Person-Perspektive) kaum messbar ist.
So sehr es hilfreich ist, hirnphysiologische Veränderungen im Gehirn liebender Menschen, meditierender Mönche oder betender Menschen aufzuzeichnen, so wenig erfasst man doch die Liebe als Liebe oder das Gebet als Gebet. Man kann auch bestimmte Konfliktsituationen im Gehirn darstellen, aber damit ist der Konflikt noch nicht als Konflikt in seiner existentiellen Bedeutung für zwei Menschen begriffen. Man erfasst nur eine Korrelation zwischen Gedanken und hirnphysiologischen Veränderungen, nur die äußeren Wirkungen eines inneren Geschehens. Vor allem kann man nicht sagen – wie manche Hirnphysiologen es tun – dass die Veränderungen im Gehirn die Ursache für den Gedanken, der Konflikt, die Tat, der Liebe sind. Man kann nur von einer Korrelation zwischen Gedanken und Veränderungen im Gehirn sprechen.5
Will man bis hierher eine Zusammenschau der verschiedenen wissenschaftlichen Zugänge zum Menschen (Naturwissenschaften, Psychologie, Soziologie, Medizin, Philosophie, Theologie) im Blick auf den konkreten Lebensvollzug des Menschen wagen, kann man es so sehen: Der Mensch hat naturwissenschaftliche Grundlagen (z. B. Genetik, Epigenetik, Geschlecht), er hat psychische Prägungen durch Eltern und Vorfahren (Beziehung zu den Eltern, Ängste, Konflikte) und er hat einen menschlichen Geist (er ist ein Geistwesen), der sich philosophisch und theologisch mit Fragen nach dem Sinn des Lebens und den letzten Gründen des Seins auseinandersetzen kann. Die natürlichen Vorgaben sind dem Menschen mitgegeben, sein Leben ist ihm als Aufgabe aufgegeben. Im Leben gibt es – wissenschaftlich gesehen – die naturwissenschaftlich messbare und verallgemeinerbare Dimension im Menschen, die psychisch individuell geprägte, die mit anderen individuellen Prägungen verglichen werden kann und die geistige, die im Lebensvollzug etwas Einmaliges und Unvergleichbares enthält: Jeder Mensch hat seine eigenen Gedanken, seine individuelle Lebensführung, seinen eigenen Namen, seine Identität und Berufung, seine je individuelle Krankheit und letztlich stirbt er auch seinen eigenen Tod. Niemand kann ihn dabei vertreten.
Allerdings vermischen sich gerade heutzutage die Ebenen des Verallgemeinerbaren und des Individuellen immer mehr. Gerade die naturwissenschaftlichen Forschungen im Bereich der Medizin, die eigentlich alles zu verallgemeinern suchen, nehmen gegenwärtig immer mehr das Individuelle in den Blick. Sie erkennen, dass jeder Mensch ein ganz individuelles Genom hat und zum Beispiel Arzneimittel wegen dieser Unterschiedlichkeit in jedem Menschen anders wirken. Das Fachgebiet der Pharmacogenomics befasst sich mit diesem Einmaligen. Man spricht immer mehr von individualisierter Medizin, die sich mit dem Individuellen im Blick auf die genetische Ausstattung befasst. Philosophisch-theologisch umfassender muss man von einer personalisierten Medizin sprechen, die sich dem ganzen Menschen mit seiner Innenwelt, Umwelt und seiner seelisch-geistigen Verfasstheit zuwendet. So gibt es verallgemeinerbare Phänomene im Menschen, die wissenschaftlich gesehen vergleichbar sind, aber es ist doch immer der eine, individuelle und einzigartige Mensch, der krank ist, sich freut, denkt und fühlt.
Die Einzigartigkeit des Menschen hat auch mit seinem Geistsein und seiner Vernunftbegabung zu tun. Die geistige Verfasstheit setzt den Menschen instand, sich mit den verschiedenen Dimensionen seines Seins in seinem Lebensvollzug auseinandersetzen und sie zu einer Einheit zu integrieren. Er kann seine genetischen Veranlagungen nutzen, sich mit seinem Leben identifizieren oder es ablehnen, er kann ein gutes Selbstverhältnis aufbauen und seine elterlichen Prägungen in sein Leben integrieren oder sich dagegen wehren. Der Mensch kann auf Grund seiner Geistverfasstheit auch über sein ganzes Leben und den Tod nachdenken. Der Geist ragt von sich aus über den Tod hinaus und in den Bereich jenseits des Lebens hinein. Er übersteigt die Endlichkeit der Welt. Der Mensch, der seine Existenz und die Welt als endlich erkennt, ist mit seinem Geist schon darüber hinaus. Er ist schon im Raum des Absoluten, sonst könnte er die Grenze nicht als Grenze erkennen, so hat es Hegel formuliert.
Der Mensch kann nicht nur nach draußen über die Endlichkeit hinausschauen, sondern auch nach innen. Er kann in jeder Re-flexion (reflectere, sich zurückbeugen) und inneren Versammlung in einer schrittweisen Distanzierung von den Dingen langsam zu sich selbst zurückkehren und bei sich sein. Die Tradition nennt das die vollständige Rückkehr zu sich selbst. In dieser Rückkehr zu sich selbst überschreitet der Mensch sich ebenfalls auf einen letzten Grund hin und findet diesen letzten Grund in sich. In ihm findet er seinen inneren Halt und Selbststand und lernt von dort aus, es mit sich selbst auszuhalten. Das Selbststand-Finden und das Mit-sich-Aushalten hat Seneca etwas anders ausgedrückt: Es ist das Zeichen des geordneten Geistes, dass er es mit sich selbst aushält: „Für den ersten Beweis eines geordneten Geistes halte ich das Stehen-Bleiben-Können und Mit-Sich-Verweilen.“6
Dieses Mit-sich-selbst-Aushalten, Mit-sich-allein-sein-Können und seinen Selbststand in sich finden ist die Bedingung der Möglichkeit für gelingende Beziehungen. Nur wer es mit sich selbst aushält, wird es auf Dauer auch mit anderen aushalten. Ohne dass der Mensch seinen Selbststand erlangt – und diesen erreicht der Mensch nur, wenn er sich selbst überschreitet und im Absoluten seinen tragenden Grund und letzten Halt findet (s. u.) –, steht der Mensch immer in der Gefahr, andere oder anderes zu verabsolutieren oder als fremd abzulehnen. Wenn die innere Souveränität oder der Selbststand fehlen und das sichere In-sich-Stehen nicht entwickelt ist, wird das Fremde immer als etwas Bedrohliches erlebt und abgelehnt werden. Das In-sich-Halt-Finden ist deshalb so wichtig, da es dem Menschen Stand und „Sicherheit“ verleiht, es mit sich selbst auszuhalten, den anderen in seiner Andersartigkeit zu „ertragen“ und – bei Freundschaften und Beziehungen – den anderen nicht durch Verabsolutierung zu überfordern. Der mangelnde Selbststand, die mangelnde innere Sicherheit und die Verabsolutierung des anderen stört zwischenmenschliche Beziehungen und letztlich auch die Freiheit des Menschen. Denn diese bedeutet über die Handlungsfreiheit und Willensfreiheit hinaus auch die Freiheit von bestimmten Abhängigkeiten, die den Menschen hindern, sein inneres Wesen und seine Berufung leben zu können.7
3. Die Frage nach dem letzten Grund
Der Mensch kann in seinem tiefsten Inneren den letzten Grund finden, der ihm Halt gibt, der ihn trägt und frei werden lässt von anderen Abhängigkeiten. In seinem tiefsten Seelengrund trifft der Mensch auf das Absolute. Dieses Absolute und dieser letzte Grund ist aber auch der Horizont des gesamten Seins und aus jüdisch-christlicher Sicht ein personaler Grund. Er ist im Menschen „da“ und gleichzeitig als Grund der Welt gegenwärtig. Nach einem solchen Grund haben die Menschen Jahrtausende lang gesucht. Aber sie wussten nicht, ob es ihn gibt und wie er „aussieht“. (Der deutsche Begriff „Grund“ taucht zum ersten Mal in der mittelalterlichen Mystik als Seelengrund auf. Der Mensch, der nach Begründungen sucht und immer weiter sucht, kommt schließlich auf einen letzten Grund, und diesen nennen alle Gott, so formuliert es Thomas von Aquin. Diesen letzten Grund findet der Mensch als Grund der Welt und als Seelengrund in sich selbst.)
Dieser Grund beginnt sich nach der Auffassung des Judentums und Christentums im Laufe der Geschichte schrittweise zu zeigen und zu offenbaren. Der Gott Jahwe tritt aus seinem dunklen Seinsgrund und seinem „Versteck“ hervor und – so die Meinung des Judentums – beginnt zu sprechen. Dieses Sprechen ist nicht nur eine Mitteilung im Sinne der Weitergabe einer Information, sondern Gott fängt an, sich selbst mitzuteilen und sein Leben mit den Menschen zu teilen. Er sagt, wer er ist: „Ich bin der ich bin“, der „Ich-bin-Da“ (Ex 3,14). Das heißt, er ist das Da-sein, das Sein, er ist der, der er ist und auch das Für-den-anderen-da-Sein.
Dieses Sprechen Gottes, das Wort Gottes, das zunächst noch anfanghaft und distanziert ist (niemand hat Gott je gesehen) beginnt sich später - so die Auffassung des Christentums - dem Menschen genauer zu zeigen und zu offenbaren. Das Sprechen Gottes vermenschlicht sich, das Wort Gottes wird Mensch, kommt dem Menschen entgegen und macht ihm vor, wie Leben geht. „Ich bin das Leben“ (Joh 14,6). Dieses „Wort“ Gottes, das sich im irdischen Leben zeigt, heißt im Griechischen „logos“. Der logos zeigt sich in dieser Welt als Mensch, er zeigt sich in jedem Menschen und erweist sich als Grund der Welt. Daher heißt es im Johannesevangelium: Im Anfang war der logos, im Anfang war das Wort (Joh 1,1 - 2).
Bewusst heißt es:„Im Anfang“ war das Wort und nicht „Am Anfang“. Es geht nicht um den Anfang der Welt, den man eher mit dem Begriff des Beginns belegen müsste, sondern es geht um das je neu Anfanghafte und Ursprüngliche, in dem der absolute Grund „da“ ist und der in jedem Moment des Lebens aufspringt und etwas Neues ins Sein setzt, das noch nie da war. Es sagt etwas aus über den letzten Grund des Seins, den das Judentum den Schöpfer nennt: Alles wird täglich erneuert, das Leben lebt von dieser ständigen Erneuerung, die von selbst und ganz still vonstatten geht. Selbst Zellen im Organismus werden unmerklich in jeder Sekunde erneuert, abgebaut, umgebaut, neu gebaut.
Bei Hermann Hesse heißt es: Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Allem Anfang wohnt dieses Neue, Junge, Anfanghafte und Ursprüngliche inne. Jeder Moment des Lebens ist ein solcher Anfang im Kontinuum des schon Gewesenen, Vergangenen und Zukünftigen. Im Jetzt des Augenblicks fallen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zusammen. Das je neu Anfanghafte und Aufspringende des Ursprünglichen ist das Jetzt der ständigen Gegenwart. Ständige Gegenwart ist Ewigkeit. So ist im Vorbeizug der Zeit das Ewige immer schon „da“ und in jedem neuen Moment des Lebens, der noch nie da war, das Bleibende präsent. Das Neue knüpft an schon Bekanntes an, sonst könnte der Mensch sich gar nicht zurecht finden. So ist es neu und doch nicht ganz unbekannt. Jedem Augen-Blick des Lebens wohnt das Anfanghafte es Ur-wortes inne. Man muss es nur entdecken, es ist ganz still.
Dieses Wort ist nach christlicher Auffassung in der Person Jesu Christi Mensch geworden und wohnt auch in jedem Menschen. Daher drückt Augustinus die Anwesenheit dieses Wortes im Seelengrund des Menschen personal so aus:„Du bist mir innerlicher als ich mir selbst bin“ und „unruhig ist unser Herz, bis es ruht in Dir“.
Wenn dem so ist, dann ist der Mensch derjenige, der auf dieses Ur-Wort ant-worten (gegen-worten) muss. Darin besteht seine tiefste und letzte Ver-ant-wortung.
Nun kann der Begriff „logos“ nicht nur mit „Wort“, sondern auch mit Logik, Vernunft und Sinn übersetzt werden, und dann meint dies, dass die Welt von einer Art Ur-logik, Ur-vernunft und einem Ur-Sinn durchdrungen ist. Man findet diesen logos in der Ordnung des Kosmos, in der Ordnung und dem Spielraum der lebendigen Natur sowie in der Ordnung und Freiheit der Vernunftnatur des Menschen. Diese Ur-logik und das Ur-Wort durchdringen alles und zeigen sich in allem. Sie müssen nur ent-deckt werden.
Wenn diese Urlogik in allem ist und der Mensch auf den Logos, der sich in der Welt zeigt, antworten muss, dann meint das konkret, dass er in eine bereits vorfindliche Welt hineingeboren wird und daher „nur“ der „Gegen-Worter“ und nicht der „Worter“ ist. Er ist das zweite Glied in der Kette, er ist Geschöpf und nicht Schöpfer. Er muss sich auf die vorfindliche Welt einlassen, kann deren Gesetze erforschen und darüber nach-denken, was die Welt im Innersten zusammenhält. Vor-denken kann er die Welt nicht, sie ist schon „da“. Auch ein Vordenker ist in diesem Sinne ein Nachdenker.
Der Mensch muss im konkreten Alltag immer wieder neu auf die ihm begegnenden Ereignisse des Lebens reagieren und kann, wenn es gut geht, sein Leben ein Stück weit selbst mitgestalten. In ständigen Entscheidungen muss er auf das auf ihn Zukommende (Zu-kunft) antworten und kann doch selbst auch Anfänge setzen. Im tiefsten Sinne „machen“ kann er die Zukunft nicht. Es kann sein, dass es morgen keine Zukunft mehr gibt. Wenn es sie aber gibt und die Welt nicht untergeht, kann er im Rahmen seiner Vorgegebenheiten anfanghaft etwas Selbstursprüngliches setzen, er ist nicht nur Spielball fremder Mächte.8
4. Der Lebensbeginn
Das Leben beginnt ganz still und unscheinbar: ein menschlicher Same und eine Eizelle vereinigen sich zur Zygote, dann geht alles wie von selbst, zwei Zellen, vier, acht. Es ist ein neues Leben entstanden. Dieses neu entstandene Leben ist einmalig, vor ihm war noch nie eines so und nach ihm wird keines mehr so sein. Es ist es sogar in seiner genetischen Ausstattung, auch aufgrund der epigenetischen Faktoren. Daher unterscheiden sich auch eineiige Zwillinge. Dieses neue Leben hat ein Geschlecht, es ist lebendig, es ist ein Menschenleben und keine Sache. Es weiß nichts von seiner Existenz und wurde auch nicht gefragt, ob es leben will. Das Leben wird ihm zugemutet. Später muss sich der junge Mensch zu seinem Leben, zu sich selbst und zu seiner Umgebung irgendwie verhalten.
Das Spermium findet die Eizelle, indem es durch bestimmte Duftstoffe angelockt wird (Chemotaxis). Spermium und Eizelle wandern im Eileiter aufeinander zu. Es kann passieren, dass aufgrund eines genetischen Defekts ein Spermium die Eizelle nicht findet oder es zu schwach ist, in sie einzudringen. Dann findet keine Befruchtung statt. Nur ein Spermium von den vielen Millionen, die auf die Eizelle zuwandern, darf in die Eizelle eindringen. Nach dem Eindringen des einen Spermiums verschließt sich die Eizelle. Gelangt ein zweites Spermium hinein, ist dies mit dem Leben nicht vereinbar.
Die Eizelle hat eine sehr dicke Hülle, so dass nur gesunde Spermien eindringen können. Haben Spermien zum Beispiel einen genetischen Schaden und können die Eizellhülle nicht durchdringen, findet keine Befruchtung statt. Die Medizin kann hier zwar nachhelfen und mit Hilfe einer Spritze ein Spermium in die Eizelle einbringen (intracytoplasmatische Spermieninjektion, ICSI). Sie kann aber das eingebrachte Spermium vorher nicht genetisch untersuchen, da es bei der Untersuchung zerstört würde. So gelangt möglicherweise ein genetisch geschädigtes Spermium in die Eizelle, so dass bei den späteren Kindern Schäden entstehen können.9
Es beginnt ein stiller, geräuschloser, von selbst ablaufender, komplizierter physiologischer Prozess. Die erste Zelle teilt sich, es entstehen zwei Zellen, dann vier, dann acht. Es geschieht das, was Aristoteles „Selbstbewegung“ nennt. Der Begriff meint, dass sich das Leben jetzt von selbst weiter entwickelt und von innen her Gestalt wird. Die Zygote (erste Zelle) und der Embryo wachsen und die Zellen differenzieren sich in die etwa 220 verschiedenen Zelltypen, die ein erwachsener Mensch hat. Die Zygote hat bereits eine aktive Potentialität, das heißt, sie hat alles in sich, was sie zur Entwicklung hin zum Embryo und zur weiteren Entwicklung braucht. Von außen bedarf sie nur der Nahrung und der richtigen physiologischen Umgebung. Diese aktive Potentialität führt zu einem Lebens- und Entfaltungsprozess, der nicht zu stoppen ist. Um ihn zu stoppen, muss man den Embryo töten. Leben ist ständige Veränderung. Und Veränderung braucht zwei Prinzipien: ein sich änderndes und ein sich durchhaltendes. Das erste nannte Aristoteles „Materie“, und dasjenige Prinzip, das sich im Innersten des sich verändernden Lebendigen durchhält und die Identität des Seienden ausmacht, nannte er Seele.
Das sich entwickelnde Leben drängt nach vorne, nach Wachstum, Veränderung, Differenzierung und schließlich nach Geborenwerden. Es ist ein unumkehrbarer Prozess, eine Einbahnstraße. Es geht nur in eine Richtung nach vorne und nicht zurück, es drängt nach vorne und nach draußen. Der Embryo und der spätere Fetus (ab dem dritten Monat so genannt) entwickeln sich als Mensch und nicht erst zum Menschen. Der aktiven Potentialität der Zygote, des Embryos und des Fetus, die zur Selbstentfaltung führt, steht die passive Potentialität von Samen und Eizelle gegenüber. Diese besitzen jeweils nur den halben Chromosomensatz und bedürfen daher des jeweils anderen, um lebensfähig zu sein. Allein sind sie es auf Dauer nicht.
Der neu entstandene Embryo hat bereits anfanghaft etwas von einem „Selbst“10. Zwar beginnt die Umsetzung der eigenen genetischen Information in konkrete Eiweißstoffe (Genexpression) nach Meinung einiger Autoren erst zwischen dem Vier- und Achtzellstadium11. Aber die Selbststeuerung im Sinne eines eigenen Stoffwechsels des Embryos beginnt bereits früher:
„Die Selbststeuerung des Embryos beginnt nicht erst im Achtzellstadium, in welchem die Aktivierung der embryonalen DNA zur Transskription beobachtet wird; sie erfolgt wahrscheinlich schon im Pronukleusstadium, spätestens aber in der Zygote, die sich in einem durch die Zona pellucida begrenzten Reaktionsraum befindet und ihren eigenen Stoffwechsel hat. Als Folge dieses Stoffwechsels und der eigenen Proteinsynthese wird der Vorrat an mütterlicher mRNA allmählich verbraucht. Schließlich wird die Transskription der eigenen DNA angeschaltet. Die Selbstorganisation beginnt mit dem eigenen Stoffwechsel im Reaktionsraum der Zona pellucida.“12
Der Embryo ist auf diese Selbststeuerung und eine anfanghafte Eigenaktivität angewiesen. Denn er hat die Hälfte des genetischen Materials vom Vater und dieses müsste eigentlich vom Immunsystem der Mutter als fremd erkannt und der Embryo abgestoßen werden. Offensichtlich kann sich aber der Embryo durch seine Selbststeuerung und Eigenaktivität vor dieser Abwehr des mütterlichen Immunsystems schützen. Wie das funktioniert, ist noch nicht ganz geklärt.13 Aber es wurde zum Beispiel bei der „Maus schon wenige Stunden nach der Befruchtung ein immunsuppressiver Faktor (EPF: Early Pregnancy Factor) gefunden, der das Immunsystem der Mutter unterdrückt und eine Abstoßungsreaktionen verhindert“.14
Die Zygote und der spätere Embryo müssen also nach der Verschmelzung von Samen und Eizelle ihr eigenes Programm aktivieren und der Mutter signalisieren, dass sie ihn nicht abstoßen soll. Im Blick auf die Veränderungen bei der Mutter und die Individualität des Embryos formuliert Günter Rager:„Der Austausch der Signale führt unter anderem dazu, dass der mütterliche Organismus sich auf Schwangerschaft einstellt (humanes Choriongonadotropin, HCG) und verhindert, dass der Embryo bei der Einnistung in den Uterus als Fremdkörper angesehen und abgestoßen wird (early pregnancy factor, EPF).“15
Der neu entstandene Organismus agiert also von Beginn an als eine Einheit und „sendet an die Mutter Signale, die den embryo-maternalen Dialog einleiten und zur Steuerung (Synchronisation) und Feinabstimmung des embryonalen und mütterlichen Systems beitragen“.16 Hier findet auf einer ganz physiologischen Ebene ein erster „Dialog“ und eine erste „Kommunikation“ im Sinne einer Wechselwirkung zwischen Embryo und Mutter statt. Ohne eine solche Kommunikation wäre ein Überleben des Embryos nicht möglich.
Daher ist die Rede vom Lebensbeginn, der erst mit der Implantation in die Gebärmutter anzusetzen ist, biologisch nicht schlüssig, da der embryo-maternale „Dialog“ vor der Implantation als Bedingung der Möglichkeit für die Einnistung des Embryos beginnen muss. Der menschliche Embryo durchläuft dann eine typisch menschliche Entwicklung. Neben der Selbstbewegung und Gestaltwerdung des Embryos findet eine Ortsbewegung statt. Er wandert vom Eileiter zur Gebärmutter. Selbstbewegung im Sinne des inneren Wachstums und Ortsbewegung gehören zusammen. Die Zygote wächst heran und die Zellverbindungen verdichten sich. Der sich entwickelnde Embryo darf nach außen hin nicht an Größe zunehmen, sonst bleibt er bei der Wanderung zur Gebärmutter im Eileiter stecken. So gehören Wachstum, Verdichtung und Kompaktierung zusammen.
Nach der Entstehung der Zygote beginnt einige Stunden später die erste Zellteilung. Bald danach folgen die nächsten. Diese Zellteilungen gehen „von selbst“ und aus sich selbst heraus, nahezu selbstverständlich. Die Teilungen gehen immer weiter, nichts kann sie stoppen, nur der Tod. Mancher Biologe fragt sich, woher die Zellen „wissen“, dass sie sich teilen müssen und wie sie sich teilen müssen, damit Leber-, Gehirn- oder Muskelzellen entstehen. Mancher Biologe fragt sogar, wie eine Zelle „denkt“ und wie sie mit anderen Zellen kommuniziert. Denken und Kommunizieren sind eigentlich geisteswissenschaftliche Begriffe. Zellen denken nicht, aber sie kommunizieren miteinander und tauschen sich über Hormone, Zellmembranen und haptische Kontakte aus. „Solange diese vier Funktionen (Vermehrung, Stoffwechsel, Abgrenzung, Kommunikation) aufrecht sind, lebt die Zelle.“17 Aufgrund dieser Kommunikation ist die Frage nach dem Denken der Zellen nicht falsch gestellt, denn offensichtlich wohnt dem biologischen Leben, zumal dem menschlichen, ein gewisser „Geist“, ein logos, eine Urlogik und Urvernunft inne.
Dass die Zellteilungen reibungslos vonstatten gehen, ist gar nicht selbstverständlich. Denn bei jeder Zellteilung muss das genetische Material im Zellkern sowie das gesamte Zytoplasma, das um den Zellkern herum gruppiert ist, verdoppelt werden. Dann muss die Zellteilung akkurat und vollständig vonstatten gehen, so dass wirklich zwei neue Zellen entstehen. Diese Zellteilungen finden nicht nur in der Embryonalentwicklung statt, sondern ständig auch im ausgewachsenen Organismus. In jeder Sekunde werden Milliarden Zellen neu produziert, sie werden aufgebaut, abgebaut, umgebaut. Bei all diesen Verdoppelungs-, Abschreibe- und Teilungsprozessen können Fehler passieren. Diese Fehler werden im Organismus aber repariert oder aber die Zellen werden ausgesondert, wenn die Reparatur nicht gelingt (Apoptose). Der Organismus hat eine Vielzahl von „checkpoints“, an denen jede Zelle, bevor sie in den Kreislauf gelangt, auf ihre Funktionstüchtigkeit hin untersucht wird.
Bei der milliardenfachen Anzahl diese Zellteilungen und Vermehrungsschritte ist es nicht verwunderlich (eher sogar wahrscheinlich), dass einmal einer dieser Schritte nicht funktioniert und der Fehler nicht repariert wird. Es können genetische Veränderungen eintreten, Mutationen auf den Chromosomen stattfinden oder Chromosomen falsch verteilt werden. Wenn zum Beispiel ein Chromosom in der Zelle zuviel ist, entstehen Schäden beim Embryo. Die bekannteste Krankheit ist die Trisomie 21, bei der das Chromosom 21 dreimal vorhanden ist (Down Syndrom).
Hat der Embryo einen genetischen Schaden, kann dieser zu einer Krankheit führen, muss aber nicht. Das hängt mit dem physiologischen Mechanismus zusammen, dass Gene aktiviert und inaktiviert werden müssen. Nur aktivierte kranke Gene führen zu einer Krankheit. Wird ein geschädigtes Gen nicht aktiviert, entsteht auch keine Krankheit. Bei der Vielzahl der milliardenfachen Zellteilungsprozesse sind Abschreibefehler statistisch gesehen viel wahrscheinlicher als das Gelingen dieser Prozesse. All diese Mechanismen laufen „von selbst“ und nahezu selbstverständlich ab, aber selbstverständlich sind sie gerade wegen der hohen Fehlerwahrscheinlichkeit nicht. Es sterben auch immer wieder Embryonen ab.
Ab dem Achtzellstadium beginnen sich die Zellen in die etwa zweihundertzwanzig verschiedenen Zelltypen zu differenzieren. Diese Differenzierung geschieht ebenfalls dadurch, dass einzelne Gene ab- und andere angeschaltet werden. Jede Zelle enthält dieselben etwa dreißigtausend Gene (Ausnahme Same und Eizelle und einige andere Zelltypen). Durch das Abschalten einzelner Gene entstehen die verschiedenen Zelltypen. Man nennt diesen Prozess Methylierung (da Methylgruppen an die Gene angeheftet werden) oder auch Imprinting, da jeder Zelltyp seinen individuellen Fingerabdruck bekommt. Es ist etwa so wie bei einer Flöte, bei der unterschiedliche Töne herauskommen, je nachdem welche Löcher offen oder geschlossen sind. Da die Zellen alle dieselbe Grundinformation haben und lediglich in den unterschiedlichen Zelltypen je anders geschaltet sind, können womöglich geschädigte Zellen durch andere Zellen von einem ursprünglich anderen Zelltypus ersetzt werden. Sie können womöglich umprogrammiert werden.
Ein Zelltyp ist bei dieser Zelldifferenzierung ganz eigenartig: er fängt irgendwann einmal an zu zucken. Diese Kontraktionen vollzieht er dann siebzig Mal in der Minute und dies oft siebzig oder achtzig Jahre lang. Es sind dies die Herzzellen. Diese Zellen kontrahieren sich von selbst, das Herz schlägt von selbst, niemand weiß genau warum, selbst wenn man die physiologischen Mechanismen kennt. Wenn es nicht mehr schlägt, kann die Medizin es nach einem Herzstillstand manchmal wieder zum Schlagen bringen. Man nennt diesen Vorgang eine re-anima-tion, was wörtlich bedeutet: die Seele zurückgeben. Dem Organismus wird im übertragenen Sinn die Seele im Sinne der Lebenskraft zurückgegeben, indem das Herz wieder anfängt zu schlagen. Dann aber muss es wieder von selbst schlagen, machen kann der Mensch den Herzschlag nicht. Auch dies ist ein „Von selbst“, etwas vermeintlich Selbstverständliches. Aber selbstverständlich ist es nicht. Bei der millionenfachen Schlagzahl des Herzens ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zwischendurch einmal aufhört zu schlagen, sehr viel größer.
Um den dritten Monat herum sind die Organe und das Gehirn angelegt. Jetzt finden kaum noch Zelldifferenzierungen statt, sondern der Embryo, der ab jetzt Fetus genannt wird, wächst nur noch heran. Das erste Sinnesorgan, das sich entwickelt, ist das Ohr. Der Embryo beginnt zu hören und nimmt den Rhythmus des Herzschlages der Mutter wahr. Die Wahrnehmung des jungen Menschen beginnt also mit der Wahrnehmung eines Rhythmus’. Spätestens jetzt (wahrscheinlich schon früher) beginnt auch der emotionale Dialog mit der Mutter. Der Fetus wird in ihren Rhythmus mit hineingenommen, die pränatale Psychologie weiß einiges davon. Hier werden erste Weichen für die weitere Biographie des Menschen gestellt.
Dass die Zelldifferenzierungen durch die erwähnten Abschaltmechanismen geschehen, bedeutet, dass die Information für den Organismus nicht allein in den Genen liegt, sondern verteilt ist auf die genetische Grundinformation und die epigenetische Schaltinformation aus der Umgebung (Epigenetik). Diese die Gene an- und abschaltenden Faktoren sind zum Teil bekannt, zum Teil noch unbekannt. Sie liegen auf den Chromosomen in den Bereichen zwischen den Genen (diese Abschnitte hat man bisher für billiges Zeug gehalten, cheap junk), sie liegen im Zytoplasma der Zellen, sie bestehen in der Interaktion zwischen den Genen selbst und den Genen mit den Proteinen. Im erwachsenen Organismus reichen diese Interaktionen bis zum Nervensystem und zum menschlichen Gehirn.„Auch das Gehirn … nimmt direkten Einfluß darauf, welche Gene einer Zelle aktiviert und welche Funktionen von der Zelle infolgedessen ausgeführt werden.“18 Die Information liegt aber nicht nur in den Genen (DNS, Desoxyribonucleinsäure) und ihrer Umgebung, sondern vor allem auch in der Ribonucleinsäure (RNS).„Information und Stoffwechsel. Die zwei wichtigsten Eigenschaften des Lebens. Beide in einem Molekül“19, nämlich der RNS.