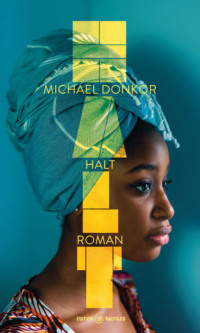Kitabı oku: «Halt», sayfa 5
9
Obwohl Amma die Vorstellung einer »schwarzen Eva« abgedroschen fand und obwohl sie sich nicht gern zur Schau stellte, hatte sie zugesagt, an diesem Mittwochnachmittag Modell zu stehen, weil Helena sie darum gebeten hatte. So war es schon immer gewesen: Als sie noch die Prep School besuchten und Helena keine Lust hatte, bei Versammlungen neben diesem oder jenem Mädchen zu stehen oder in der Pause wieder die Krankenschwester zu spielen, trug sie ihre Bitte so beschwingt vor oder spielte so anmutig mit ihrem feinen, gelben Haar, dass man sich unweigerlich fügte. Und so saß Amma nun artig in Helenas Wintergarten in Dulwich, inmitten einer Reihe von Yucca-Palmen, und hielt einen Granny Smith hoch, auf dass Helena ihre Aufgabe für den Kunstkurs erfüllen konnte. Amma hatte zuvor noch nie für ein Porträt »posiert« und verspürte nicht den geringsten Wunsch, diese Erfahrung heißen Unbehagens zu wiederholen, bei der sie jedweden Juckreiz unterdrücken musste. Helena stand ihr gegenüber und blinzelte, als wollte sie so auf Ammas innere Ablehnung reagieren. Amma sah zu, wie sie theatralisch den Pinsel schwang und das Gemälde mit einem letzten Strich versah.
»Und jetzt die Dröhnung zur Belohnung, wie versprochen.« Helena nahm die CD von De La Soul raus und legte Bob Dylan ein, wischte sich die Hände an ihrem ausgeblichenen Babar-T-Shirt ab, griff nach der hölzernen Haschpfeife zu ihrer Linken und klopfte die Asche heraus. Dann wühlte sie in ihren Taschen. »Hat sich die dunkle Wolke immer noch nicht verzogen, ma petite sœur?«, fragte Helena und spähte in den wiedergefundenen Beutel.
»Wie meinen?«
»Ist doch klar: Du machst schon die ganze Zeit ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter.«
»Du hast gesagt, ich soll ›nachdenklich dreinblicken‹, und daran halt –«
»Und wieso hast du mich bei Max dermaßen hängen lassen, hmm? Du hättest für mich da sein müssen, Mann.«
»Ich war ja da.«
»Ach komm, Am. Ich hätte deine Unterstützung gebraucht. Lavender war außer Rand und Band. Allmählich wird sie zur Lachnummer. Als hätte sie vergessen, dass sie tatsächlich – oder angeblich – Feministin ist.«
Amma drehte den Hals hin und her, bis es knackte, und legte den Apfel auf dem nächstgelegenen Bücherregal ab.
»Yeah. Hast vermutlich recht. Sicher.«
»Was?«
»Nichts. Lass uns nicht über die Party bei Max reden. Bitte.«
»Von mir aus. Kein Problem.« Helena klickte ihr Feuerzeug, nahm einen tiefen Zug und blies eine stattliche weiße Säule aus. »Du sollst nichts tun oder sagen, was dir … unangenehm wäre.«
Amma verdrehte die Augen.
»Am, ich versuche nur, nett zu sein. So, wie du dich benimmst, brauchst du gerade jemanden, der nett zu dir ist. Das willst du doch? Also gebe ich mein Bestes. Okay?«
Helena wischte sich mit ihrem Ärmel voller Farbkleckse über den winzigen Mund und gab die Pfeife weiter. Amma inhalierte noch tiefer und antwortete, während sie konzentriert ausatmete: »Im Ernst. Lass uns über was anderes reden. So untypisch es dir erscheinen mag, befällt mich gerade ein übermächtiger Drang nach Alltäglichem, meine Teure.«
»Das klingt wirklich seltsam und … widerwärtig.«
»So war das aber nicht gemeint.«
Beide Mädchen saßen schweigend da, während das milchige Sonnenlicht mit dem bläulichen Dunst spielte, der in der Luft lag. Amma legte die Pfeife neben dem Apfel ab. Sie wollte gehen, aber das wäre grausam. Sie schloss die Augen und redete sich ein, sie könne noch mal von vorn beginnen. Als sie die Augen aufmachte, stand Helena wieder vor der Staffelei und runzelte die Stirn.
»Was ist? Was hast du?«, fragte Amma.
»Du hast wirklich die ganze Stimmung dieses Bildes versaut.«
»So kurzlebig sind also Freundlichkeit und Zuwendung, wenn du –«
»Im Ernst. Als hättest du’s … infiziert, mit diesem … diesem komischen Weltschmerz.«
»Wie war das noch mal mit dem Arbeiter und seinem Werkzeug?« Amma sprang auf, mit einem leichten Schwindel, und ging zu Helena, die vor sich hin murrte: »Arbeiterin. Ihr Werkzeug.«
Auf der Leinwand erblickte Amma etwas Wildes. Triefende Streifen von schmutzigem Braun und rote Sprenkel. Nach oben hin dunklere Wellen. Zerschrammte Stellen, vielleicht mit dem spitzen Ende des Pinsels hineingekratzt. Mum würde sich direkt davor stellen und jammern, sie könne nicht erkennen, was hier die Frucht sein sollte, was ein Bein, was ein Auge. Auf Amma wirkte der Strudel feuchter Farben, dieses Verschwommene und das bedrohliche Gefühl, es könne sich verwandeln oder wachsen, vollkommen vertraut. Sie lachte in sich hinein.
»Was ist denn so lustig?«
»Nichts. War nur so ein privater Gedanke. Tut mir leid.«
»Warum teilst du den Gedanken nicht mit? Wäre doch nur fair.«
Helenas Stirn und ihre Augenbrauen arbeiteten so heftig, dass sich das glitzernde Bindi löste, das sie neuerdings trug. Amma hob es auf, reichte es ihr. Helena drückte sich den Punkt akkurat wieder auf die Stirn. Dann prüfte sie ihr Spiegelbild in einer der Scheiben, und Amma fiel auf, wie beglückt sie aussah. Wie leicht dieses Glück zustandekam.
»Wann hattest du am meisten Angst?«, fragte Amma.
»Komische Frage.«
»Sag schon.«
»Warum willst du das wissen?«
»Was sträubst du dich so, ma chérie?«
Helenas gerötete Augen blitzten. »Als ich glaubte, ich würde ertrinken. Aber das weißt du doch. Also willst du etwas –«
»Macht nichts. Erzähl einfach weiter.«
»Okay. Ich muss so acht gewesen sein. Mum war damals mit diesem gruseligen Cellisten zusammen.«
»Ach der. Mit den Zähnen und den Fingernägeln.«
»Wir waren zu dritt in Cornwall. Er war noch nie dort gewesen und Mum freute sich wie ein Kind, ihm alles zu zeigen und bla bla bla. Irgendwann mal nachmittags waren wir am Strand und ich schwamm im Meer. Gar nicht so weit draußen, weil ich ja ein braves Mädchen bin und die Regeln kenne –«
»Stimmt genau.«
»Und dann hatte ich einen Krampf, er wand sich irgendwie um mein Bein, es fühlte sich an wie zusammengepresst. Ich hatte keine Ahnung, was mit mir los war. Es war grauenhaft. Ich schluckte Wasser. Ich schrie. Mir kam es vor wie Stunden, aber das ist in solchen … solchen Krisenmomenten immer so, oder? Dass die Zeit sich dehnt? Ich wette, in Wahrheit dauerte es nur fünfzehn Sekunden oder so, bis der Cellist kam und mich aus dem Wasser holte. Und so war er immerhin zu etwas gut.« Helena lachte auf und nahm einen anderen Pinsel.
Amma gefiel nicht, was sie da gerade machte – dass sie ihrer Freundin eine Leistung abverlangte, mit der sie sich selbst etwas beweisen wollte, etwas, was sie bereits erkannt hatte, ohne dass diese Erkenntnis irgendeine Veränderung bewirken könnte. Die Wahrheit drängte sich aber auf, als Amma sah, wie begeistert Helena erzählte und sich die Einzelheiten in Erinnerung rief. Mit Angst ging Helena locker um, vielleicht, weil sie später darüber sprechen konnte. Amma konnte das, was sie preisgeben wollte, nicht so unbekümmert erzählen. Konnte sich damit keine Späße erlauben.
Als Helena ihr die Pfeife anbot, hustete Amma und schüttelte den Kopf. Sie kehrte zum Rattansessel zurück und nahm den Apfel in die Hand. »Okay, lass uns weitermachen. Saß ich eben so?« Amma versuchte, die Pose von vorhin wieder einzunehmen. »Oder so?«
»Was, jetzt? Machen wir weiter? Ich komme ja gar nicht hinterher.«
»Oder eher so? So?«
Mit feierlichem Ernst reinigte Helena ihren Pinsel in trübem Wasser, schniefte und seufzte, was Amma jedoch nur mit halbem Ohr hörte, weil sie die Hochglanzhaut des Apfels betrachtete und sich fragte, wie Helena wohl reagieren würde, falls sie die drei weichen braunen Stellen eindrückte: drei winzige Dellen von widerwärtiger Empfindlichkeit.
10
Früher an diesem Tag sichtete Nana in Belindas neuem Zimmer ihre Habseligkeiten. Belinda sah zu, die Finger fest um ihre Daumen gepresst. Nana prüfte sämtliche Kleidungsstücke und reagierte auf jedes T-Shirt und auf jede Shorts mit einem enttäuschten Seufzer. Sie beklagte sich darüber, dass sie in letzter Zeit nie Gelegenheit für einen richtig schönen Fraueneinkaufsbummel bekommen habe. Sie war der Meinung, Belinda solle ihre neue Umgebung erkunden, und zwar bald, bevor es allzu schwül werde. Sie versprach ihr, sie würden zusammen viel Spaß haben.
Und so machten sie sich zu Marks & Spencer auf. Belinda ging dicht hinter Nana, als sie sich ihren Weg durch die lärmende Brixton High Road bahnten. Die Spätsommerhitze lastete auf Belindas Schultern. Der Himmel war öde, der Verkehr grimmig. Um sie herum wurde nur gehupt oder gebrüllt. Fahrradfahrer drehten sich um und beschimpften Autofahrer. Drei weiße Transporter mit Streifen und wirbelndem Blaulicht ächzten. Busse wanden sich um Straßenecken wie kränkliche Raupen. Mit Bedacht mieden Nana und Belinda die stämmigen schwarzen Mülltonnen, die vor Packungen und Flaschen überquollen und Nana »Lambeth Council« zischen ließen, als hätte sie gerade einen misslungenen kenkey gekostet. Ein hochgewachsener Mann mit Rollen an den Schuhen bewegte sich seelenruhig fort. Er überholte sie und verlor sich dann in der Ferne als dünne, senkrechte Linie inmitten der Menge. Nirgendwo war Platz, die Straße war zu voll, der Bürgersteig zu schmal, um alle aufzunehmen, die sich hier drängten. Nana marschierte weiter, deutete mit zwei entschiedenen Fingern nach vorn und schwang ihre gelbe Handtasche mit den kleinen LVs. Belinda versuchte, Schritt zu halten, drohte aber ständig, mit anderen zusammenzustoßen, so sehr zog die Umgebung ihre Aufmerksamkeit auf sich.
Zu ihrer Linken spielte vor einem riesigen Geschäft – Iceland – eine Gruppe von Kindern auf silbernen Trommeln, die Belinda an die Eimer erinnerten, mit denen sie Wasser vom Fluss geholt hatte, wenn die Dorfpumpe defekt war. Der wabernde Klang ließ die Luft schimmern. Zwei Frauen mit Schlapphüten waren vor der Band stehen geblieben, um zu tanzen, sie wackelten mit dem Hintern und hielten sich die Brüste. Neben einem noch riesigeren Geschäft – Morley’s – bildeten muskulöse Männer in knappen Unterhemden einen Kreis. Lässig trugen sie Gewehre aus buntem Plastik. Eine Spaßarmee. Sie drückten das Ende ihrer vermeintlichen Waffen gegen den Boden, als wollten sie sich darauf stützen. Um die Männer bildete sich ein größerer Kreis aus jungen Frauen. Sie spielten mit den kleinen Schmucksteinen, die ihnen aus dem Nabel sprossen, fuhren mit dem Finger über die Zeichnungen auf ihren Armen, redeten mit den Hündchen zu ihren Füßen, die ins Leere bissen. Alle paar Sekunden drückte einer der Männer den Abzug und verspritzte Wasser. Die jungen Frauen kreischten, als hätte sie das überrascht, die Hündchen wurden wild und die Männer schüttelten reihum Hände. Nana murmelte vor sich hin. Belinda wünschte, sie könnte ihre Worte verstehen, aber Nana schien sehr darum bemüht, extrem leise zu sprechen.
Gegenüber von Superdrug stolperte Belinda und fiel auf die Knie. Ein Mädchen mit roter Kappe und einem Bündel Flyer in der Hand half ihr wieder auf. Kichernd fragte sie Belinda, ob sie okay sei. Belinda brauchte eine Weile, um aufzustehen und sich auf das Gesagte zu besinnen, denn das Bild auf dem Flyer hatte sie abgelenkt: ein schwarzes Baby mit zugekniffenen Augen, dem Tränen über die staubigen Wangen liefen. Das Mädchen forderte Nana auf, mit nur fünf Pfund monatlich einen Beitrag zur Rettung von Kindern zu leisten. Nana winkte ab.
Belinda hatte schon erlebt, was eine Menschenmenge war. Sie hatte sich durch New Tafo gekämpft. Sie hatte sich dem Block todesmutiger Fußgänger angeschlossen, die über die Wahnsinnskreuzung an der Kwadwo Kannin Street hasteten. Das konnte man aber nicht vergleichen, denn hier zogen so viele weiße Gesichter vorbei.
Natürlich hatte sie davor auch schon oburoni gesehen: Leonardo DiCaprio und Julia Roberts in den Zeitschriften, die Aunty im Bad auf dem Boden liegen ließ, die Staatenlenker in den Nachrichten, den albernen jungen Mann im Zoo, die Familien in Heathrow. Belinda wusste über die merkwürdige Beschaffenheit ihres Haars Bescheid, über ihre noch merkwürdigeren Laute, die so klangen, als würden sie nicht durch den Mund, sondern durch die Nase nach außen dringen. Doch hier wirkten die oburoni sogar noch merkwürdiger. So entschlossen. Oder konzentriert. Ja, ihre blassen Augen richteten sich mit aller Konzentration auf etwas sehr Wichtiges. Und auch sie waren wichtig, mit ihren hoch erhobenen Köpfen und den straffen Schultern und den fast schon wütenden Gesichtern. Bestimmt viel zu wichtig, um sie wahrzunehmen. Aber würde Belinda ihnen missfallen, wenn ihr Blick flüchtig auf sie fiele? Würde ihr Anblick ihre Gesichter noch röter werden lassen? Während sie einem Kind Platz machte, das an einer Stretchleine geführt wurde – für einen der kläffenden Hunde wäre sie bestimmt passender gewesen –, fragte sich Belinda, ob Nana jemals diese lächerliche Angst vor Weißen empfunden hatte. Und wie sie diese losgeworden war. Denn wie sollte man hier mit dieser kribbelnden Angst leben? Wie sollte man atmen, denken, überhaupt etwas tun?
Schließlich erreichten sie Marks & Spencer. Als sie die Schiebetüren passierten, versuchte Belinda die Quelle der quäkenden Hintergrundmusik zu orten. Nana riss sie mit, von diversen roten Schildern verlockt. Belinda blinzelte in diesem grellen Licht. Der Raum wurde durch Kleiderständer unterteilt, durch Blöcke unterschiedlicher Muster. Daneben standen Tische voller Blusen, manche waren gefaltet, andere hingen schon halb auf dem Boden. Frauen rissen Kleidungsstücke von den Bügeln, prüften rasch die Schilder am Ärmel und warfen die Sachen achtlos hin. Junge Mädchen – die Töchter dieser Frauen? – fanden alles komisch und lachten darum unentwegt, zeigten dabei winzige Zähne, die von Metalldrähten umspannt waren. Nana drehte sich plötzlich um und presste Belinda ein grünes Oberteil mit nur einem Ärmel an die Brust, strich es mit resoluten Gesten glatt. Belinda hielt die Luft an, als Nana die Nase rümpfte, das Oberteil fallen ließ und es mit einer blauen Version versuchte. Auch diese gefiel ihr nicht.
So machten sie noch eine Weile weiter. Nana hielt Belinda Getüpfeltes, Gerüschtes und Samtiges hin. Nach gefühlt zehn Minuten erblickte Belinda, in deren Kniekehlen sich allmählich Feuchtigkeit sammelte, die Kinderabteilung weiter vorne. Sie wurde durch ein Plakat angezeigt, das von der Decke hing. Darauf lächelte ein nicht ganz weißes, nicht ganz schwarzes Mädchen in der denkbar dümmlichsten Weise. Belinda wurde auf einmal bewusst, dass hier viele Plakate mit multiethnischen Mädchen warben. Nachdem Nana sie in eine Umkleidekabine gescheucht hatte, schnaubte Belinda, weil sie genau wusste, was Mary am liebsten tun würde. Mary würde dieses eine Bild am liebsten herunterreißen, darauf herumtrampeln und der Abteilungsleitung sagen, dass sie es durch etwas viel, viel Besseres ersetzen sollten, nämlich durch ein schönes Foto von ihr, Mary. Und wieder schnaubte Belinda. Die weiße Box um sie herum war eng und rein, ihr Spiegelbild reglos. Das Stimmengewirr der Kauflustigen war nur noch als Rauschen im Hintergrund zu vernehmen. Da war nichts als diese alberne Vision von Mary und der Luftzug um ihre Knöchel. Aber dann stieß eine Hand durch den Vorhang. Sie umklammerte drei Jeanshemden.
11
Tratschend wie die verhutzelten Frauen, die Belinda vor dem Costcutter-Supermarkt in der Norwood Road gesehen hatte, erzählte Mary, dass Aunty und Uncle für ihre Kinder Antoinette und Stephen kleine »Ferienhütten« neben ihrem Haus bauen lassen wollten. Belinda hätte sich daran beteiligen und Mary verraten können, dass die Otuos mehrere Wohnungen und Häuser besaßen, Häuser, die sie nicht einmal selbst benötigten, Häuser, die für Fremde gebaut worden waren. Pim-li-co. Vaux-hall. Das neueste in Clap-ham. Aber das behielt sie für sich.
Das Treppenhaus um sie herum – in einer vornehm zurückhaltenden Farbe namens »Entenei« gestrichen, wie sie inzwischen wusste – war langweilig, und so spielte sie mit dem Top, das Nana bei Monsoon für sie gekauft hatte, eine unerwartete Belohnung. Hübsch, zart und luftig. Es gehörte zu den Dingen, die Belinda ihrer Mutter höchstens nach reiflicher Überlegung zeigen würde. Als hätte sie auf dem Heimweg von der Schule Kiesel gesammelt, die wundersamerweise alle die gleiche Größe, die gleiche Form und die gleiche Farbe hatten. Es war zwar schwer, bis ins kleinste Detail vorauszusehen, wie Mutter auf etwas so Besonderes reagieren würde, aber das Ergebnis stand von vornherein fest. Es kam Belinda grundfalsch vor, sich vor der eigenen Mutter zu fürchten.
Belinda hörte auf, das Blumenmuster zu befingern. Sie hatte bemerkt, dass Mary am anderen Ende der Leitung die Sprechgeschwindigkeit gewechselt hatte.
»Und du?«
»Und ich?«
»Mach jetzt nicht den Papa-Papagei, Belinda.«
»Sagen wir’s mal so: Ich gehe ganz, ganz behutsam vor, damit es besser wird.«
»Was besser wird?«
»Mein Verhältnis zu Amma. Das ist so oder so die Hauptsache.«
»Aane! Hatte ich es dir nicht gesagt? Du bist die Größte.« Mary machte ein Geräusch, das tiefe Weisheit signalisieren sollte. »Erzähl mir mehr.«
»Viel Neues habe ich nicht zu berichten, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Im Grunde nur, dass sie … sie hat meinen Namen gekürzt. Mir einen Spitznamen verpasst. Be. Be statt wie sonst Belinda. Nur ›Be‹. Nicht schlecht, eh?«
»Be? Wie … Bäh?«
»Na ja –«
»Klingt nach einem Baby – wie wenn sie dich kleiner machen will, als du bist. Damit sie weniger Angst haben braucht. Was hat meine Belinda nur gemacht, um der weißen Königin so viel Angst einzujagen? Ha, muss was richtig Schlimmes gewesen sein, wenn sie dir den Namen abschneidet, damit du weniger Macht hast!«
»Ich glaube, das war nett gemeint. Freundschaftlich.«
»Vielleicht. Vielleicht habe ich es falsch verstanden. Kommt manchmal vor.« Mary hielt kurz inne. »Hast du für sie auch einen eigenen Spitznamen? Für deine neue Busenfreundin oder wie immer man das nennt?«
»Nein. Gar nicht. Wie ich dir schon letztes Mal erzählt habe, reden wir kaum miteinander, und so brauche ich auch keinen Spitznamen für sie. Mich nennt sie erst seit ein paar Tagen ›Be‹. Seit sie zwischendurch doch mal den Mund aufmacht. Das lässt mich hoffen.«
»Ist ihre Zunge immer noch so verschlossen? Und du bist doch schon zwei ganze Wochen da. Kai! Dann bin ich also nicht die einzige, die Probleme hat.«
»Probleme? Was denn für Probleme?«
»Nur das Übliche. Die gleichen wie immer.«
»Was soll das heißen? Raus damit, Mary. Oder ›Mare‹. Wie hört sich das an? Gut?«
Mary atmete tief und hörbar durch.
»Soll mein ganzes Leben daraus bestehen, dass ich nur klitzekleine klitzekurze Gespräche mit dir führen darf und dann die Vogelscheiße von der Veranda kratze, und so geht das hundert Jahre weiter und dann ist mein Kopf so grau wie der von Uncle? Ist doch so. Den ganzen Tag darf ich nur mit diesem schrecklichen Spezialtuch über alle Glasflächen wischen, und das stundenlang, damit alles schön glänzt, wenn Aunty nachprüft. Von diesem Tuch kriege ich Juckreiz an den Händen, weißt du ja. Und es dauert ewig, bis man diese weißen Wasserränder weghat. Ich weiß, wie viele Stunden ich mit diesen Gläsern zubringen werde, und dann hasse ich sogar das Wasser, obwohl wir es doch alle trinken müssen, sonst sterben wir.« Mary schmatzte. »Ich warte auf nichts anderes als darauf, dass Aunty lächelt und mir sagt, damit könnte ich vorläufig aufhören und mir das Nächste auf der Liste vornehmen. Wie soll ich das ein Leben lang durchhalten? Als Roboter ohne Träume.«
Belinda drehte die Anglepoise-Lampe auf dem Beistelltisch weg, sie wollte sich nicht blenden lassen. »Du darfst eins nicht vergessen, Mary: Es ist ein großes Glück, dass wir in diesem Haus gelandet sind.«
»Glück? So empfinde ich das nicht. Ganz im Gegenteil.«
»Ich weiß, manchmal ist die Arbeit hart –«
»Manchmal? Immer. Jeden Tag sitze ich hier auf dem Boden in der Küche und versuche –«
»Du musst es dir vorstellen. So bin ich da rangegangen.«
»Was vorstellen?«
»Dir vorstellen, dass du zu den Mädchen gehörst, die damit klarkommen, auch wenn das nicht der Fall ist. Stell dir sogar vor, du gehörst zu denen, die daran richtig Spaß haben. Wenn du es als Mary nicht schaffst, musst du bei der Arbeit eben eine andere sein, eh? Wa te?« Mary brummelte. »Erzähl es mir, eh, erzähl mir, wer du sein wirst, lass uns ein bisschen spielen – wer ist das Mädchen, dem es nichts ausmacht, Haare aus dem Abfluss zu fischen? Wir könnten ihr einen –«
»Kann nur eine Verrückte sein. Das steht schon mal fest.«
»Lass uns diesem Mädchen einen Namen geben und ein Alter und eine Geschichte. Komm schon, Mary. Versuch es wenigstens. Mach die Augen zu.«
»Okay. Wenn’s dich glücklich macht.«
»Hey, Mini-Lady! Ich seh doch, dass deine Augen noch offen sind.«
»Eine Hexe! Meine Schwester ist eine Übersee-Hexe.«
»Mach sie zu!«
»Mach ich.«
»Braves Mädchen.«
»Darf ich mir den Namen selbst aussuchen?«
»Nur zu.«
»Hhmmmmmm. Ich würde sie gern Cynthia nennen. Ist natürlich viel zu weiß für mich, der Name, aber ich glaube, er klingt so, wie wenn ein Engel atmet.«
»Sehr vornehm, der Name einer richtigen Prinzessin. Okay. Okay, Cynthia. Und wie alt ist Cynthia?«
»Dreizehn. Gerade erwachsen geworden.«
»Hervorragend … Gut machst du das.«
»Danke dir.«
»Und … Sag mir: Was macht Cynthia am allerliebsten im Haushalt? Worauf freut sie sich am meisten, wenn sie morgens aufwacht?«
»Das ist schwer zu beantworten, aber … vielleicht macht es ihr richtig Spaß, Pfeffer für den Kontomire zu mahlen. Sie zerreibt ihn mit dem Stößel so gründlich, wie es nur geht, damit er so köstlich schmeckt wie nur möglich.«
»Gut.«
»Das mit den Zwiebeln macht sie auch gern. Es kommt ihr vor wie Zauberei, dass einem die Tränen aus den Augen schießen, wenn man sie schneidet, als hätte man wirklich einen Grund zum Weinen, selbst wenn man keinen hat oder sogar allerbester Laune ist.«
»Und ich weiß noch etwas über Cynthia – wenn … wenn du nichts dagegen hast, dass ich auch etwas hinzufüge?«
»Ich will mal nicht so sein.«
»Sie hat keine Angst vor nichts. Wenn sie also bis ganz oben auf die Leiter steigen muss, um die Ecken an der Decke sauberzumachen oder die Ventilatoren zu wischen, kann sie das ohne Weiteres, auch wenn sie innerlich vielleicht ein bisschen zittert. Und sie hat noch eine andere Lieblingstätigkeit: Gläser polieren.«
»Warum sollte sich das überhaupt jemand freiwillig antun?«
»Sie … Sie liebt diesen Anblick, wenn die Gläser alle in den Regalen aufgereiht sind. Und wenn dann das Licht auf die Gläser fällt, ist das für sie die reine Vollkommenheit … Wenn sie das sieht, denkt sie an den Himmel, passend zu ihrem Engelsnamen. Und ja, das Tuch tut ihren Fingern manchmal ein bisschen weh. Dieses Gekribbel ist aber ein gutes Zeichen. Es beweist, dass sie kein Faulpelz ist, im Gegensatz zu all diesen alten Männern in ihrem Dorf, die auf der Straße saufen und dann nach ihren Frauen rufen, wenn die Flasche leer ist, damit sie ihnen das Abendessen machen. Sie ist eine, die anpackt –«
»Adjei! Wir haben Cynthia kein Zuhause und keinen Heimatort gegeben! Das ist ein schweres Versäumnis. Machen wir sie zu einer Fante, wegen dieser schönen gelb-gelblichen Haut. Sie könnte aus einem Dörfchen in der Nähe von Takoradi kommen.«
»Das Wichtigste ist, dass Cynthia harte Arbeit liebt. Es macht sie stolz, dieses Gefühl, dass sie tätig ist, nicht untätig.«
»Ist sie hübsch?«
»Sehr. Miss World 2002.«
»Sie hat wunderschöne weiße Zähne, alle makellos, und ein schönes Kleid mit gemusterten Ärmeln, es war sehr teuer, es nähen zu lassen.«
»OK.«
»Und sie steht ganz gerade und aufrecht da. Und wenn sie irgendwo hingeht, tut sie das mit hoch erhobenem Kopf, und sie benimmt sich anständig, schlurft nicht so mit den Füßen über den Boden wie ich beim Gehen.«
»Ganz genau. Wenn du also das nächste Mal etwas Neues aufgetragen bekommst oder Aunty dich ruft, damit du ihr bei etwas anderem hilfst – denk dran, dass du Cynthia bist und dass Cynthia dann gleich aufspringt, mit einem strahlenden Lächeln und hoch erhobenem Kopf.«
»Ich werd’s versuchen. Auch wenn sich das ein bisschen komisch anhört. Das ist dir aber schon klar, oder? Dass es sich komisch anhört.«
»Sowas Ähnliches habe ich auch mal in Auntys Oprah-Sendung gehört. Weißt du noch? Diese schwarze Milliardärin mit dem Hals voller Schmuck?«
»Deine Aunty ist immer noch glühender Fan: GTV, jeden Tag Schlag 15 Uhr. Und ich gucke immer noch hinter der Tür mit. So viele Damen, die pausenlos jammern.«
»In der Sendung, die ich meine, sagte Oprah zu einer dieser Heulsusen: Fake it ’til ya make it.«
»Wo se sɛn?«
»Also … Wenn du lange genug so tust, als wärst du Cynthia, stellst du eines Tages fest, dass du … dass du zu Cynthia geworden bist.«
»Sa?«
»Glaub schon.«
»Das gefällt mir. Dass man sich so verwandeln kann, wie durch Zauberei. Erinnert mich an deine Verwandlung, wenn du mir vorgelesen hast. Erst warst du das Monster und dann warst du ein Hund und dann warst du tot. Und ich hätte dir das jedes Mal fast abgenommen. Sehr unterhaltsam. Das hast du super gemacht, echt.«
»Me da ase.«
»Vielleicht wär das für dich wieder das Richtige, Belinda.«
»Wo se sɛn?«
»Du könntest alles Mögliche machen, jetzt, wo du an diesem anderen Ort bist. Ganz andere Sachen machen als damals, als du noch hier warst. Aber du backst nur süßes Zeug und freust dich wie ein Kind, weil sie dich so nennt, wie man einen Welpen nennen würde.«
»Wie grob du bist. Schämst du dich nicht, so mit jemandem zu reden, der Geld und Zeit aufbringt, um dich anzurufen?« Belinda hatte das Gefühl, dass zwischen ihren Schulterblättern alles spannte und pochte.
»Tut mir leid. Ich. Nein, du hast recht.« Belinda hörte ein leises Scharren. »Wollen wir über was anderes reden? Meine Schwester soll nicht nur schlecht über mich denken, wenn sie den Hörer auflegt.«
Belinda sah Marys nachdenkliches Gesicht vor sich, mit tiefen Furchen, dunkel hob es sich von den hellen Wänden ab. »Na, dann erzähl mir doch noch mal von Christina Aguilera und diesen Halbhosen, die sie trägt. Das sieht bestimmt unmöglich aus. Scheußlich!«
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.