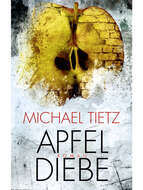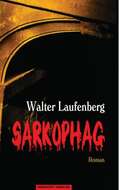Kitabı oku: «Rattentanz», sayfa 5
»Wie lange soll ich hier bleiben?«, wandte er sich an den Arzt.
»Mindestens bis morgen früh. Solange brauchen wir, um eine akute Blutung einigermaßen sicher ausschließen zu können.«
»Können Sie vergessen. Ich gehe!« Jost wollte sich erheben, wurde aber von Stefan mit sanfter Gewalt zurück in den Stuhl gedrückt. Der versuchte zu beruhigen: »Herr Jost, Sie haben einen Schock nach dem Unfall. Sie sollten sich hinlegen. Wirklich! Wir geben Ihnen eine Infusion und in drei, vier Stunden geht es Ihnen dann sicher wieder besser.« Eva bereitete nebenher alles für eine Infusion vor.
»Nein!«, donnerte Jost. »Bringen Sie mir irgendwas, das ich unterschreiben kann und dann verschwinde ich.« Er stand auf und wollte einen Schritt Richtung Tür machen, musste sich aber von dem Pfleger stützen lassen.
»Merken Sie denn nicht selbst, dass Sie viel zu schwach sind?«
»Aber was soll ich denn machen?« Valentin Jost klang verzweifelt.
»Meine Frau und die Kinder sind zu Hause, kein Strom, kein Telefon. Sie wissen doch gar nicht wo ich stecke, wenn ich heute Abend nicht pünktlich zurück bin.«
»Lasst ihn gehen«, beendete Stiller die Diskussion und war innerlich froh, diesen nicht existenten Patienten so schnell wieder loszuwerden. »Er soll unterschreiben, dass er gegen ärztlichen Rat das Haus verlässt und Schluss.«
Aleksandr Glück musterte Eva mit einer Mischung aus väterlicher Fürsorge und Verliebtheit. »Alles ein bisschen viel für den kleinen Doktor?« Eva lächelte; der kleine Doktor. Das passte.
»Er mag es gern, wenn hier alles schön geordnet abläuft und er dabei das Gefühl hat, die Dinge im Griff zu haben.« Glück nickte.
»Aber heute geht alles drunter und drüber.«
»Und das macht dem kleinen Doktor Angst.«
»Richtig.«
Glück zog sich seine Bettdecke bis unters Kinn. »Und Ihnen?«
»Bitte?« Eva hatte die Frage sehr wohl verstanden, aber keine Antwort parat.
»Haben Sie Angst?«
Eva war in den vergangenen zwei Stunden seit dem Stromausfall kaum zum Nachdenken gekommen. Die überstürzte Verlegung der Patienten, die Hektik, die Stiller verbreitete, ihr eigener Zustand und die permanente Übelkeit sowie Valentin Jost hatten sie völlig in Anspruch genommen. Quasi nebenher versorgte sie noch Aleksandr Glück. Hatte sie Angst? Machte sie sich Sorgen? Evas Blick fiel auf den leeren Himmel hinter den hermetisch abgeschlossenen großen Fensterscheiben.
»Schwästerrr?«
Eva konnte nicht anders, sie musste lächeln.
»Schwester, wissen Sie, ein wenig Angst hat noch keinem geschadet. Ist es nicht ganz normal sich zu fürchten, wenn man sich plötzlich einer unerwarteten, fremden Situation gegenübersieht?«
»Lea, meine Tochter, sie ist erst sieben. Sie ist bei einer Nachbarin. Hoffe ich.«
»Und Ihr Mann? Sie haben doch einen Mann?«
Eva nickte. Sie spürte Tränen in sich aufsteigen. Für diesen Moment konnte sie sie noch hinunterschlucken, aber sie wusste, dass der Pegel in ihr langsam anstieg und irgendwann überlaufen musste. »Mein Mann ist gestern Morgen nach Schweden geflogen. Glauben Sie, dass nur hier Flugzeuge abstürzen? Bei meinem Mann wird doch alles in Ordnung sein, oder?«
Hans saß vielleicht irgendwo in Südschweden fest. Wie würde es für sie und wie für Hans weitergehen, sollte sich nicht alles schnell wieder normalisieren? Wie ging es Lea? Sie versuchte diesen Gedanken mit aller Macht aus ihrem Kopf zu verbannen, aber je stärker ihr Bemühen, so schien es, desto übermächtiger und klarer wurde dieser Albtraum! Weit über eintausend Kilometer lagen zwischen ihnen. Ganz Deutschland und die Ostsee.
Glück nahm Evas Hand und zog sie zu sich heran. »Darauf weiß nur Gott allein eine Antwort. Und Ihr Herz.«
»Mein Herz.« Eva starrte aus dem Fenster. »Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen heute Morgen wohl ums Leben gekommen sein müssen. Keine einzige Maschine kreist mehr! Und alles passiert hier bei uns, keine zehn oder zwanzig Kilometer entfernt! Es macht mir Angst, dass so etwas passieren kann. Und dass es hier geschieht und nicht in Amerika oder Japan.« Sie streckte sich, griff mit beiden Händen hinter den Kopf und zog den blauen Haargummi straff, der ihre braunen Locken bändigte. »Wenn ich nur anrufen könnte und wüsste, wie es Lea und Hans geht.« Jetzt konnte sie die Tränen nicht länger zurückhalten.
»Mein Mädchen, komm, setzen Sie sich einen Moment zu mir.« Eva zögerte. »Oder haben Sie etwas Wichtigeres zu tun?«
»Sie haben keine Angst, oder?« Eva folgte der Einladung und setzte sich auf die Bettkante. »Sie wirken so ruhig … als könne Sie nichts mehr erschüttern.«
Aleksandr Glück hob die Augenbrauen. Über seine Lippen tanzte ein Lächeln − und Wissen.
»Wie lange liege ich jetzt schon hier?«, fragte er.
Eva wischte sich die Tränen mit dem Handrücken ab. »Vier Wochen«, antwortete sie.
Glück war vor vier Wochen der größte Teil des rechten Lungenflügels entfernt worden. Lungenkrebs, obwohl er, abgesehen von einer riesigen Zigarre zusammen mit Schulfreunden, niemals geraucht hatte. Lungenkrebs mit Metastasen in Leber, Darm und im Gehirn, wie in einer späteren Untersuchung festgestellt wurde. Die Diagnose war für den Einundsiebzigjährigen ein Hammerschlag. Als ob ihm im vollen Lauf jemand ein Bein stellte. Lungenkrebs. Vor der Operation machten ihm die Ärzte noch Hoffnung, sagten, er könne durchaus noch fünf, sechs Jahre leben, vorausgesetzt, das komplette Geschwür könne entfernt werden. Aber nachdem die Metastasen gefunden waren, hörte er keine konkreten Zahlen mehr, wenn er nach seiner Lebenserwartung fragte. Die Ärzte wichen seinen Fragen aus und wechselten das Thema oder vertrösteten ihn auf später. Und so verlegte er sich aufs Zuhören und Beobachten. Glück hörte zu und zählte eins und eins zusammen. Und begann zu verstehen.
Aleksandr Glück, aufgewachsen in einem sibirischen Lager, in dem während des Zweiten Weltkrieges Kollaborateure, unwichtige Kriegsgefangene und vor allem Deutschstämmige interniert waren, die generell Hochverrätern gleichgesetzt wurden, hatte früh gelernt, in der Stille der eigenen Gedanken die Dinge des Lebens zu verstehen. Und Entscheidungen zu treffen. Und so kam es für Professor Kellermann, der den Patienten noch in seliger Unwissenheit glaubte, völlig unerwartet, als der ihn bei einer der morgendlichen Visiten mit seinem Wissen um seinen baldigen Tod konfrontierte. Er bat den Chefarzt eindringlich um eine ehrliche Prognose. Kellermann legte sich auf höchstens sechs Monate fest, eher weniger.
Aber anders, als von seiner Umgebung erwartet, verfiel Glück nicht in Trauer und Resignation. Für das Gros derer, die mit einer solchen Aussage konfrontiert wurden, bedeutete das Rückzug und Depression. Sie verfielen in Selbstmitleid und ihre Gedanken kreisten, wie die Erde um die Sonne, unablässig um die eine, nie zu beantwortende Frage: warum ich?
Aleksandr Glück tröstete seine Frau, die, als er ihr die Nachricht versuchte schonend beizubringen, laut schreiend vor seinem Bett auf die Knie fiel.
»Wenn man, so wie ich, demnächst sterben muss, Schwester, dann verschieben sich die Relationen.« Er nahm ihre Hand. »Ich bin jetzt vier Wochen hier und an die meiste Zeit davon kann ich mich nicht erinnern.« Glück hatte achtzehn Tage im künstlichen Koma gelegen und war von Maschinen beatmet und ernährt worden. »Keiner weiß, warum die Flugzeuge abstürzen, warum kein Wasser läuft und …«
»… der Strom weg ist und keine Computer und Telefone funktionieren«, ergänzte Eva und putzte sich die Nase.
»Aber ich weiß«, fuhr Glück fort, »dass für mich heute ein schöner Tag ist. Sie sind hier Schwester und da die Station wohl fast leer ist, haben Sie ausnahmsweise einmal richtig Zeit für mich. Später wird meine Frau kommen und ich habe vielleicht noch nie einen so herrlich reinen Himmel gesehen wie heute«, sein Blick wanderte aus dem Fenster. »Nur dieses Brummen stört.«
»Das Notstromaggregat im Hof.«
Aleksandr Glück sah auf die batteriebetriebene Uhr über der Tür. Sie tickte weiter als sei nichts geschehen und zählte in regelmäßigen Intervallen die verfließende Zeit, egal ob es gute oder schlechte Zeit war. »Können Sie mir einen Kaffee bringen? Ich weiß, ich soll am besten Kamillentee trinken, aber von einem kleinen Tässchen werde ich bestimmt nicht gleich sterben.«
Eva stand mit einem wiedergefundenen Lächeln auf. »Mal sehen, was ich machen kann.«
10
09:03 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen, Aufzug 2
Zwei Kategorien von Ängsten gibt es: Eine Angst macht den Ängstlichen klein und allein, lähmt ihn und er bleibt sitzen mit seiner Angst wie das Kaninchen vor der Schlange. Die andere Angst ist eine gute Angst, die herausfordert und den Ängstlichen dazu bringt, sich zu wehren und zu kämpfen. Diese Angst macht ihn stärker und frei, während die erste Angst festkettet und den Ängstlichen dem Auslöser der Angst hilflos ausliefert.
Thomas Bachmann wusste noch nicht genau, welcher Art seine aktuelle Angst sein sollte. Noch immer war er ohne Licht, noch immer verharrte die Fahrstuhlkabine zwischen Keller und Erdgeschoss des Krankenhauses. Geräusche drangen kaum bis zu ihm vor und wenn, dann aus undefinierbarer Ferne. Um Hilfe geschrien hatte er bislang noch nicht.
Hilfe. »Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott!«, hatte seine Großmutter immer gesagt und anschließend die Arbeiten verrichtet, für die eigentlich ein Mann zuständig gewesen wäre. Thomas’ Großvater fand selten Zeit, die Wünsche seiner Frau zu erfüllen. Also schlug sie selbst die Nägel in die Wand, schleppte Holz und Kohlen aus dem Schuppen über den eisglatten Hof und schlachtete Hühner.
Thomas spielte mit seinen heiligen Knöpfen. Der grüne Ball lag noch irgendwo in einer der Ecken der Kabine.
Das Haus seiner Großeltern war der Ort, den er als sein Zuhause bezeichnete. Genauer: die Küche seiner Großmutter. Noch genauer: Die kleine Kommode neben dem Herd war sein Zuhause (gewesen). Großmutters Küche war einer der seltsamsten Räume, die er jemals kennengelernt hatte. Die Küche war groß, mit niedriger Holzbalkendecke, von der Wärme und Geborgenheit in den Raum und seine Gäste strömte. In der hintersten Ecke hatte Großmutter, durch einen schweren dunklen Vorhang den neugierigen Blicken der seltenen Besucher verborgen, ihr Holzbett stehen gehabt. Großvater schlief in seinem Schlafzimmer.
Der Herd war Thomas immer riesig vorgekommen, mit emaillierten Türen und Klappen an der Front und einer Ofenröhre, in der meist die Reste vom Mittagessen warm gehalten wurden oder ein paar Äpfel schmorten. Über dem Herd hingen Kräuter an einer dürren Holzstange. Die Kräuter − Majoran, Oregano, Dill, Pfefferminze − wuchsen in Großmutters Garten. Am Samstag, dem Tag, den er von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang bei ihr verbringen durfte, sah er ihr oft stundenlang bei der Arbeit zu und lauschte den Geschichten, die sie nebenher erzählte.
Großmutter hatte sich jeden Tag für ihn eine neue Geschichte ausgedacht und nie wiederholte sie sich dabei. Am liebsten hörte er die Abenteuer von Schnipp-Schnapp, dem kleinen Fuchs: Es war ein wunderschöner Tag im Wald. Die Vögel zwitscherten und über den blauen Himmel trieben ein paar fröhliche Schönwetterwolken. Tief unten im Fuchsbau wurde unser Schnipp-Schnapp wach. Er gähnte – Großmutter gähnte – und streckte sich – Großmutter unterbrach kurz ihre Arbeit und streckte sich – dann kletterte er schnell aus dem Fuchsbau raus und rannte runter an den Bach.Dort wusch er sich das Fell, das Gesicht und die Pfoten (genau in dieser Reihenfolge!) und putzte seine spitzen Schnipp-Schnapp-Zähne. Als er wieder nach Hause kam, hatte seine Mutter schon eine Schüssel Heidelbeeren und eine dicke, fette Maus für ihn zurechtgelegt … So und niemals anders begann jede der unzähligen Geschichten von Schnippi.
Am Umfang der Kräuterbündel und an ihrer Farbe konnte Thomas immer ziemlich exakt die Jahreszeit ablesen. Drängten sich die prallen Bündel dicht aneinander und zeigten die Blättchen noch ein letztes Grün, war es Herbst und die Tage wurden kürzer. Hingen nur noch wenige kahle Stängel über dem Herd, ihre Farbe ein undefinierbares, schmutziges Grau, auf dem sich ebenso graue Staubfäden sammelten, war das Frühjahr nicht mehr weit und er suchte unter den Birken hinter dem Haus nach ersten Schneeglöckchen.
Hier bin ich zu dir gekommen, sagte Nummer eins.
Thomas nickte. Er drückte die Aktentasche noch etwas fester an sich. Er war damals erst sechs und sein Großvater wenige Wochen tot und in der linken Hosentasche wartete Thomas’ erster heiliger Knopf auf Großmutters Tod. Großmutter brachte fast täglich ein neues Bündel Kräuter aus dem Garten und, es war September, heizte bereits am Morgen den Emailherd an. Bei schönem Wetter − an diesem Tag war schönes Wetter − dauerte es oft lange, bis der Rauch des knisternden Holzfeuers den Weg durch den Schornstein hinauf aufs Dach des Bauernhauses gefunden hatte. Dicke, weißblaue Wolken quollen anfangs aus jeder Ritze des Herdes. Auf der Kochfläche des Herdes waren run de gusseiserne Platten eingelassen, die Großmutter manchmal mit einem Feuerhaken herausnahm, um einen besonders großen Scheit Holz, der nicht durch die Ofentür passte, ins Feuer zu legen. Der Qualm, der aus den Plattenritzen hervorkam, bildete kreisrunde Rauch kringel, wie vom gespitzten Mund eines rauchenden Riesen geformt. So wie damals.
Kräuter, der Geruch nach beißendem Qualm und die Pfannkuchen, die seine Großmutter briet, verwoben sich zu einer olfaktorischen Meis terkomposition und waren die duftende Erinnerung, die immer zur Stelle war, wenn Nummer eins sich zu Wort meldete. Was auch erklärte, warum Thomas sich wohl und sicher, ja fast geborgen fühlte, wenn er die Stimme von Nummer eins in seinem Kopf hörte.
An jenem Septembertag, er saß mit einem Teller auf dem Schoß und einer Gabel in der Rechten auf seiner kleinen Kommode neben dem Herd, machte Großmutter Thomas’ Lieblingsessen: Pfannkuchen mit Sauerkirschmarmelade. Sie briet einen Teigfladen nach dem anderen in einer kleinen Pfanne und ließ sie auf seinen Teller rutschen, bestrich sie mit Marmelade und schnitt sie in kleine Stücke. Immer die laut brutzelnde Pfanne im Auge, beeilte sich Thomas, vor seiner Großmutter fertig zu sein. Beim ersten Pfannkuchen gelang ihm das locker, beim zweiten schmolz sein Vorsprung schon dahin und als der vierte fertig in Großmutters Pfanne lag, war sein Teller meist noch halb voll – Zeichen zum Aufhören.
Na, den einen wirst du doch wohl noch schaffen!
Das waren die ersten Worte, die Nummer eins zu ihm sagte. Thomas erschrak, sah sich überall im Raum um − aber außer ihm, seiner Großmutter und Goethe, Großmutters altem Kater, der in einer Holzkiste unter dem Herd schlief, war niemand in der Küche.
An mich wirst du dich gewöhnen müssen, ich gehöre jetzt zu dir, hatte Nummer eins gesagt.
»Und wer bist du?«, hatte Thomas laut gefragt.
»Wer ist wer?« Großmutter hatte ihn damals ziemlich verwirrt angesehen.
Seit diesem Tag verzichtete Thomas darauf, laut mit seinen Stimmen zu sprechen. Erst Jahre später, mit dem spektakulären ersten Auftritt von Nummer drei, sollte sich dies ändern.
Hier in der engen Kabine roch es muffig und nach kaltem Metall. Die Dunkelheit hätte ihm zwar gern dabei geholfen, sich an jeden beliebigen Ort der Welt zu träumen und ihn durch keine störende Realität von seinen Fantastereien abgehalten, doch waren die Gerüche im Aufzug wie ein Gewicht, das seinen Geist in die enge Kabine zwang.
Die schwarze Aktentasche unter den Arm geklemmt, ließ Thomas seine Finger über die kühlen Wände wandern. »Dinge, die du kennst, verlieren ihren Schrecken«, hatte Großmutter einmal zu ihm gesagt, als er sich wegen eines undefinierbaren Rumpelns nicht in die schumm rige Küche traute. Mit diesen Worten war sie vor ihm hergegangen und hatte, nach einem kurzen Blick durch den Raum, auf die Ursache des Geräusches gezeigt. Goethe hatte auf der Suche nach etwas Essbarem einen Tonkrug mit Gänseschmalz umgeworfen. »Siehst du. Die ganze Angst hat sich nicht gelohnt.«
Die Metallplatten der Fahrstuhlkabine, tastete er, stießen bündig aneinander. Sie waren mit eingelassenen Schrauben befestigt und uneben, wie gleichmäßig mit einem runden Hammer bearbeitet. Als er anschließend den glatten Linoleumboden untersuchte, fand er seinen Ball. Glücklich steckte ihn Thomas ein.
Nummer eins: Also wenn ich du wäre, würde ich jemanden anrufen! Thomas stutzte, dann richtete er sich auf. Nummer drei: Oder uns die Telefonschnur, hihi, um den Hals wickeln hihihi. Jaaaa! Und dann musst du auf das Geländer steigen und dich in die Tiiiefe stürzen, hihi.
Richtig! Neben den Knöpfen für die einzelnen Etagen war in fast jedem Aufzug ein Telefon. Für Notrufe. Oder diskrete Ferngespräche mit Menschen in einem Aufzug in Hamburg oder Moskau oder …
PARIS!, schrie Nummer zwei dazwischen.
Thomas suchte rechts und links der Tür nach dem Telefon. Auf der rechten Seite − Natürlich rechts. Wenn man sich recht erhängen will, dann muss das Telefon rechts sein. Hihi, und alles wird recht, wenn’s recht ist, solange es nur, hihi, rechts ist − fand er den Apparat. Als seine Fingerspitzen aber den rauen Kunststoff des Hörers und die in sich gewundene lange Schnur entdeckten, fuhr er zurück als habe er sich verbrannt. Wie viele Menschen mochten wohl schon damit telefoniert haben? Hunderte? Tausende?
Andererseits hatte Thomas noch nie jemanden in einem Aufzug telefonieren sehen.
Er war nervös und knabberte an seinem Daumen, wo die kleinen Wunden, die entstanden, wenn er in Gedanken verloren die Haut abnagte, nie verheilten.
Also ich würde das Dreckding da nie und nimmer anfassen! , Nummer drei war da! Stell dir vor, ein Tuberkulosekranker hat seinen feuchten Sabber da reingehustet. Oder Aidskranke! Wir sind hier in einem Krankenhaus, sicher gibt’s da auch Aidskranke, die, mit nässenden Eiterschwielen an den Händen, gern mal irgendwo ungestört mit ihrem Lover telefonieren. Nein, nein, nicht anfassen. Bloß nicht anfassen.
Und was dann?, dachte Thomas.
Auf mich hören und in Zukunft die Treppe nehmen!
Welche Zukunft hihi, wenn ich fragen darf?
In Zukunft auf mich hören! Und vielleicht doch um Hilfe rufen? In Filmen ist doch immer eine Klappe in der Decke. Klettern wir doch einfach alle raus.
Oh ja, Nummer drei schien begeistert, wir klettern auf die Kabine und wenn wir oben sitzen, peng, kommt, hihi, der Strom wieder und der Aufzug rast in den, in den, na, in welchen Stock denn gleich? Wo sitzt unser lieber Onkel Doktor?
»Im dritten.«
Richtig. Und das wäre dann ja wohl gaaaaaanz oben, wo wir schön gemütlich zerquetscht werden, hihihi. Also los, worauf wartest du. Komm, kleiner Tommy, komm, lockte die schrille Stimme.
09:18 Uhr, Krankenhaus Donaueschingen
Techniker der Klinik versuchten die Fahrstühle, die sich zum Zeitpunkt des Stromausfalls in Bewegung befanden und zwischen zwei Etagen stehen geblieben waren, gewaltsam zu öffnen. Im Normalfall (Aber was war heute noch normal?) waren die Aufzüge in das vom Notstrom versorgte System integriert. Sie durften zwar nicht mehr benutzt werden, setzten aber wenigstens ihre begonnene Fahrt fort. Aber nicht heute − und keiner wusste, warum. Von den acht Fahr stühlen der Klinik, von denen sich sechs parallel zum Treppenhaus befanden, waren drei betroffen, steckten also zwischen zwei Etagen fest.
Eine Köchin saß zusammen mit einer Palette tiefgefrorener Schweinekoteletts im Lastenaufzug zwischen Küche und Tiefkühllager. Wegen der Hitze, die sie den ganzen Tag in der Küche umgab, trug sie nur eine dünne Schürze über ihrer Unterwäsche. Die enge Kabine, in welche die Holzpalette gerade eben so hineinpasste, war nach einer Stunde völlig ausgekühlt. Die Köchin konnte ihren Atem sehen. Ihre nackten Füße schmerzten zuerst, als sie sich rot verfärbten. Später nahmen sie eine erschreckende Blässe an, die allerdings recht gut zum Dunkelblau ihrer Sandalen passte. Als die beiden Techniker zwanzig nach neun mit zwei Brechstangen die Tür aufhebelten, saß die Frau völlig unterkühlt in der engen Kabine. Sie wurde nach draußen gebracht und langsam wieder aufgewärmt. Wie weltweit jeder andere Teilnehmer blieb auch die Servicehotline der Aufzugsfirma unerreich bar und die beiden Techniker mussten sich nun, mit einem flauen Gefühl im Bauch, um den zweiten Fahrstuhl kümmern, aus dem ihnen jemand antwortete. Es handelte sich um einen der drei geräumigen Lastenaufzüge an der Rückseite des Treppenhauses. Eine Krankenschwester wartete darin, eingesperrt mit einem bettlägerigen Patienten. Beide waren gerade auf dem Weg zurück aus der Röntgenabteilung, als der Strom ausfiel. Der Patient, ein massiger Hypochonder, saß aufgrund seiner immensen Körperfülle Tag und Nacht aufrecht im Bett. Das Kopfteil war maximal aufgestellt, denn nur so − und mit einer gehörigen Portion Sauerstoff, den er stets in der Nähe hatte − glaubte er einigermaßen ausreichend atmen zu können.
Für den Transport in die Röntgenabteilung und zurück befand sich eine Fünfliter-Flasche mit Sauerstoff am Kopfende des Bettes. Nach einer Stunde in der Schwebe zwischen erster und zweiter Etage der Klinik war die Flasche leer.
Die unerfahrene und erst seit wenigen Wochen fertig ausgebildete Schwester beging den Fehler und nahm Herrn Banholzer, als die Flasche schon geraume Zeit leer war, die nun nutzlose Sauerstoffmaske ab. Bis zu diesem Moment hatte der Patient gleichmäßig und ruhig geatmet, war seine Haut rosig und die faden Witze, die er ununterbrochen riss, nicht besser oder schlechter als sonst. Im Schein einer kleinen Taschenlampe, die sich am Schlüsselbund der Krankenschwes ter befand, erzählte er Anekdoten aus seinem Leben, riss zweideutige Witze und freute sich, wenn die Schwester dabei rote Wangen bekam. Als ihm aber die Schwester die Sauerstoffmaske abnahm, verwandelte sich sein Zustand innerhalb von Sekunden. Keinen Sauerstoff zur Verfügung zu haben war für ihn gleichbedeutend mit Atemnot, was sein Unterbewusstsein auch innerhalb weniger Sekunden umsetzte. Banholzer hechelte unvermittelt wie ein abgehetzter Hund. Das führte dazu, dass sein Blut nun tatsächlich mit weniger Sauerstoff versorgt wurde als der Einhundertsechzig-Kilo-Mann benötigte. Seine Herzfrequenz schnellte in die Höhe und der Blutdruck stieg in gefährliche Regionen.
Die Schwester, selbst ängstlich und mit der Situation völlig überfordert, versuchte ihren Patienten durch ruhiges Zureden zu beruhigen: »Sie müssen tief durchatmen. Irgendwann wird jemand den Fahrstuhl öffnen und dann bekommen Sie auch wieder besser Luft.« Doch damit hatte sie nur noch mehr Nahrung in Banholzers lustig knattern des Panikfeuerwerk geworfen! Plötzlich wurden ihm die Enge der Kabine und die Dunkelheit bewusst. Seine weit aufgerissenen Augen suchten die Decke nach Lüftungsschlitzen ab. Wieder und wieder versuchte die Schwester, über den Notrufapparat Hilfe zu erreichen, aber das andere Ende der Leitung blieb stumm und Banholzers hochroter Kopf verfärbte sich zügig blau. Die Krankenschwester schrie und hämmerte gegen die Metalltür. Sie brach sich mehrere Fingernägel bei dem vergeblichen Versuch ab, die Tür mit den Händen zu öffnen.
Der nun tatsächlich eingetretene Sauerstoffmangel versetzte Banholzer in Todesangst. Er griff sich an den wulstigen Hals, als könne er so mehr Luft in seine Lungen hineinlassen, sein Japsen wurde schneller und flacher. Dann setzte er sich kerzengerade im Bett auf, ließ links und rechts seine Beine heraushängen und versuchte etwas zu sagen. Was er der Welt noch hatte mitteilen wollen, erfuhr niemand mehr. Um 8:53 Uhr verschied der Hypochonder Anton Banholzer aus Vöhrenbach an einem akuten Herzinfarkt in Aufzug fünf.
Die sofort und äußerst unprofessionell ausgeführten Wiederbelebungsversuche der ihn begleitenden Krankenschwester blieben vergebens. Als die Techniker auch diesen Aufzug gegen Viertel vor zehn endlich so weit geöffnet hatten, dass ein Mensch den schmalen Spalt passieren konnte, vermochte der Arzt, der bereits seit zehn Minuten wartete, nur noch den Tod des Patienten festzustellen. Der Arzt und die in Tränen aufgelöste Schwester verließen den Fahrstuhl, während für die Leiche Anton Banholzers aufgrund seines Gewichts und seiner Größe die halb offene Tür ein unpassierbares Hindernis darstellte und er bis auf Weiteres in seinem Bett sitzen bleiben musste.
Langsam entspannten sich die Gesichtszüge des Hypochonders.
Beim dritten der zum Zeitpunkt des Stromausfalls in Bewegung befindlichen Fahrstühle handelte es sich um einen der kleinen Personenaufzüge. Er hing offenbar zwischen Keller und Erdgeschoss fest. Aus dem Kabineninneren waren keine Lebenszeichen zu vernehmen, auch gab es auf die Rufe und das Klopfen der Techniker keine Reaktionen.
»Halleluja, wenigstens einer, den wir nicht ruinieren müssen!«, rief einer der Männer und schlug fast zärtlich mit der flachen Hand gegen die fest verschlossene Schiebetür. Und, im Weggehen: »Ich glaub’, irgendjemand würde uns die Köpfe abreißen, wenn wir den auch noch ruiniert hätten.«
»Möchte nicht wissen, was so ’ne Tür kostet.« Sein Kollege zuckte unwissend mit den Achseln und wuchtete die schwere Brechstange auf seine Schulter.
Thomas Bachmann kauerte in der hintersten Ecke seiner Kabine. Er presste noch immer beide Fäuste gegen seine Ohren, obwohl das hysterische Weinen der Frau und ihre Hilferufe längst verklungen waren. Ebenso dieses grauenvolle Röcheln und Keuchen. Nummer zwei hatte gewusst, woher diese Stimmen kamen! Es ist der Tod, Thomas! Er kriecht durch die Aufzugsschächte und verschlingt alle, die sich zu erkennen geben!
Ach, könnte er mich doch hören, der Toooood!, jammerte Nummer drei. Hihihi, du − lieber, kleiner Onkel Tod, / ich wünsche mir, ich wär’ dein Brot! / Und jetzt beende unsre Qual, / denn heute, da sind wir dein Mahl!, dichtete er mit mäßigem Talent.
Zuerst waren da die beiden Stimmen. Fremde Stimmen, die nicht aus seinem Kopf zu ihm sprachen, sondern sich aus einer undefinierbaren Ferne leise Gehör verschafften. Thomas wusste nicht, ob die Stimmen von Anfang an hier waren oder ob sie erst später einsetzten. Als er sie schließlich bewusst wahrnahm, versuchte er sie zu verstehen, legte das Ohr an verschiedene Stellen der Kabinenwände und lauschte, aber die Stimmen blieben fern und unverständlich und so verlegte er sich schließlich aufs Zuhören. Irgendwann aber verstumm te die eine, die männliche Stimme. Oder verwandelte sie sich? Aus Worten wurde Keuchen, aus Sätzen Röcheln!
Hörst du die Stimme des Todes?, flüsterte Nummer drei. Hörst du, wie er sich durch die Gedärme des sterbenden Krankenhauses quält? Er kicherte. Es ist der Toood! Er kommt, uns zu holen, hihi. Endlich hat er uns gefunden …
Sei still!, fuhr Nummer zwei dazwischen. Sie hatte Angst. Vielleicht, wenn wir uns ganz leise verhalten, übersieht er uns und geht zu den anderen. Hier ist genug Siechtum und Tod, genügend Fäulnis, die ihn an locken sollte. Sei still, und er wird uns nicht finden.
Thomas befolgte den Rat und verkroch sich in eine der hinteren Ecken der Kabine. Er verhielt sich still und versuchte sich klein und unsichtbar zu machen. Dann kamen ihre Schreie, ihre Rufe nach Hilfe! Und das Röcheln erstarb. Jetzt hat der Tod etwas gefunden, hihihi. Ein leckeres kleines Frühstück vielleicht. Klingen ihre Hilferufe nicht wundervoll? So viel Angst, so viel Verzweiflung. Aaah, welch’ Leckerbissen werden wir erst für ihn sein!
Thomas hörte fernes Klopfen und Hilferufe, aber sie wurden schwächer und zerflossen letztendlich in Resignation und Stille. Köstliche Stille.
Ohhh, jetzt ist er fort. Nummer drei klang ehrlich enttäuscht. Und er hat uns vergessen.
Vergessen! Was immer sich da in den Aufzugsschächten befand, es hatte ihn vergessen, hatte ihn übersehen und er war gerettet! Thomas klammerte sich an diese Hoffnung und er spürte, wie neuer Mut in ihm erwachte. Er lauschte, aber alles blieb still.
Stille kann etwas Wundervolles sein, wenn sie beruhigt und vom Ende einer Bedrohung erzählt, wenn sie tröstend Ängste erstickt und sich wie eine Arznei über die geschundene Seele legt. Dann ist Stille der Rettungsanker.
Aber gerade als Thomas sicher zu sein glaubte, die Gefahr überstanden zu haben, kreischte ein ohrenbetäubendes Quietschen und Ächzen durch den Schacht. Donnerschläge fuhren dazwischen und rollten zu ihm herab. Thomas sank sofort wieder in sich zusammen. Er zitterte in seiner Kabinenecke und weinte. Er hatte Todesangst, wein te lautlos und ohne Tränen. Wie Hammerschläge tönte es, dazwi schen glaubte er Stimmen zu hören, angestrengte Stimmen, die kämpften und sich mühten. Dann ein markerschütterndes Krächzen, wie von zerberstendem Metall, gefolgt vomn hemmungslosen Schluchzen einer Frau.
Das Schluchzen entfernte sich. Die anderen Stimmen gingen weg. Erneute Stille.
Trügerische Stille?
»Ist es endlich vorbei?«, hörte er sich fragen.
Nummer eins zögerte. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Wir wissen nicht, was kommt und was war. Thomas, er sah auf, als hätte er einen Gesprächspartner aus Fleisch und Blut vor sich, wir wissen nicht, was kommt. Aber du, nur du allein, kannst allem widerstehen, wenn du nur an dich glaubst! Kraft kann nur aus dir entstehen und nur du bist in der Lage, deine Kraft zu finden und zu nähren, Thomas! Rette uns, beschwor ihn die vertraute, tiefe Stimme, rette uns, indem du dich rettest!
Wie kann einer allein nur so viel melodramatischen Sülz erzählen? Die Stimme von Nummer drei war eine Mischung aus Abscheu und Langeweile.
Du verstehst nichts davon!, rügte Nummer zwei. Und, ehrlich hingerissen: Ich fand schön, was er gesagt hat. Ach, richtig schön. Donnerschläge krachten plötzlich aus unmittelbarer Nähe über Tho mas herein.
Eine Stimme rief: »Hallo? Ist jemand da drin?«
Dann erneutes Klopfen, laut, aufdringlich, gefährlich.