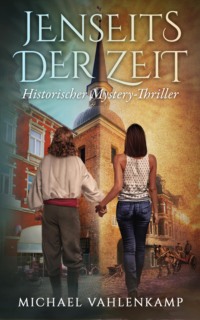Kitabı oku: «Jenseits der Zeit - Historischer Mystery-Thriller», sayfa 5
Heute
Der Zeitungsartikel für die Sonderausgabe war fast fertig, der Mietvertrag unterschrieben, die Handwerker bestellt. Timo war satt und machte seinen Mittagsschlaf. Sie hatte sich einen Tee bereitet und saß mal wieder am Schreibtisch.
In den letzten Tagen fiel ihr immer wieder ein, dass sie ihren Vater wegen des Buches noch nicht angerufen hatte. Sie hatte sogar schon überlegt, ob sie dieses Telefonat aus einem bestimmten Grund unbewusst ständig verschob, weil sie es vielleicht nicht führen wollte. Aber der einzige Grund, der ihr einfiel, war, dass sie womöglich ihre Mutter am Apparat haben könnte, mit der sie ganz und gar nicht sprechen wollte. Und das ließ sich leicht umgehen, indem sie ihren Vater auf seinem Handy anrief.
Also nahm sie das Telefon und wählte seine Mobil-Nummer. So wie sie ihn kannte, drückte er sich gerade vor der Gartenarbeit, indem er vorgab, noch etwas für das Büro tun zu müssen, und saß ebenfalls an seinem Schreibtisch.
»Hallo, meine Kleine«, vernahm sie nach zwei Klingeltönen seine warme Stimme. »Wir haben uns schon gefragt, wann du mal anrufst.«
Typisch: Ihre Eltern erwarteten immer, dass sie sich bei ihnen meldete. Umgekehrt kam es nicht in Frage.
»Hallo Papa. Ich hatte viel zu tun. Aber du hast ja auch meine Nummer für den Fall, das etwas anlag.«
»Okay, okay, ich habe schon verstanden. Erzähl schon, wie geht es euch alleine im großen Haus.«
Eine Weile brachten sie sich gegenseitig auf den neuesten Stand. Dann kam Editha zum eigentlichen Grund ihres Anrufs und sie berichtete dafür zunächst vom Fund des Buches. Sie beschrieb es ihm, so ausführlich wie möglich.
»Ich könnte dir auch ein Foto senden.« Sie hatte ihr Handy schon in der Hand und rückte das Buch auf dem Schreibtisch zurecht. Im nächsten Moment war das Foto unterwegs.
»Kannst du machen, aber ich glaube, dass ich dieses Buch noch nie gesehen habe,« meinte ihr Vater. »Ah, da ist das Bild ja. Nein, nie gesehen. Und auch die Initialen sagen mir nichts. Das ‚R‘ könnte natürlich für unseren Nachnamen stehen, aber ich kenne keinen aus unserer Familie, dessen Vorname mit ‚J‘ begann.«
Editha seufzte enttäuscht.
»So ein Mist. Ich hatte so gehofft, dass du darüber etwas weißt.«
»Na ja, ein wenig weiß ich schon. Die Truhe, die du gerade beschrieben hast, die kenne ich. Die hat dein Opa gehütet, wie seinen Augapfel, wir Kinder durften dort nie ran. Sie ist ein altes Familienerbstück und ich weiß, dass er darin andere Erbstücke aufbewahrte.«
»Das Buch ist also von einem unserer Vorfahren?«
»Darauf deutet alles hin.«
»Hm, hast du nicht irgendwelche Unterlagen? In Familienbüchern, oder so?«
»Nein, so weit reicht das nicht zurück. Ich kann dir Unterlagen über Oma und Opa schicken, aber von deinen Urgroßeltern habe ich schon nichts mehr. Die Namen weiß ich natürlich, die sende ich dir am besten mit. Die weitere Recherche müsste für dich als Journalistin ja ein Leichtes sein.«
Sie verabredeten, dass er die Unterlagen scannen und per Mail senden würde, und verabschiedeten sich.
Als ob er nichts anderes zu tun gehabt hätte, fand Editha eine halbe Stunde später seine Nachricht im Postfach ihres Mailprogrammes. Sie umfasste sämtliche Familienbucheinträge bis hin zu ihren Großeltern.
In der Zwischenzeit hatte sie mit einer Suchmaschine im Internet herausgefunden, wie sie ihre Urgroßeltern ermitteln konnte. Es gab einige Seiten über Ahnenforschung, die darüber umfassend informierten. Sie musste sich dazu an das Standesamt wenden, weil dort seit Ende des 19. Jahrhunderts alle Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle registriert wurden. Bevor Timo wieder aufwachte, schaffte sie es noch gerade, einen Brief an das Standesamt zu schreiben, in dem sie um die Daten ihrer Urgroßeltern bat. Dafür konnte sie sich von einer Internetseite ein Musterschreiben herunterladen. Zur Identifizierung gab sie die Namen an, die ihr Vater ihr gesendet hatte, und die Daten ihrer Großeltern aus dem Familienbuch. Zur Sicherheit sendete sie noch einige der gescannten Seiten mit.
Zwei Tage später erhielt sie eine Mail vom Standesamt, in der um die Überweisung der Gebühr gebeten wurde. Das erledigte sie umgehend. Ein paar weitere Tage danach kam dann die Post mit den gewünschten Auszügen aus den Akten. Sie enthielten die Daten ihrer Urgroßeltern und den Hinweis, dass die Aufzeichnungen nur bis in das Jahr 1876 zurückreichten und man ihr deshalb über frühere Vorfahren keine Auskunft geben könnte. Dafür riet man ihr, sich an die zuständige Kirchengemeinde zu wenden. Ihr fiel ein, dass sie auf den Internetseiten, die von der Ahnenforschung handelten, auch davon gelesen hatte, dass man sich in bestimmten Fällen an die Kirchengemeinde wenden solle.
Doch das musste warten, denn im nächsten Moment klingelte das Telefon.
»Gruning hier, vom Antiquariat Gruning«, meldete sich eine fremde Stimme. »Sie haben auf meinem AB um Rückruf gebeten?«
Editha hatte ebenfalls über das Internet und mit ein paar Telefonaten versucht herauszufinden, wer ihr bei der Übertragung der altdeutschen Schrift aus dem Buch in lateinische Buchstaben helfen könnte. Das Antiquariat Gruning fiel ihr dabei an mehreren Stellen auf. Leider war keiner da, als sie dort anrief, also hatte sie auf den Anrufbeantworter gesprochen.
»Ja, vielen Dank dafür. Mein Name ist Riekmüller. Ich habe hier ein altes Buch. Das ist in einer Schrift verfasst, die ich nicht lesen kann, vermutlich altdeutsch. Ich habe im Internet gelesen, dass Sie sich damit auskennen. Ist das richtig?«
»Das ist mein Spezialgebiet, ja.«
»Wäre es möglich, dass Sie sich das Buch mal ansehen?«
Sie vereinbarten für den Nachmittag einen Termin und verabschiedeten sich wieder.
Editha sah kurz nach Timo, der auf dem Wohnzimmerfußboden mit seinen Autos spielte, und ging dann ins obere Stockwerk, um sich über den Fortschritt der Renovierungsarbeiten zu informieren. Der Maler und sein Auszubildender waren dabei, die Unebenheiten in den Wänden mit Spachtelmasse auszugleichen. Irgendwie hatte sie den Eindruck, dass die Arbeiten noch ewig dauern würden. Hier konnte sie jedenfalls nichts ausrichten, also begab sie sich wieder in ihr Arbeitszimmer, um den Artikel zu Ende zu schreiben.
Das Antiquariat hatte eine Schaufensterscheibe, hinter der einige alte Bücher ausgestellt waren. Alles sah ein wenig altmodisch aus, als wäre die Zeit hier vor drei Jahrzehnten stehengeblieben. So auch die Eingangstür: Der Holzrahmen sah verblichen aus, die Scheibe war teilweise blind und dort, wo man hindurchsehen konnte, erblickte man dahinter einen Vorhang, der wohl früher einmal weiß gewesen war und jetzt schmuddelig grau aussah.
Als Editha die Tür öffnete, betätigte sie mit ihr eine kleine Ladenglocke, die ihre Ankunft ankündigte.
»Eine Glocke«, sagte Timo, der ihr an ihrer Hand folgte.
Sie traten ein und ihnen schlug ein muffiger Geruch entgegen, so wie sie es in einem Geschäft mit alten Büchern erwartet hatte. Ringsherum waren Regale, in denen von oben bis unten Buchrücken zu sehen waren. Dazwischen standen mehrere Ausstellungstische mit Stapeln von weiteren Exemplaren.
Editha schloss die Tür, wodurch sie die Glocke erneut zum Klingen brachte. Timo sah zu der Quelle des Geräuschs hoch und war sichtlich über den hellen Klang erfreut.
Von dem Läuten angelockt, betrat ein Mann den Verkaufsraum. Editha ging davon aus, dass das Herr Gruning war. Das erste, was ihr an ihm auffiel, war, dass er offenbar ziemlich alt war, bestimmt über siebzig, aber dafür einen sehr fitten Eindruck machte. Mit einem dynamischen Gang kam er auf sie zu und bewegte sich dabei, als wären ihm orthopädische Probleme fremd. Aus seinen kurzen Hemdsärmeln ragten muskulöse Unterarme, wie sie sie von ihren männlichen Karate-Kollegen kannte, und der Rest seines Oberkörpers sah ebenfalls breit und muskelbepackt aus. Sein akkurat gestutzter grauer Vollbart war etwa genauso lang wie die grauen Haare, die allerdings nicht mehr ganz so flächendeckend vorhanden waren. Er hatte eine Halbbrille auf der Nasenspitze sitzen und die Lachfalten seiner Augenpartie, die Editha darüber sehen konnte, machten ihn gleich sympathisch.
»Moin, wie kann ich helfen?«, fragte er.
»Wir hatten telefoniert. Sie wollen sich mein Buch ansehen.«
Sie holte den braunen Einband aus der Tasche und hielt ihn hoch.
»Ach, die altdeutsche Schrift.« Er nahm ihr das Buch aus der Hand und betrachtete die Buchstaben auf dem Deckel. »J. R.? Initialen? Wissen Sie, was die bedeuten?«
»Noch nicht, aber ich bin dabei, es herauszufinden.«
»Hm, und du weißt wohl auch nicht, was das heißen soll, oder?«
Er bückte sich zu Timo herunter, der sich schnell zur Hälfte hinter ihrem Rücken versteckte und nur ein scheues »Nein« hervorbrachte.
Gruning erhob sich schmunzelnd.
»Na, dann kommen Sie mal mit nach hinten durch, damit ich mir das Buch genauer ansehen kann.«
Er drehte ihr den Rücken zu, wieder ganz in der Betrachtung des Einbandes vertieft, und ging durch einen Vorhang voran ins Hinterzimmer. Editha folgte ihm mit Timo.
Als sie durch den Vorhang traten, saß der Mann bereits an einem Schreibtisch und zog ein Vergrößerungsglas heran, das mit einer verstellbaren Halterung, wie bei einer alten Schreibtischlampe, an den Tisch angebracht war. Damit betrachtete er eine ganze Weile das Äußere des Einbandes. Falls er etwas dabei feststellte, ließ er es sich nicht anmerken, und er äußerte sich auch nicht dazu.
Dann schlug er das Buch auf, blätterte auf die erste beschriebene Seite und betrachtete sie.
»Oh, nein«, sagte er und blätterte weiter, überblätterte ein paar verblasstere Seiten und sagte wieder »oh, nein«.
Editha verließ ihre ganze Hoffnung. Dann würde sie wohl nicht erfahren, was in dem Buch stand. Vielleicht war deshalb nur der eine Abschnitt übertragen worden, weil der Rest nicht leserlich war.
»Dann ist demnach also nichts zu machen? Sie können die Schrift nicht in lateinische Buchstaben übertragen?«
Gruning sah sie überrascht an.
»Wie bitte? Nein. Doch. Natürlich kann ich die Schrift übertragen. Ich kann nur gar nicht glauben, was Sie mir hier für ein Schmuckstück gebracht haben. Das ist ja eine ganz hervorragende, alte Schrift.«
Edithas Hoffnung kehrte zurück, ihr Herz machte einen Hüpfer.
»Dann können Sie sie lesen?«
»Aber ja doch. Das ist Kurrentschrift, eine Laufschrift, die bis Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland verwendet wurde. Der Verfasser dieser Zeilen hat zwar eine - sagen wir mal - etwas eigenwillige Schrift und manche Buchstaben werden auch noch unterschiedlich ausgeführt, aber sie ist absolut lesbar.«
»Und die verblichenen Seiten? Die kann man wohl vergessen, oder?«
»Nein, überhaupt nicht. Da gibt es Methoden, den Kontrast wieder zu vergrößern. Das kriege ich hin.« Er klappte das Buch zu und besah es sich von der Seite. »Allerdings dauert das eine Weile und dementsprechend wird das auch kein billiger Spaß. Dieser Schinken hat bestimmt 500 Seiten. Wenn ich die alle übertrage, wird der Preis so um die 1.000 Euro betragen, vielleicht etwas weniger.«
Die gerade aufgekeimte Freude verpuffte wieder.
»Oh, nein! Unmöglich, das kann ich mir nicht leisten.«
Sie dachte an die ganzen Rechnungen auf ihrem Schreibtisch. Auf keinen Fall konnte sie sich weitere Schulden aufladen. Dabei hätte sie so gerne gewusst, was in dem Buch stand. Was es mit diesen Visionen auf sich hatte.
Gruning musste ihr die Enttäuschung angesehen haben. Fast mitleidig schaute er zu ihr hoch.
»Pass auf, Mädchen, ich mach´ dir einen Vorschlag: Ich übertrage erst mal ein paar Seiten, sagen wir mal die ersten zehn. Danach kannst du es dir immer noch überlegen, ob ich weiter machen soll. Was hältst du davon?«
Dieser Vorschlag war vielleicht gar nicht so schlecht. Ein paar Seiten würde sie sich leisten können.
»In Ordnung. Wann haben Sie das fertig?«
»Hm, das muss ich nebenbei machen. Zwei, drei Tage werde ich wohl brauchen. Ich melde mich, wenn ich fertig bin.«
1788
Das Aufräumen der kaputten Mühle dauerte länger, als Jacob gedacht hatte. Er hatte das gesamte Ausmaß des Schadens nicht ansatzweise erkannt, als er ihn das erste Mal gesehen hatte. Im Nachhinein fanden sie noch unzählige Beschädigungen und herumliegende Bauteile. Und nicht alles ließ sich so einfach beseitigen, wie der Haufen Scheiße. Sie brachten einige Tage damit zu, verkeilte Holzstücke aus den Getrieben zu entfernen, immer vorsichtig, um die noch brauchbaren Bauteile dabei nicht zu beschädigen. Die kaputten Teile sammelten sie hinter der Mühle. Die wollten sie zunächst behalten, falls sie teilweise bei der Reparatur zum Ausbessern verwendbar waren.
Heute Morgen hatte ein Bote der Stadt ein Schreiben überbracht. Darin wurde ihnen noch einmal mitgeteilt, was der Ratsherr von Zölder im Rathaus bereits gesagt hatte: Sie sollten die Mühle wieder aufbauen, auf ihre eigenen Kosten und bei weiter laufendem Pachtzins. Es wurde erneut ausdrücklich betont, dass es für die Stadt Oldenburg unerheblich war, wie sie das anstellten. Der amtliche Stempel unter dem Schreiben grinste Jacob höhnisch an, nachdem er Herold vorgelesen hatte.
In einer Pause – sie hatten gerade die Aufräumarbeiten abgeschlossen und wollten mit dem Wiederaufbau anfangen – begann Herold wieder von dem Brief zu sprechen.
»Dieser verdammte Ratsherr«, sagte er, bestimmt bereits zum zehnten Mal. »Ich bin mir nicht sicher, ob der das überhaupt so einfach bestimmen darf.« Und nach einer kurzen Pause. »Aber was wollen wir dagegen tun?«
Jacob kaute weiter auf seinem Brot und antwortete nicht. Die Frage hatte Herold schon mehrfach gestellt. Sie war nicht an Jacob gerichtet.
»Wir werden uns nach Arbeit umsehen müssen.«
Jacob horchte auf. Das war seit der Zerstörung der Mühle das erste Zukunftsweisende, das Herold von sich gab. Aber Jacob erkannte sogleich einige Probleme, die dieses Vorhaben mit sich brachte.
»Nach was für Arbeit? Wir können doch nichts anderes außer der Arbeit des Müllers.«
»Oh, das glaube nicht. Ein Müller kann so manches. Ich habe erfahren, dass die Gerber noch Leute suchen. Notfalls müssen wir uns halt als Tagelöhner verdingen.«
Als Gerber! Jacob hatte schon viel von dieser Arbeit gehört. Schwere Tierhäute musste man dabei schleppen, ständig panschte man im Wasser herum und war ätzenden Dämpfen und Gasen ausgesetzt. Darauf konnte er gut verzichten.
»Aber als Tagelöhner wird man schlecht bezahlt. Wenn wir davon leben wollten, müssten wir viele Stunden dort arbeiten. Wer repariert dann die Mühle?«
Herold, dessen Gesichtsausdruck seit Tagen verdrießlich war, schaute tatsächlich noch verdrießlicher drein.
»Ich weiß, dass das ein Problem ist und dafür habe ich bisher keine Lösung. Doch fest steht, dass wir Geld brauchen. Wir haben zwar ein paar Reserven, doch die reichen nur, um uns ein paar Tage über Wasser zu halten. Wir müssen eine Arbeit annehmen. Vielleicht nimmst auch nur du eine an und wir leben dann beide davon, während ich mich mit Friedhelms Hilfe um die Mühle kümmere.«
»Das reicht doch niemals. Als Tagelöhner könnte ich doch nicht so viel verdienen, dass wir beide davon leben und auch noch Friedhelm bezahlen könnten.«
»Dann müssen wir uns eben einschränken.« Herold wurde lauter, bis er fast schrie. »Verdammt, ich weiß es doch auch nicht.«
Er sprang auf und schleuderte seinen Blechteller zu Boden. Die paar Krumen, die sich noch darauf befunden hatten, kullerten in alle Richtungen. Mit geballten Fäusten ging er ein Stück auf den See zu.
Jacob hatte vor Schreck aufgehört zu kauen. Wenn Herold, der sonst immer die Ruhe und Besonnenheit selbst war, so aus der Haut fuhr, musste es in seinem Inneren schlimm zugehen. Er stellte seinen Teller ebenfalls auf den Boden und ging Herold nach.
»Wir kriegen das schon irgendwie hin«, sagte er, obwohl er nicht daran glaubte. »Du wirst sehen, alles kommt wieder in Ordnung.«
Herolds Fäuste entspannten sich. Nach einer Weile drehte er sich langsam zu Jacob um. Sein Gesichtsausdruck war jetzt weder wütend noch verdrießlich. Er schaute Jacob prüfend an.
»Entschuldige«, sagte er. »Du musst auch einiges durchmachen und dann benehme ich mich derart.« Er fasste Jacob bei den Schultern. »Ich verspreche dir, dass das jetzt anders wird. Und noch eins: Mache dir keine Sorgen, ich gebe dir nicht die Schuld an dem, was passiert ist.«
Er sah zur Mühle, ließ Jacob los und schritt mit entschlossener Miene die Anhöhe hoch.
»Los, komm her«, rief er Jacob zu. »Wir wollen die Mühle wieder aufbauen.«
Jacob war verwirrt. Was sollte das heißen: Er gab ihm nicht die Schuld? Warum sollte er ihm auch die Schuld geben? Was konnte er dafür, dass diese Kerle, Rosas Bruder und ihr Verehrer, die Mühle kaputt gemacht hatten?
Jacob zog einen Stapel Papiere aus seiner Hasenfelltasche und eilte mit einem Stück Brot in der Hand aus der Mühle hinaus. Schon im Gehen biss er eine große Ecke ab. Auf der Rückseite des Gebäudes ließ er sich mit dem Rücken an die Wand gelehnt auf den Boden nieder und fummelte sein hölzernes Tintenfass und den Federkiel aus seiner Tasche hervor. Nebenbei verschlang er das Brot so hastig, als würde es ihm sonst jemand wegnehmen. Nachdem er den letzten Krümel auf diese Weise hinuntergeschluckt hatte, stürzte er sich auf den Text, der sich bereits auf einigen Seiten befand, indem er die Blätter auf seinen Oberschenkel legte und mit dem Kiel in der linken Hand Geschriebenes durchstrich oder Notizen an den Rand hinzufügte. Seine Haare, die ihm aufgrund seines vorgeneigten Kopfes ständig ins Gesicht fielen, strich er mit einer unbewussten Geste immer wieder hinter die Ohren. Als er die Überarbeitung des vorhandenen Textes beendet hatte, sah er eine Weile auf den See. Er spürte dabei einen absoluten inneren Frieden.
Und plötzlich wusste er, wie es weiterging in der Geschichte. Aufgeregt wendete er sich den leeren Blättern zu und schrieb eilig auf, was ihm eingefallen war.
Dieser Vorgang – auf den See blicken, anschließend schreiben – wiederholte sich einige Male, mindestens eine Viertelstunde lang. Dann zuckte er vor Schreck zusammen, als Herold, den er nicht hatte kommen hören, ihn unvermittelt ansprach.
»Tut mir leid, Jacob, aber du musst mir jetzt weiter helfen.«
Jacob sah zu seinem Bruder auf. Er stand keine zwei Meter von ihm entfernt und machte ein Gesicht, als wollte er sich für die Unterbrechung entschuldigen. Dann wandte er sich ab und verschwand hinter der Rundung der Mühlenwand.
Seit diesem Wutausbruch vor zwei Tagen war er wieder ganz der Alte. Er war voller Tatendrang, wobei sich alles nur um die Mühle drehte. Von der Tagelöhnerarbeit war keine Rede mehr gewesen, aber es war natürlich nur eine Frage der Zeit, bis das Thema erneut aufkam. Schließlich hatten sie bald kein Geld mehr. Jacob hatte jetzt kaum noch Gelegenheiten zu schreiben. Wenn er erst mal von morgens bis abends als Tagelöhner schuften würde, hätte er gar keine Zeit mehr dafür.
Mit zusammengepressten Lippen raffte er die Blätter zusammen und verstaute sie wieder in der Tasche. Wenn er am Abend nicht zu kaputt war, hatte er vielleicht noch einmal Gelegenheit zu schreiben. Er erhob sich und folgte Herold in die Mühle, im Gedanken weiterhin bei seiner Geschichte. Herold stand dort an einem großen, hölzernen Zahnrad. Doch das bemerkte Jacob nur nebenbei, während er über den Fortgang der Handlung nachdachte.
»Willst du mir jetzt vielleicht mal helfen?«, hörte er Herold schließlich sagen. Jacob sah ihn an. Sein Bruder lächelte und schüttelte leicht den Kopf. »Aha, bist du jetzt wieder in dieser Welt?« Er klopfte auf das Zahnrad. »Nun pack endlich mit an.«
Das Zahnrad sah aus, als wäre eine Herde Rinder darüber hinweg gelaufen.
»Na, das hat wohl auch schon bessere Tage erlebt«, sagte Jacob.
»Ja, das ist das alte Zahnrad, das zerstört war. Ich habe es einigermaßen repariert, um Geld zu sparen, weil wir noch genug andere Ersatzteile kaufen müssen. Hoffentlich hält es eine Weile durch.«
Jacob hatte sich dem Zahnrad genähert, begriff aber nicht, was er machen sollte. Herold lächelte weiterhin mild. Er wusste, wie unbeholfen Jacob sich anstellte, wenn es um technische Dinge ging.
»Du musst es dort anfassen und mit anheben«, erklärte er. »Wir stecken es dann auf diese Welle, die ich schon dafür vorbereitet habe.«
Er deutete auf ein zylindrisches Bauteil, das in Jacobs Brusthöhe aus dem Durcheinander der anderen Bauteile hervorstand. Oben auf diesem Bauteil saß etwas Rechteckiges drauf. Jacob fragte sich gerade, was es wohl damit auf sich hatte, da erläuterte es Herold schon für ihn.
»Diese Einkerbung in der Nabe«, er deutete auf eine eckige Aussparung, die oberhalb des runden Lochs in der Mitte des Zahnrads war, »müssen wir auf dieses rechteckige Teil schieben. Dann haben die beiden Bauteile eine Verbindung, mit der die Kraft des Windes übertragen werden kann.«
»Aha«, sagte Jacob. Da sein technisch begabter Bruder es sagte, musste es wohl stimmen, auch wenn ihm nicht klar war, wie das funktionieren sollte.
Zusammen wuchteten sie das Zahnrad hoch. Während Herold es scheinbar mühelos anheben konnte, musste Jacob sich enorm anstrengen. Sie schoben es, wie Herold vorher beschrieben hatte, auf diese sogenannte Welle. Für Jacob waren Wellen etwas ganz anderes. Er musste an den See denken und wie ihm beim Beobachten der Wellen immer gute Ideen für seine Geschichte kamen.
»So, jetzt musst du von außen gegendrücken. Dann kann ich es befestigen.«
Jacob tat, wie ihm geheißen und stemmte sich gegen das Zahnrad. Herold holte eine große Holzscheibe und schob sie ebenfalls über die Welle. Anschließend nahm er einen Bolzen und schlug ihn mit einem Hammer genau vor der Scheibe in ein Loch, das Jacob erst jetzt bemerkte, quer durch die Welle.
»Du kannst loslassen«, sagte Herold und grinste über das ganze Gesicht. »Gut gemacht. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Kraft doch in deinem kleinen Körper steckt.«
Jacob trat von dem Zahnrad zurück.
»Findest du?« Er war noch gedanklich bei seinem See. »Sag mal, warum heißt das Ding eigentlich Welle? Wir haben doch eine Windmühle und keine Wassermühle. Was haben wir also mit Wellen zu tun?«
Herold lachte auf.
»Das Bauteil wird nunmal so genannt, auch wenn wir mit Wasser nichts zu tun haben. Wenn gerade mal wieder Flaute ist, wünsche ich mir allerdings manchmal schon, wir hätten eine Wassermühle.«
»Ja, das ist schon zu dumm. Wir haben einen ganzen See voller Wasser mit richtigen Wellen vor der Haustür und können ihn nicht nutzen«, lachte Jacob, denn er konnte sich über solche Wortspielereien köstlich amüsieren. »Vielleicht sollten wir, statt zu hoffen, dass dem lieben Gott nicht die Puste ausgeht, lieber das Wasser mit Eimern auf die Flügel schütten.«
Mit einem Schlag wurde Herold ganz ernst.
»Was ist?«, gluckste Jacob weiter. »Kannst du solche Scherze über deine geliebte Mühle nicht ertragen?«
Herolds Augen verengten sich. Er sah aus, als hätte er gerade auf den See geschaut und einen Einfall gehabt.
»Mit Eimern sagst du? ... hmm.« Er sah zu Boden und machte einige Schritte durch die Mühle, als suchte er etwas, das ihm runtergefallen war. Dann wandte er sich wieder Jacob zu. »Wer sagt, dass wir das Wasser im See nicht nutzen können?«
Endlich saß Jacob mal wieder an dem kleinen Tisch in seiner Kammer und schrieb an seiner Geschichte. Seitdem Herold ihn am Vortag zum Helfen in die Mühle geholt hatte, war es das erste Mal, denn abends war er so müde, dass er es gerade noch so ins Bett geschafft hatte. Er hoffte, dass er heute ein wenig durchhalten würde, bevor die Konzentration nachließ. Eine Seite hatte er immerhin schon geschrieben und die Ideen sprudelten momentan nur so aus ihm heraus, auch ohne die Wellen des Sees.
Mit seiner Bemerkung über die Nutzung des Wassers hatte er sich schön was eingebrockt. Permanent redete Herold seitdem von seinem Einfall. Woraus der genau bestand, wusste Jacob immer noch nicht. Er wurde aus Herolds Geschwafel über künstliche Becken und Becherwerke einfach nicht schlau. Es war nur zu hoffen, dass dieses Hirngespinst bald wieder der Vergangenheit angehörte und Herold zur Normalität zurückkehrte. Dann würde das unverständliche Gerede endlich ein Ende haben.
Nur kurz ließ Jacob sich von diesen Gedanken unterbrechen. Die Ideen für den Handlungsfortgang flogen ihm nur so zu und die Formulierungen flossen wie von selbst aus der Feder. Als Jacob alles um ihn herum ausgeblendet hatte und mit Geist und Seele in seinem kreativen Schöpfungsprozess abgetaucht war, holte ihn plötzlich ein Klopfen an der Tür an die Oberfläche zurück. Schlagartig befand er sich wieder in der Realität. Er musste ein paar mal blinzeln, bevor er das bemerkte und sogleich die Augenbrauen zusammenzog.
»Ja, was ist denn?«, rief er dann ärgerlich.
Herold trat herein. Als Jacob sah, dass es ihm unangenehm war, ihn beim Schreiben zu stören, konnte er ihm nicht mehr so richtig böse sein.
Das erinnerte ihn an eine Situation vor einigen Jahren, als er noch nicht mit in der Mühle gearbeitet hatte, er hatte etwa ein Jahr davor die Schule beendet. Damals hatte Herold ihn auch unterbrochen und ihm danach mitgeteilt, dass er nicht mehr länger nur schreiben durfte und stattdessen in der Mühle mithelfen musste. Für Jacob war eine Welt zusammengebrochen. Zu der Zeit glaubte er noch, dass er nur als Schriftsteller arbeiten könnte, so wie Goethe, und damit sein Geld verdienen. Heute, nach mehreren Werken, die er trotz der Mühlenarbeit nebenbei fertigstellen konnte, wusste er, dass das nicht so einfach war.
Na, hoffentlich war der heutige Anlass für die Störung nicht ein solch aufrührender.
»Wir müssen etwas besprechen«, sagte Herold. »Es geht um die Mühle.«
Oh nein, nicht schon wieder die Mühle. Jacob seufzte. Dann und wann musste er doch mal Ruhe vor der verdammten Mühle haben können.
»Und bring bitte deine Feder, Tintenfass und ein paar Blatt Papier mit«, ergänzte Herold.
»Na gut.« Er stand auf, griff nach den genannten Utensilien und folgte Herold in den Raum, den sie Esszimmer nannten, der aber auch für alle sonstigen Zwecke herhalten musste. Er setzte sich an den alten Tisch aus Kiefernholz, an dem Herold bereits saß.
»Gut«, begann Herold. »Du weißt ja bereits, dass du mich gestern auf eine Idee gebracht hat.«
»Wieso sollte ich das wissen?«, lachte Jacob. »Vielleicht, weil du seitdem von nichts anderem mehr sprichst?«
»Ja, ja, schon gut. Aber du wirst gleich verstehen, warum ich so begeistert bin. Diese Idee könnte für uns ein Ausweg aus der Situation sein, in der wir uns gerade befinden.«
Jacob konnte sich nicht vorstellen, wie das Wasser im See ihre Situation verbessern sollte.
»Jetzt bin ich aber gespannt«, sagte er und lehnte sich zurück.
Herold ignorierte seine vorlaute Art und begann zu erklären.
»Als du gestern meintest, dass man das Wasser aus dem See nutzen müsste und es mit Eimern auf die Flügel der Mühle schütten sollte, hatte ich eine Idee.«
»Ja, ja, ich weiß. Nun erzähl schon, welcher Art deine Idee ist. Aber möglichst so, dass man es auch verstehen kann.«
»Also: Wir werden das Wasser aus dem See schöpfen. Dazu bauen wir ein Becherwerk. Das sind viele Becher hintereinander, die mit einem Band verbunden sind. An diesem Band laufen sie über Räder. Auf der Oberseite sind sie mit dem geschöpften Wasser aus dem See gefüllt und auf der Unterseite kehren sie leer zum See zurück.«
Herold zog ein Blatt Papier heran, tunkte die Feder in die Tinte und malte versetzt zueinander zwei Kreise.
»Das sind die Räder.«
Die Kreise verband er mit geraden Linien.
»Das ist das Band, das um die Räder läuft.«
Oben und unten auf den Linien malte er viele kleine Halbkreise, die mit der runden Seite dem »Band« zugewandt waren.
»Hier haben wir die Becher ... und das ist das Wasser darin.«
In die Becher oberhalb des »Bandes« malte er kleine Wellenlinien.
Selbst Jacob konnte erkennen, dass es eine Art Riementrieb von der Seite darstellen sollte, auf dem rundherum diese Becher befestigt waren. Er konnte sich vorstellen, dass oben das Wasser in den Bechern blieb, während es unten rausfallen musste.
»Hm, ... aber wie wird das Wasser geschöpft? Muss sich das Ganze nicht irgendwie bewegen, damit es funktioniert?«
»Genau«, fuhr Herold fort. Er malte eine weitere, größere Wellenlinie oberhalb des unteren Rades. »Die untere Seite des Becherwerks muss im Wasser vom See eingetaucht sein. Die beiden Räder drehen sich. Dadurch werden die Becher vorwärts bewegt, schöpfen unten das Wasser aus dem See und schütten es oben wieder aus.«
»Aber wodurch drehen sich die Räder? Müssen wir dort kurbeln?«
»Natürlich nicht. Wir lassen die Räder von der Mühle drehen.«
»Von der Mühle?«
»Ja. Wenn wir Wind haben, hat die Mühle doch genug Kraft. Da macht es ihr nichts aus, dieses Becherwerk noch mit anzutreiben.«
Jacob kratzte sich am Kopf.
»Das verstehe ich nicht. Wie soll die Mühle die Räder drehen?«
Herold nahm ein neues Blatt Papier und malte die Mühle von der Seite.
»Bisher endete die Hauptantriebswelle, die man Königswelle nennt, direkt beim Mahlstein.« Er malte die Königswelle mit zwei senkrechten Strichen in die Mitte der Mühle und darunter den Mahlstein als liegendes Rechteck. »Wir werden den Mahlstein versetzen«, er malte ein Rechteck neben dem vorherigen, »verlängern die Königswelle weiter nach unten durch, sodass wir über Zahnräder den Mahlstein und beliebige andere Dinge antreiben können. Also auch das Becherwerk.« Unten an die verlängerte Königswelle malte er ein flaches, waagerechtes Rechteck und daran ein flaches, senkrechtes Rechteck, die wohl die Zahnräder darstellen sollten. An das senkrechte Rechteck ergänzte er zwei parallele Linien, die nach außerhalb der Mühle führten.