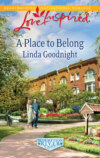Kitabı oku: «Arena Eins: Die Sklaventreiber », sayfa 7
VIER
Ich stehe da, im Wohnzimmer des Hauses meines Vaters, unter Schock. Einerseits habe ich immer Angst gehabt, dass dieser Tag kommen würde; andererseits kann ich jetzt kaum glauben. Ich fühle mich mit Schuld beladen. Hat das Feuer gestern Abend uns verraten? Haben sie den Rauch gesehen? Warum konnte ich nicht vorsichtiger sein?
Außerdem hasse ich mich dafür, dass Bree an diesem Morgen alleine gelassen habe – besonders, nachdem wir beide so schlechte Träume hatten. Ich sehe ihr Gesicht, wie sie weint, mich anbettelt, sie nicht zu verlassen. Warum habe ich nicht auf sie gehört? Meine eigenen Instinkten vertraut? Im Rückblick kann ich das Gefühl nicht unterdrücken, dass mein Vater mich wirklich gewarnt hat. Warum habe ich ihm keine Aufmerksamkeit geschenkt?
Das spielt jetzt alles keine Rolle, und halte nur einen Moment inne. Dann bin ich im Handlungsmodus, ich bin in keiner Weise bereit, aufzugeben und sie gehen zu lassen. Ich renne schon durch das Haus, um keine wertvolle Zeit zu verlieren, um die Sklaventreiber zu finden und Bree zu retten.
Ich laufe zur Leiche des Sklaventreibers herüber und examiniere ihn schnell: Er ist im typischen kompletten Schwarz gekleidet, in der Militäruniform, mit schwarzen Springerstiefeln, dem schwarzen Militäranzug und dem schwarzen Shirt mit langen Ärmeln, darüber mit einer eng anliegenden schwarzen Bomberjacke. Er trägt noch seine schwarze Gesichtsmaske mit den Insignien der Arena Eins – dem Kennzeichen der Sklaventreiber – und auch seinen kleinen schwarzen Helm. Der hat ihm wenig geholfen: Sasha hat es trotzdem geschafft, ihre Zähne in seinen Hals zu graben. Ich sehe zu Sasha hinüber und mir wird schlecht von dem Anblick. Ich bin ihr so dankbar, dass sie diesen Kampf ausgefochten hat. Ich fühle mich auch schuldig, weil ich sie alleingelassen habe. Ich sehe zu ihrer Leiche herüber und schwöre mir, dass ich, sobald ich Bree zurückhabe, zurückkehren werde und sie ordentlich beerdigen.
Schnell durchsuche ich die Leiche des Sklaventreibers nach Wertsachen. Ich beginne damit, seinen Waffengürtel zu nehmen und ihn um meine eigenen Hüften zu schnallen, ich schließe ihn fest. Er enthält ein Halfter und eine Pistole, die ich herausziehe und schnell prüfe: Sie ist mit Munition gefüllt und scheint in Ordnung zu sein. Das ist wie Gold – und jetzt ist es meins. Außerdem befinden sich mehrere Ersatzpackungen Munition am Gürtel.
Ich nehme seinen Helm ab und sehe mir sein Gesicht an: Ich bin überrascht zu sehen, dass er viel jünger ist, als ich gedacht hätte. Er kann nicht älter als achtzehn sein. Nicht alle Sklaventreiber sind gnadenlose Kopfgeldjäger. Manche werden zum Dienst gezwungen, sind der Gnade der Entscheidungsträger in der Arena ausgesetzt, der wirklichen Machthaber. Dennoch empfinde ich keinerlei Sympathie für ihn. Schließlich, unter Druck gesetzt oder nicht, er war hergekommen, um das Leben meiner Schwester zu rauben – und auch meines.
Ich will einfach nur da raus und sie jagen, aber ich diszipliniere mich selbst, erst einmal innezuhalten und zu überlegen, was ich mitnehmen kann. Ich weiß, dass ich da draußen alles brauchen kann, und dass ein oder zwei Minuten, die ich jetzt noch hier verbringe, den entscheiden Unterschied machen können. Also beuge ich mich herunter und probiere seinen Helm an. Erleichtert stelle ich fest, dass er passt. Das schwarze Visier wird praktisch sein, um mich gegen das blendende Licht des Schnees zu schützen. Als Nächstes sehe ich mir seine Kleidung an, die ich dringend benötigen werde. Ich ziehe seine Handschuhe ab, aus einem sehr leichten und gepolsterten Material hergestellt, und bin erleichtert, dass auch diese mir passen. Meine Freunde haben mich immer wegen meiner große Hände und Füße gehänselt, und mir waren sie immer peinlich – jetzt bin ich zum ersten Mal froh darüber. Dann ziehe ich seine Jacke ab, und auch die passt, sie ist nur ein kleines bisschen zu groß. Als ich noch einmal heruntersehe und merke, wie schmal er gebaut ist, wird mir klar, dass ich Glück habe. Wir haben einfach fast dieselbe Größe. Die Jacke ist dick und gepolstert, gefüttert mit ein Art Daunen. Ich habe in meinem Leben noch nie so etwas Warmes und Luxuriöses getragen, und ich bin so dankbar. Nun kann ich der Kälte endlich mutig gegenübertreten.
Ich sehe wieder herunter und weiß, dass ich auch sein Hemd ausziehen sollte – aber ich könnte mich einfach nicht überwinden, es zu tragen. Irgendwie ist das zu persönlich.
Ich halte meine Füße gegen seine und bin froh zu sehen, dass wir dieselbe Größe haben. Schnell ziehe ich meine alten, abgetragenen Stiefel aus, die ohnehin eine Größe zu klein sind, ziehe seine aus und mir an die Füße. Ich stehe wieder auf. Sie passen perfekt und fühlen sich hervorragend an. Schwarze Springerstiefel mit Zehenkappen aus Stahl, innen mit Fell gefüttert, sie gehen mein ganzes Schienbein hoch. Sie sind tausend Mal wärmer – und bequemer – als die, die ich bis eben anhatte.
Mit meinen neuen Stiefeln, dem Mantel, den Handschuhen und seinem Waffengürtel, mit der Pistole und der Munition, fühle ich mich wie ein neuer Mensch, bereit für den Kampf. Ich blicke auf Sashas Leiche hinunter und dann sehe in der Nähe Brees neuen Teddy, auf dem Boden und voller Blut. Ich muss die Tränen unterdrücken. Ein Teil von mir will in das Gesicht dieses Sklaventreibers spucken, bevor ich aus der Tür gehe, aber ich drehe mich einfach um und renne aus dem Haus.
Ich habe mich schnell bewegt, ich habe es geschafft, in weniger als einer Minute ihn aus- und mich anzuziehen, und jetzt renne ich in rasendem Tempo aus dem Haus, um die verlorene Zeit aufzuholen. Als ich aus der Vordertür herauskomme, kann ich das ferne Jaulen der Motoren noch hören. Sie können mir nicht mehr als eine Meile voraus sein, und ich bin entschlossen, das aufzuholen. Alles, was ich brauche, ist etwas Glück – dass sie vielleicht in einer Schneewehe steckenbleiben oder eine Kurve falsch nehmen, dann kann ich sie vielleicht, nur vielleicht, einholen. Und mit dieser Waffe und dieser Munition lasse ich mich nicht so leicht unterkriegen. Ich werde kämpfen. Auf keinen Fall werde ich ohne Bree an meiner Seite hierher zurückkehren.
Ich laufe den Hügel hinauf, in die Wälder, so schnell, wie ich kann, zu Papas Motorrad. Als ich einen Blick hinüberwerfe, sehe ich, dass die Garagentore weit offen stehen. Die Sklaventreiber müssen sie nach einem Fahrzeug durchsucht haben. Ich bin so froh, dass ich so vorausschauend war, dass ich das Motorrad schon vor langer Zeit versteckt habe.
Durch den schmelzenden Schnee klettere ich den Hügel hinauf und eile zu den Büschen, hinter denen ich das Motorrad versteckt habe. Die neuen, dick gepolsterten Handschuhe sind praktisch: Damit kann ich die dornigen Zweige greifen und aus dem Weg schieben. Nach wenigen Augenblicken ist der Weg zum Motorrad frei. Ich bin erleichtert, dass es noch immer dort ist, gut geschützt vor den Elementen. Ohne Zeit zu verlieren, schließe ich meinen neuen Helm, greife den Schlüssel aus dem Versteck in der Speiche und springe auf das Motorrad. Ich drehe den Schlüssel in die Zündungsposition und kickstarte.
Der Motor dreht sich, aber er springt nicht an. Mein Herz setzt einen Schlag aus. Ich habe das Motorrad jahrelang nicht gestartet. Sollte jetzt der Motor hin sein? Ich versuche wieder ihn zu starten, trete und drehe den Motor wieder und wieder hoch. Er macht Geräusche, lauter und lauter, aber immer noch nichts. Ich werde panisch. Wenn ich das Motorrad nicht starten kann, habe ich keine Chance, sie einzuholen. Bree wird für immer für mich verloren sein.
„Komm schon, KOMM SCHON!“, schreie ich, ich zittere am ganzen Körper.
Ich trete wieder und wieder. Jedes Mal wird das Geräusch lauter, und ich habe das Gefühl, ich komme der Sache immer näher.
Ich lege meinen Kopf zurück und schaue in den Himmel.
„PAPA!“, schreie ich. „BITTE!“
Wieder trete ich, und dieses Mal springt er an. Erleichterung durchflutet mich. Ich drehe den Motor mehrmals hoch, lauter und lauter, und kleine schwarze Wolken verlassen den Auspuff.
Nun, endlich, habe ich noch eine Chance.
*
Ich drehe den schweren Lenker und gehe mit dem Motorrad ein paar Meter zurück. Das Motorrad ist fast zu schwer für mich, um es zu bewegen. Wieder drehe ich den Lenker und gebe ein klein wenig Gas, nun beginnt das Motorrad, den steilen Berg hinunterzurollen, der noch immer von Schnee und Ästen bedeckt ist.
Die gepflasterte Straße ist etwa fünfzig Meter vor mir, und der Weg dahin, den Berg hinunter, durch diese Wälder, ist tückisch. Das Motorrad rutscht und schlittert, und sogar, wenn ich auf die Bremse trete, kann ich es nicht wirklich kontrollieren. Es ist eher eine Art kontrolliertes Rutschen. Ich schlittere an Bäumen vorbei, schaffe es gerade so an ihnen vorbei, und werde durchgerüttelt, wenn ich durch große Löcher im Schmutz oder über harte Steine brettere. Ich bete, dass mir kein Reifen platzt.
Nach etwa dreißig Sekunden der rauesten, holprigsten Fahrt, die ich mir vorstellen kann, sind das Motorrad und ich schließlich aus dem Schmutz heraus und landen mit einem Knall auf der asphaltierten Straße. Ich wende das Motorrad und gebe Gas, und das Motorrad reagiert: Es fliegt die steile, gepflasterte Bergstraße nur so herunter. Jetzt bin ich in Fahrt.
Ich mache jetzt echte Geschwindigkeit, der Motor brüllt, der Wind rast über meinen Helm. Es ist eiskalt, kälter als je zuvor, und ich bin dankbar dafür, dass ich die Handschuhe und den Mantel habe. Ich weiß nicht, was ich ohne sie tun würde.
Dennoch kann ich nicht zu schnell fahren. Diese Bergstraße hat scharfe Kurven und es gibt keinen Seitenstreifen; eine zu scharfe Kurve und ich werde abstürzen, hunderte von Metern direkt die Klippe hinunter. Ich fahre so schnell, wie ich kann, aber langsam vor jeder Kurve.
Es fühlt sich sehr angenehm an, wieder zu fahren. Ich hatte vergessen, wie sich echte Freiheit anfühlt. Mein neuer Mantel flattert wie verrückt im Wind. Ich senke das schwarze Visier, und das helle Weiß der verschneiten Landschaft wechselt in ein gedämpftes Grau.
Wenn ich den Sklaventreibern gegenüber einen Vorteil habe, dann den, diese Straßen besser als jeder andere zu kennen. Ich bin schon als Kind hierhergekommen und ich weiß, wo die Straße ihre Kurven hat und wie steil sie ist, und ich kenne Abkürzungen, die sie niemals kennen können. Jetzt sind sie in meinem Gebiet. Und auch, wenn ich vielleicht eineinhalb Kilometer hinter ihnen bin, bin ich optimistisch, dass ich einen Weg finden werde, sie einzuholen. Dieses Motorrad, alt, wie es ist, mindestens so schnell wie ihre Muskelautos sein.
Außerdem bin ich sicher, dass ich weiß, wo die Reise hingeht. Wenn man auf die Autobahn zurück will – und ich bin mir sicher, dass sie das wollen – dann gibt es nur einen Weg aus diesen Bergen heraus, und das ist die Route 23 Richtung Osten. Und wenn sie in die Stadt wollen, dann geht das nur über den Hudson über die Rip Van Winkle Bridge. Das ist der einzige Weg, den sie nehmen können. Und ich bin entschlossen, ihnen zuvorzukommen.
Ich gewöhne mich langsam wie an das Motorrad und habe eine gute Geschwindigkeit, gut genug, dass der Lärm ihrer Motoren immer lauter wird. Ermutigt fahre ich schneller, als ich sollte: Als ich herunterblicke, stelle ich fest, dass ich 100 fahre. Ich weiß, dass das waghalsig ist, weil diese Haarnadelkurven mich zwingen, auf unter 20 pro Stunde runterzugehen, wenn ich eine Chance haben will, nicht im Schnee auszurutschen. Als beschleunige ich und bremse dann wieder, Kurve für Kurve. Schließlich bin ich nah genug dran, dass ich eins ihrer Autos von hinten erkennen kann, wie es gerade hinter einer Kurve verschwindet. Ich fühle mich ermutigt. Ich werde diese Jungs kriegen – oder bei dem Versuch sterben.
Noch eine Kurve, ich bremse auf 20 ab und mache mich bereit, wieder an Fahrt zu gewinnen, als ich plötzlich fast in eine Person hereinfahre, die dort auf der Straße steht, direkt vor mir. Er scheint aus dem Nichts zu kommen, und es ist zu spät für mich, auch nur noch zu reagieren.
Ich bin dabei, ihn zu treffen, und ich habe keine andere Wahl, als in die Bremsen zu treten. Glücklicherweise bin ich nicht schnell, aber trotzdem rutscht mein Motorrad im Schnee, ich bekomme keine Bodenhaftung. Ich drehe mich um 360 Grad, zwei Mal, und komme schließlich zum Stehen, als mein Motorrad gegen eine Granitwand am Hang schlägt.
Ich habe Glück. Wenn ich mich in die andere Richtung gedreht hätte, wäre ich direkt an der Klippe abgestürzt.
Es ist alles so schnell passiert, ich bin unter Schock. Ich sitze dort auf dem Motorrad, halte den Lenker fest und drehe mich um, sehe die Straße hinauf. Mein erster Instinkt ist, dass der Mann ein Sklaventreiber ist, der dort auf der Straße platziert wurde, um mich aufzuhalten. In einer schnellen Bewegung schalte ich die Zündung ab und ziehe die Pistole, ziele direkt auf den Mann, der dort immer noch steht, etwa zwanzig Meter von mir entfernt. Ich entsichere und ziehe den Hebel zurück, wie mein Vater es mich im Schießstand so oft gelehrt hat. Ich ziele direkt auf sein Herz statt auf den Kopf, damit ich, wenn ich das Ziel verfehle, ihn dennoch irgendwo treffe.
Meine Hände zittern, sogar mit den Handschuhen, und ich bin mir dessen bewusst, wie nervös ich bin, wenn ich wirklich abdrücken muss. Ich habe noch nie niemanden getötet.
Der Mann hebt plötzlich seine Hände, hoch in die Luft, und macht einen Schritt auf mich zu.
„Nicht schießen!“, brüllt er.
„Bleib einfach, wo Du bist!“, brülle ich zurück. Noch immer bin ich nicht ganz bereit, ihn zu töten.
Er hält an, gehorsam.
„Ich bin keiner von ihnen!“, brüllt er. „Ich bin ein Überlebender. Wie Du. Sie haben meinen Bruder genommen!“
Ich frage mich, ob es eine Falle ist. Aber dann hebe ich mein Visier und sehe ihn mir von oben bis unten an, sehe seine verschlissene Jeans, voller Löcher, wie meine, sehe, dass er nur eine Socke trägt. Als ich noch genauer hinsehe, erkenne ich, dass er keine Handschuhe hat, und, dass seine Hände blaugefroren sind. Auch einen Mantel hat er nicht, nur ein abgenutztes, graues Thermoshirt, auch voller Löcher. Vor allen Dingen aber kann ich sehen, dass sein Gesicht abgemagert ist, noch schlimmer als meins, und ich bemerke die dunklen Ringe unter seinen Augen. Rasiert hat sich auch schon lange nicht. Trotzdem muss ich wider Willen feststellen, dass er trotz allem auffallend attraktiv ist. Er scheint ungefähr mein Alter zu sein, vielleicht siebzehn, mit seinem vollen hellbraunen Haar und großen, hellbraunen Augen.
Offensichtlich sagt er die Wahrheit. Er ist kein Sklaventreiber. Er ist ein Überlebender. Wie ich.
„Ich heiße Ben!“, ruft er aus.
Langsam senke ich die Pistole, entspanne nur ein wenig, aber fühle mich immer noch zwiespältig. Ich bin wütend, dass er mich gestoppt hat, ich will dringend weiter. Ben hat mich wertvolle Zeit gekostet, und seinetwegen wäre ich fast gestorben.
„Du hast mich fast umgebracht!“, schreie ich zurück. „Was sollte das, da mitten im Weg zu stehen?“
Ich schalte die Zündung wieder ein und kickstarte das Motorrad, will weiter.
Aber Ben macht einige Schritte auf mich zu, verzweifelt wedelt er mit den Händen.
„Warte!“, ruft er. „Fahr nicht! Bitte! Nimm mich mit! Sie haben meinen Bruder! Ich muss ihn zurückbekommen. Ich habe Deinen Motor gehört und ich dachte, Du wärst einer von ihnen, deshalb habe ich die Straße blockiert. Mir war nicht klar, dass Du auch ein Überlebender bist. Bitte! Lass mich mit Dir komme!“
Einen Moment lang empfinde ich Mitleid mit ihm, aber dann setzt mein Selbsterhaltungstrieb ein, und ich bin mir unsicher. Einerseits könnte er nützlich sein, wenn man vom Prinzip der zahlenmäßigen Überlegenheit ausgeht. Andererseits kenne ich diesen Menschen überhaupt nicht, ich kenne seine Persönlichkeit nicht. Wird er in einem Kampf bestehen? Kann er überhaupt kämpfen? Und wenn ich ihn im Beiwagen mitfahren lasse, brauche ich mehr Benzin, und ich werde langsamer. Ich mache eine Pause, überlege, entscheide mich schließlich dagegen.
„Tut mir leid“, sage ich, senke mein Visier und mache mich bereit, loszufahren. „Du würdest mich nur langsamer machen.“
Ich beginne, das Motorrad hochzudrehen, als er wieder schreit.
„Du bist es mir schuldig!“
Ich halte einen Augenblick inne, seine Worte bringen mich durcheinander. Ihm schuldig? Wofür?
„Für den Tag, an dem Du hier angekommen bist“, fährt er fort. „Mit Deiner kleinen Schwester. Ich habe Dir ein Reh hingelegt. Das war Essen für eine Woche. Ich habe es Dir gegeben. Und ich habe nie etwas dafür verlangt.“
Seine Worte treffen mich hart. Ich erinnere mich an diesen Tag, als wäre es gestern gewesen, und wie viel uns das bedeutete. Ich hatte mir nie vorstellen können, den Menschen zu treffen, der uns das geschenkt hatte. Er musste die ganze Zeit dort gewesen sein, so nah – sich in den Bergen versteckt haben, genau wie wir. Überlebt haben. Alleine geblieben sein. Mit seinem kleinen Bruder.
Ich fühle mich ihm zu großem Dank verpflichtet. Und ich überlege es mir noch einmal. Ich mag es nicht, Menschen etwas schuldig zu bleiben. Vielleicht ist die zahlenmäßige Überlegenheit doch besser. Und ich weiß, wie er sich fühlt: Sein Bruder wurde ihm genommen, genau wie meine Schwester mir. Vielleicht ist er motiviert. Vielleicht können wir gemeinsam mehr Schaden ausrichten.
„Bitte“, fleht er mich an. „Ich muss meinen Bruder retten.“
„Steig ein“, sage ich und zeige auf den Beiwagen.
Ohne zu zögern, springt er hinein.
„Da liegt ein zweiter Helm drinnen.“
Einen Augenblick später sitzt er schon und fummelt an meinem alten Helm herum. Ich warte keinen Moment länger. Schnell fahre ich los.
Das Motorrad fühlt sich schwerer an als zuvor, aber auch ausgeglichener. In wenigen Augenblicken bin ich wieder auf 100, direkt die steile Bergstraße hinunter. Dieses Mal werde ich wegen nichts mehr anhalten.
*
Ich rase die gewundenen Landstraßen hinter, drehe und wende mich, und als ich um eine weitere Kurve biege, wird eine herrliche Aussicht auf das Tal sichtbar. Von hier aus kann ich alle Straßen sehen, und ich sehe auch die beiden Autos der Sklaventreiber in der Ferne. Sie sind mindestens drei Kilometer vor uns. Um so schnell zu werden, müssen sie inzwischen auf die Route 23 gestoßen sein, was heißt, sie sind vom Berg runter und auf einer breiten, geraden Straße. Es macht mich krank, daran zu denken, dass Bree hinten in einem dieser Autos sitzt. Ich denke daran, was für eine Angst sie haben muss. Ich frage mich, ob sie sie gefesselt haben, ob sie Schmerzen hat. Das arme Mädchen muss hysterisch sein vor Angst. Ich bete, dass sie nicht gesehen hat, wie Sasha gestorben ist.
Mit neuer Energie drehe ich an den Lenkern, nehme die Kurven viel zu schnell, und als ich neben mich sehe, stelle ich fest, dass Ben entsetzt aussieht. Er fürchtet um sein Leben. Nach mehreren weiteren Haarnadelkurven sind wir von der Landstraße runter und auf der 23. Endlich sind wir auf einer normalen Autobahn, auf flachem Land. Jetzt kann ich alles aus dem Motorrad herausholen.
Und das mache ich. Ich wechsle den Gang und drehe am Lenker, gebe so viel Gas wie möglich. Ich bin dieses Motorrad – oder überhaupt irgendein Fahrzeug – noch nie so schnell gefahren. Ich sehe, wie es über 160 kommt, dann 170, dann 190 … Es liegt immer noch Schnee auf der Straße, und er fliegt mir ins Gesicht, prallt am Visier ab. Ich kann aber fühlen, wie die Flocken gegen die Haut an meinem Hals fliegen. Ich weiß, ich sollte langsamer fahren, aber ich tue es nicht. Ich muss diese Leute kriegen.
200 … 220 … Ich kann kaum atmen, weil wir so schnell fahren, und ich weiß, dass ich, wenn ich aus irgendeinem Grund bremsen müsste, es nicht möglich wäre. Wir würden uns so schnell drehen und stürzen, wir könnten es auf keinen Fall schaffen. Aber ich habe keine andere Wahl. 240… 260 …
„LANGSAMER!“, schreit Ben. „WIR WERDEN STERBEN!“
Genauso fühle ich mich auch: Wir werden sterben. Tatsächlich bin ich mir sicher. Aber es interessiert mich nicht mehr. Alle diese Jahre der Vorsicht, sich vor allen zu verstecken, haben Spuren hinterlassen. Das Verstecken ist nicht meine Natur. Ich bevorzuge die Konfrontation mit den Dingen. Ich denke, darin bin ich wie mein Vater: Lieber stehe ich auf und kämpfe. Nun, endlich, nach all den Jahren, habe ich eine Chance, zu kämpfen. Und ich weiß, dass Bree da vorne ist, direkt vor uns, so nah. Das hat etwas mit mir gemacht: Es hat mich wahnsinnig gemacht. Ich kann mich einfach nicht überwinden, langsamer zu fahren. Ich kann die Autos jetzt sehen, und ich bin ermutigt. Ich komme ihnen auf jeden Fall näher. Sie sind nur noch einen Kilometer entfernt und zum ersten Mal habe ich wirklich das Gefühl, dass ich sie einholen kann.
Die Autobahn macht eine Kurve, und ich verliere sie aus den Augen. Als ich auch um die Kurve fahre, sind sie nicht mehr auf der Autobahn; sie scheinen verschwunden zu sein. Ich bin verwirrt, bis ich geradeaus schaue und sehe, was passiert ist. Und das lässt mich auf die Bremse treten.
In der Ferne liegt ein riesiger Baum quer über auf der Autobahn, blockiert sie. Glücklicherweise habe ich noch Zeit, zu bremsen. Ich kann die Spuren der Sklaventreiber sehen, wie sie die Hauptstraße verlassen haben und um den Baum herumgefahren sind. Als wir vor dem Baum beinahe anhalten und ebenfalls die Autobahn verlassen, in den Spuren der Sklaventreiber, fällt mir auf, dass die Rinde frisch geschnitten ist. Und da wird mir klar, was passiert ist: Jemand muss ihn gerade erst gefällt haben. Ein Überlebender, nehme ich an, einer von uns. Er muss gesehen haben, was passiert ist, die Sklaventreiber gesehen haben, und dann hat er einen Baum gefällt, um sie aufzuhalten. Um uns zu helfen.
Die Geste überrascht mich, und mir wird warm ums Herz. Ich habe immer vermutet, dass es ein stilles Netzwerk von uns gibt, die sich dort in den Bergen verstecken, und die aufeinander aufpassen. Jetzt weiß ich es sicher. Niemand mag die Sklaventreiber. Und keiner will, dass ihm selbst das geschieht.
Die Spuren der Sklaventreiber sind deutlich, und ich folge ihnen, wie sie über den Seitenstreifen eine scharfe Kurve zurück auf die Autobahn fahren. Bald bin auch ich wieder auf der 23 und jetzt kann ich sie deutlich erkennen, etwa noch achthundert Meter vor uns. Ich bin ihnen wieder etwas näher gekommen. Ich rase wieder, so schnell, wie es das Motorrad hergibt, aber auch sie rasen jetzt. Sie müssen mich sehen. Ein altes, verrostetes Schild zeigt an: „Kairo: 3.“ Wir sind in der Nähe der Brücke. Nur noch wenige Kilometer.
Hier ist die Straße besser ausgebaut, und fliegen an verfallenen Häusern am Straßenrand entlang. Verlassene Fabriken. Lagerhallen. Einkaufszentren. Sogar Häuser. Alles ist gleich: ausgebrannt, ausgeplündert, zerstört. Sogar verlassene Fahrzeuge gibt es, aber sie sind nur noch Hüllen. Als wäre nicht auf der Welt übrig, das noch funktionierte.
Am Horizont sehe ich ihr Ziel: die Rip Van Winkle Bridge. Eine kleine Brücke, nur zwei Fahrspuren, eingefasst von Stahlträgern, erstreckt sie sich über den Hudson River. Sie verbindet die kleine Stadt Catskill im Westen mit der größeren Stadt Hudson im Osten. Eine wenig bekannte Brücke, die einst von den Einheimischen genutzt wurde, jetzt wird sie nur noch von den Sklaventreibern genutzt. Sie entspricht perfekt ihren Zwecken, weil sie sie direkt auf die Route 9 führt, die wiederum zum Taconic Parkway und anschließend, nach etwa 90 Meilen, direkt ins Herz der Stadt führt. Sie ist ihre Arterie.
Aber ich habe zu viel Zeit verloren, und egal, wie viel Gas ich gebe, ich kann einfach nicht mithalten. Ich werde nicht vor ihnen an der Brücke sein können. Dennoch hole ich auf, und wenn ich genug Geschwindigkeit bekomme, kann ich sie vielleicht überholen, bevor sie den Hudson überqueren.
Am Anfang der Brücke steht ein ehemaliges Zollhäuschen, so dass die Fahrzeuge sich in eine einzelne Fahrspur einordnen und an der Zollstation vorbeimüssen. Es gab einmal eine Schranke, die die Autos daran hinderte, einfach vorbeizufahren, aber die schon lange nicht mehr dort. Die Sklaventreiber rasen durch die enge Durchfahrt, über ihr hängt ein Schild, verrostet und wacklig, darauf steht „E-Z PASS“.
Ich folge ihnen hindurch und rase ebenfalls auf die Brücke, nun gesäumt von verrosteten Laternen, die seit Jahren nicht mehr funktionieren, ihr Metall verdreht und krumm. Als ich beschleunige, sehe ich, dass eines der Fahrzeuge in der Ferne mit quietschenden Reifen anhält. Das ist mir ein Rätsel – ich verstehe nicht, warum sie das tun. Plötzlich sehe ich, wie einer der Sklaventreiber aus seinem Auto springt, etwas auf die Straße legt und dann wieder ins Auto springt und weiterfährt. Dadurch gewinne ich wertvolle Zeit. Ich komme dem Auto näher, nur noch eine Viertelmeile, und ich habe das Gefühl, dass ich sie jetzt wirklich einhole. Dennoch verstehe ich nicht, warum sie angehalten haben – oder, was sie dort hingelegt haben.
Plötzlich wird es mir klar – und ich trete in die Bremsen.
„Was machst du?“, schreit Ben. „Warum hältst Du an?!“
Aber ich ignoriere ihn, trete nur noch härter in die Bremsen. Ich bremse zu stark, zu schnell. Unser Motorrad findet im Schnee keine Bodenhaftung, und wir fangen an, uns zu drehen und zu schleudern, in großen Kreisen. Glücklicherweise sind da Metallgeländer, und wir schlagen hart darauf auf, anstatt in den eisigen Fluss darunter zu stürzen.
Wir werden bis zur Mitte der Brücke geschleudert. Langsam bremsen wir, werden langsamer, und ich kann nur hoffen, dass wir rechtzeitig anhalten können. Denn jetzt wird mir klar – zu spät –, was dort auf der Straße liegt.
Es gibt eine riesige Explosion. Flammen schießen in den Himmel, als ihre Bombe detoniert.
Eine Hitzewelle schlägt uns entgegen, Granatsplittern fliegen herum. Die Explosion ist intensiv, Flammen schießen überall hoch, und ihre Kraft trifft uns wie ein Tornado, wirft uns zurück. Ich kann die Hitze spüren, wie sie auf meiner Haut brennt, sogar durch die Kleidung, wie sie uns umfängt. Hunderte von kleinen Granatsplittern prallen an meinem Helm ab, das laute Geräusch hallt in meinem Kopf wider.
Die Bombe hat ein so riesiges Loch in die Brücke geschlagen, dass sie in zwei Teile gerissen ist, eine zehn Meter lange Lücke klafft zwischen den Seiten. Jetzt kann man sie nicht mehr überqueren. Und was noch schlimmer ist, wir rutschen direkt auf das Loch zu, durch das wir hunderte Meter nach unten stürzen werden. Es war unser Glück, dass ich noch rechtzeitig in die Bremsen getreten bin, als die Explosion noch fünfzig Meter weit weg von uns vor uns lag. Aber unser Motorrad hört nicht auf zu rutschen, wir rutschen direkt darauf zu.
Schließlich sinkt unsere Geschwindigkeit auf dreißig und dann auf zwanzig, dann zehn … Aber das Motorrad kommt auf diesem Eis einfach nicht ganz zum Stehen, und ich kann das rutschen nicht aufhalten, direkt auf die Mitte der Brücke zu – die jetzt nur noch eine klaffende Schlucht ist.
Immer noch trete ich so hart, wie ich nur kann, in die Bremsen, ich gebe alles. Aber mir wird klar, dass nichts mehr hilft, als wir weiter, unkontrollierbar, unserem Tod entgegenrutschen.
Und das Letzte, woran ich denke, bevor wir stürzen, ist zu hoffen, dass Bree einen besseren Tod haben wird als ich.