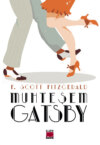Kitabı oku: «Arena Eins: Die Sklaventreiber », sayfa 8
TEIL II
FÜNF
Fünfzehn Fuß … Zehn … Fünf … Das Motorrad wir langsamer, aber nicht langsam genug, und wir sind nur ein paar Meter vom Rand entfernt. Ich mache mich auf den Sturz gefasst, realisiere, dass ich auf diese Art sterben werde.
Dann passiert das Verrückteste, was geschehen kann: Ich höre einen dumpfen Aufschlag und ich spüre einen Ruck nach vorn, als das Motorrad in etwas hineinfährt und komplett zum Stillstand kommt. Ein Stück Metall, herausgerissen durch die Explosion, ragt aus der Brücke heraus und hat sich in der Speiche unseres Vorderrads verhakt.
Ich bin in einem Zustand des Schocks, als ich dort sitze, auf dem Motorrad. Langsam sehe ich herunter und der Mut schwindet mir wieder, als mir klar wird, dass ich in der Luft hänge, über dem Rand der Schlucht. Unter mir ist nichts. Hunderte Meter unter mir sehe ich das weiße Eis des Hudson. Ich bin verwirrt, warum ich nicht stürze.
Ich drehe mich um und sehe, die andere Hälfte meines Motorrads – der Beiwagen – noch auf der Brücke ist. Ben, der noch betäubter wirkt als ich, sitzt noch darin. Seinen Helm hat er irgendwo auf der Strecke verloren, und seine Wangen sind mit Ruß bedeckt, verbrannt von der Explosion. Er sieht zu mir, dann nach unten in die Schlucht, dann wieder zurück zu mir, ungläubig, als wäre er verwundert, dass ich noch am Leben bin.
Mir wird klar, dass sein Gewicht, im Beiwagen, das Einzige ist, was das Gleichgewicht hält, mich davon abhält, zu fallen. Wenn ich ihn nicht mitgenommen hätte, wäre ich genau jetzt tot.
Ich muss etwas tun, bevor das gesamte Motorrad das Gleichgewicht verliert. Langsam und vorsichtig ziehe ich meinen schmerzenden Körper aus dem Sitz und klettere auf dem Beiwagen herüber, auf Ben herauf. Dann klettere ich über ihn, stelle meine Füße auf das Pflaster, und ziehe langsam am Motorrad.
Ben sieht, was ich tue, und steigt aus und hilft. Zusammen ziehen wir es vom Rand weg und bekommen das ganze Motorrad wieder auf sicheren Boden.
Ben schaut mich mit seinen großen blauen Augen an, als hätte er gerade einen Krieg erlebt.
„Woher wusstest Du, dass es eine Bombe war?“, fragt er.
Ich zucke mit den Achseln. Ich wusste es irgendwie einfach.
„Hättest Du nicht rechtzeitig gebremst, wären wir jetzt tot“, sagt er dankbar.
„Hättest Du nicht im Beiwagen gesessen, wäre ich jetzt tot“, antworte ich.
Touché. Jetzt sind wir uns gegenseitig etwas schuldig.
Wir sehen beide nach unten in die Schlucht. Als ich hochsehe, kann ich in der Ferne die Autos der Sklaventreiber sehen, wie sie auf der andere Seite des Flusses ankommen.
„Und jetzt?“, fragt er.
Ich sehe mich um, verzweifelt, wäre unsere Möglichkeiten ab. Wieder sehe ich zum Fluss hinunter. Er ist komplett weiß, mit Eis und Schnee gefroren. Ich sehe den ganzen breiten Fluss hoch und runter, suche nach anderen Brücken, irgendeinem anderen Übergang. Da ist nichts.
In diesem Moment erkenne ich, was ich tun muss. Es ist riskant. Wahrscheinlich werden wir dabei sterben. Aber ich muss es versuchen. Ich habe es mir geschworen. Ich werde nicht aufgeben. Egal, was passiert.
Ich springe wieder auf das Motorrad. Ben folgt mir, er springt in den Beiwagen. Ich setze meinen Helm wieder auf und gebe Gas, zurück in die Richtung, aus der wir gekommen sind.
„Wo willst Du hin?“, ruft er. „Das ist die falsche Richtung!“
Ich ignoriere ihn, rase über die Brücke, zurück auf unsere Seite des Hudson. Sobald ich die Brücke verlassen habe, biege ich links auf die Spring Street ab, in Richtung der Stadt Catskill.
Ich erinnere mich, dass ich als Kind mit meinem Vater hergekommen bin, und an eine Straße, die direkt ans Flussufer führt. Wir haben dort gerne geangelt, wir konnten direkt heranfahren und mussten nicht einmal unseren Truck verlassen. Ich erinnere mich, wie fasziniert ich war, dass wir direkt ans Wasser heranfahren konnten. Und jetzt formt sich in meinem Verstand ein Plan. Ein sehr, sehr gewagter Plan.
Wir fahren an einer kleinen, verlassenen Kirche und einem Friedhof auf unserer rechten Seite vorbei, die Grabsteine ragen aus dem Schnee, so typisch für eine Stadt in New England. Es verblüfft mich, dass die Friedhöfe, während die ganze Welt geplündert und zerstört aussieht, vollkommen unberührt scheinen. Es ist, als würden die Toten die Erde beherrschen.
Die Straße endet an einer T-Kreuzung. Ich biege rechts auf die Bridge Street ab und fahre einen steilen Hügel hinunter. Nach einigen Blocks komme ich zu den Ruinen eines riesigen Gebäudes aus Marmor. „Greene County Court House“ steht noch auf über dem Eingangstor. Dann biege ich links auf die Main Street ab und rase durch das, was einst der verschlafene Ort Catskill war. Auf beiden Seiten stehen Geschäfte, ausgebrannte Hüllen, verfallene Gebäude, zerbrochene Fenster und verlassene Fahrzeuge. Es ist keine Seele in Sicht. Ich rase mitten die Main Street herunter, es gibt keinen Strom, an Ampeln vorbei, die nicht mehr funktionieren. Nicht, dass ich anhalten würde, wenn sie es täten.
Ich fahre an den Ruinen eines Postamtes auf der linken Seite vorbei und weiche einem Müllhaufen auf der Straße aus, Überreste eines Stadthauses, das irgendwann eingestürzt sein muss. Die Straße führt weiter bergab, macht Kurven und wird schließlich schmaler. Ich fahre an verrosteten Bootskörpern vorbei, die jetzt im Sand liegen, zerstört. Hinter ihnen erheben sich die riesigen, verrosteten Gebäude, die einst Benzinlager waren, runde, hundert Fuß hohe Gebäude.
Ich biege links ab, in Richtung des Parks am Wasser, jetzt voller Unkraut. Auf den Resten eines Hinweisschilds steht „Dutchman's Landing“. Der Park dehnt sich bis zum Fluss hin aus, und das Einzige, was die Straße vom Fluss trennt, sind einige Felsbrocken mit Lücken dazwischen. Ich ziele auf eine dieser Lücken, senke mein Visier und richte das Motorrad aus. Jetzt oder nie. Ich kann mein Herz höher schlagen hören.
Ben muss erkennen, was ich mache. Er sitzt pfeilgerade, hält sich entsetzt an den Seiten des Motorrads fest.
„HALT AN!“, schreit er. „WAS MACHST DU?“
Aber ich kann jetzt nicht anhalten. Er wollte mitfahren, und es gibt kein Zurück mehr. Ich würde ihm anbieten, auszusteigen, aber ich habe keine Zeit mehr zu verlieren; außerdem, wenn ich jetzt anhalte, habe ich vielleicht nicht noch einmal die Nerven, das zu tun, was ich jetzt tun will.
Ich prüfe den Tacho. 60 … 70 … 80
„DU FÄHRST UNS DIREKT IN DEN FLUSS!“, schreit er.
„ER IST MIT EIS BEDECKT!“, schreie ich zurück.
„DAS EIS WIRD NICHT HALTEN“, schreit er wieder zurück.
90 … 100 … 110 …
„DAS WERDEN WIR HERAUSFINDEN!“, antworte ich.
Er hat Recht. Vielleicht hält das Eis nicht. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich muss diesen Fluss überqueren, und ich habe keine anderen Ideen.
120 … 130 … 140 …
Der Fluss kommt schnell auf uns zu.
„LASS MICH RAUS!“, schreit er verzweifelt.
Aber es ist keine Zeit. Er wusste, worauf er sich einlässt.
Ich richte das Motorrad ein letztes Mal aus.
Und dann wird unsere Welt weiß.
SECHS
Ich fahre das Motorrad in die schmale Lücke zwischen den Felsen, und das Nächste, was ich weiß, ist, dass wir fliegen. Eine Sekunde lang trägt uns die Luft, und ich frage mich, ob das Eis halten wird, wenn wir auftreffen – oder ob wir es direkt durchbrechen werden und in das eiskalte Wasser stürzen, in einen sicheren und brutalen Tod.
Eine Sekunde später durchfährt ein Ruck meinen gesamten Körper, als wir auf etwas Hartes aufprallen.
Eis.
Wir schlagen mit 140 auf, schnell, als ich es mir überhaupt vorstellen kann, und als wir landen, verliere ich die Kontrolle. Die Reifen bekommen keine Haftung, und mein Fahren wird eher ein kontrolliertes Rutschen. Ich tue mein Bestes, um wenigstens den Lenker zu steuern, der wild hin- und herschwenkt. Aber zu meiner Überraschung und Erleichterung hält wenigstens das Eis. Wir fliegen über das solide Eis, das der Hudson River jetzt ist, werden nach links und rechts geschleudert, aber zumindest in die richtige Richtung. Währenddessen bete ich zu Gott, dass das Eis hält.
Plötzlich höre ich hinter mir das schreckliche Geräusch von knackendem Eis, noch lauter als das Aufheulen des Motors. Ich sehe über meine Schulter und sehe einen enormen Riss, der sich bildet und der Spur unseres Motorrads folgt. Der Fluss öffnet sich direkt hinter uns. Unsere einzige Rettung ist, dass wir so schnell sind, dass der Riss uns nicht einholen kann, er bleibt immer einen Fuß hinter uns. Wenn unser Motor und unsere Reifen nur noch einige Sekunden durchhalten, dann können wir es vielleicht, vielleicht schaffen.
„SCHNELL!“, schreit Ben, die Augen vor Angst weit geöffnet, als er hinter sich sieht.
Ich gebe so viel Gas wie möglich, bin bei etwas über 150. Wir sind noch dreißig Meter vom gegenüberliegenden Ufer entfernt, und wir kommen näher.
Komm schon, komm schon!, denke ich. Nur noch ein paar Meter.
Das Nächste, was ich weiß, ist, dass es enormen Aufprall gibt, und mein ganzer Körper vor- und rückwärts geschleudert wird. Ben stöhnt vor Schmerz. Meine ganze Welt zittert und dreht sich, und in dem Moment wird mir klar, dass wir am gegenüberliegenden Ufer angekommen sind. Wir treffen mit 150 auf, schlagen hart auf das steile Ufer auf, unsere Köpfe werden ruckartig zurückgerissen. Aber nach ein paar weiteren üblen Erschütterungen sind wir auf dem Ufer.
Wir haben es geschafft. Wir sind wieder auf trockenem Land.
Hinter uns ist der Fluss nun vollständig aufgerissen, entzwei, Wasser strömt auf das Eis. Ich glaube nicht, dass wir es ein zweites Mal schaffen würden.
Aber jetzt ist keine Zeit zum Nachdenken. Ich versuche, wieder Kontrolle über das Motorrad zu bekommen, langsamer zu werden, weil wir schneller fahren, als mir lieb ist. Aber das Motorrad kämpft noch gegen mich an, die Reifen versuchen immer noch, Bodenhaftung zu gewinnen – und plötzlich fahren wir über etwas unglaublich Hartes und Unebenes, es fühlt sich an, als würden meine Zähne aus meinem Kiefer brechen.
Ich sehe herunter: Eisenbahnschienen. Die hatte ich vergessen. Es gibt hier immer noch alte Schienen, am Fluss entlang, wo früher Züge fuhren. Wir schlagen hart auf, springen darüber, das Motorrad schüttelt uns so heftig durch, dass ich den Lenker fast nicht mehr halten kann. Faszinierenderweise halten die Reifen immer noch und wir gelangen über die Schienen auf eine Landstraße, die parallel zum Fluss verläuft. Schließlich kann ich das Motorrad bremsen, bis auf 70 runter. Wir fahren an einem verrosteten, riesigen alten Waggon vorbei, der auf der Seite liegt, ausgebrannt, und ich biege scharf links ab, auf eine Landstraße mit einem alten Schild, auf dem steht „Greendale“. Es ist eine schmale Landstraße, die steil bergauf führt, weg vom Fluss.
Wir verlieren weiter an Geschwindigkeit, als wir fast geradeaus hochfahren. Ich bete, dass das Motorrad es im Schnee schaffen wird und nicht herunterrutschen wird, zurück nach unten. Ich gebe mehr Gas, als die Geschwindigkeit absinkt. Wir sind fast auf 20 Meilen pro Stunde runter, als wir endlich die Anhöhe erreichen. Wir sind wieder auf ebenem Land, und ich beschleunige wieder, als wir die enge Landstraße herunterfliegen, die uns abwechselnd durch Wälder und Acker führt, dann wieder durch die Wälder, schließlich an einem alten, verlassenen Feuerwehrhaus vorbei. Weiter geht es, hoch und runter, um Kurven, vorbei an verlassenen Landhäusern, vorbei an Herden von Rehen und Scharen von Gänsen, sogar über eine kleine Brücke über einen Bach.
Schließlich mündet die Straße in eine andere Straße, die Church Road, die ihren Namen passenderweise trägt, denn wir passieren die Überreste einer riesigen Methodistenkirche auf der linken Seite und ihren angrenzenden Friedhof – der natürlich noch intakt ist.
Das ist der einzige Weg, den die Sklaventreiber nehmen können. Wenn sie zum Taconic Parkway wollen, was sie müssen, dann können sie das nur, indem sie die Route 9 nehmen. Sie fahren von Norden nach Süden – und wir fahren von Westen nach Osten. Mein Plan ist es, ihnen den Weg abzuschneiden. Und jetzt, endlich, habe ich den Vorteil. Ich habe den Fluss etwa eine Meile südlicher gekreuzt als sie. Wenn ich nur schnell genug bin, kann ich ihnen zuvorkommen. Endlich fühle ich mich optimistisch. Ich kann ihnen den Weg abschneiden – und sie werden das niemals erwarten. Ich werde sie direkt treffen. Vielleicht kann ich sie töten.
Ich beschleunige das Motorrad wieder, über 140.
„WO WILLST DU HIN?“, ruft Ben aus.
Noch immer wirkt er tief erschüttert, aber ich habe keine Zeit, es ihm zu erklären: Plötzlich sehe ich in der Ferne ihre Autos. Sie sind genau dort, wo ich dachte, dass sie sein würden. Sie sehen mich nicht kommen. Sie sehen nicht, dass ich bereitstehe, um direkt in sie hineinzufahren.
Ihre Autos fahren hintereinander, mit einem Abstand von etwa zwanzig Metern, und mir wird klar, dass ich sie nicht beide erwischen kann. Ich werde mich für eins entscheiden müssen. Ich entscheide mich für das vordere: Wenn ich es von der Straße drängen kann, wird das hinter vielleicht bremsen oder ebenfalls von der Straße abkommen und verunglücken. Es ist ein gewagter Plan: Der Aufprall könnte uns sehr gut töten. Aber ich sehe keinen anderen Weg. Ich kann sie ja nicht gerade darum bitten, anzuhalten. Ich bete nur, dass Bree, wenn ich erfolgreich bin, überlebt.
Ich beschleunige weiter, nähere mich ihnen. Ich bin noch hundert Meter weit entfernt … Dann 50 … Dann 30 …
Schließlich wird Ben klar, was ich vorhaben.
„WAS HAST DU VOR?!“, schreit her und ich höre die Furcht in seiner Stimme. „DU WIRST IN SIE HEREINFAHREN!“
Endlich hat er es kapiert. Das ist genau, was ich hoffe, zu schaffen.
Ich drehe den Motor noch ein letztes Mal hoch, und kann kaum noch atmen, als wir über 150 kommen und mit Höchstgeschwindigkeit auf der Landstraße langen. Sekunden später fliegen wir auf der Route 9 – und prallen direkt in ihr erstes Fahrzeug. Es ist der perfekte Treffer.
Der Aufprall ist enorm. Ich fühle den Zusammenstoß von Metall auf Metall, fühle, wie mein Körper mit einem Ruck anhält, dann fühle ich mich selbst, wie ich vom Motorrad fliege und durch die Luft. Ich sehe eine Welt der Sterne, und während ich fliege, wird mir klar, dass es sich so anfühlen muss, zu sterben.
SIEBEN
Ich fliege durch die Luft, Hals über Kopf, und schließlich fühle ich, wie ich im Schnee lande. Es fühlt sich an, als würde er meine Rippen zerbrechen und alle Kraft aus mir herausschlagen. Ich erlebe den Sturz wieder und wieder. Ich werde hin- und hergerollt, kann nicht anhalten, werde in jede Richtung gestoßen und verletzt. Der Helm sitzt immer noch sicher auf meinem Kopf, und dafür bin ich dankbar, als ich fühle, wie mein Kopf auf Felsgestein in der Erde aufprallt. Hinter mir höre ich immer noch das laute Krachen von Metall.
Ich liege dort, gefroren, frage mich, was ich getan habe. Einen Moment lang bin ich unfähig, mich zu bewegen. Aber dann denke ich an Bree und zwinge mich. Allmählich bewege ich mein Bein, dann hebe ich einen Arm, versuche es. Dabei spüre ich in meiner rechten Seite, in den Rippen, einen entsetzlichen Schmerz, der reicht, um mir den Atem zu rauben. Ich habe mir eine gebrochen. Unter höchsten Anstrengungen schaffe ich es, mich auf die Seite zu drehen. Ich hebe mein Visier, sehe hinüber und mache mir ein Bild.
Ich habe das erste Auto mit solcher Kraft getroffen, dass ich es auf die Seite gestoßen habe. Dort liegt es, die Reifen drehen sich noch. Das andere Fahrzeug ist von der Straße abgekommen, aber es steht noch, in einem Graben auf der anderen Seite der Straße, etwa fünfzig Meter vor uns. Ben ist noch immer in den Beiwagen; ich kann nicht sagen, ob er tot oder lebendig ist. Ich scheine die Erste zu sein, die zu Bewusstsein gekommen ist. Niemand anderes zeigt ein Lebenszeichen.
Ich verschwende keine Zeit. Ich fühle mehr Schmerzen als je zuvor – als wäre ich gerade von einem Laster überrollt worden – aber wieder denke ich an Bree, und irgendwie bringe ich die Energie auf, mich zu bewegen. Jetzt bin ich im Vorteil, weil alle anderen sich erst wieder aufrappeln müssen.
Mit dem pochenden Schmerz in meinen Rippen humpele ich zu dem Auto herüber, das auf der Seite liegt. Ich bete, dass Bree da drin ist, dass sie unverletzt ist und dass ich sie aus dem Fenster ziehen kann. Ich greife nach unten, nach der Waffe, während ich mich annähere, vorsichtig halte ich sie vor mich.
Ich sehe hinein und sehe, dass beide Sklaventreiber leblos in ihren Sitzen liegen, voller Blut. Die Augen des einen geöffnet, er ist ganz offensichtlich tot. Auch der andere scheint tot zu sein. Schnell sehe ich auf den Rücksitzen nach, in der Hoffnung, Bree zu sehen.
Aber sie ist nicht dort. Stattdessen finde ich dort zwei andere Jugendliche – einen Jungen und ein Mädchen. Dort sitzen sie, starr vor Angst. Ich kann es nicht glauben. Ich habe das falsche Auto erwischt.
Sofort sehe ich zu dem anderen Auto am Horizont hinüber, dem im Graben, und während ich noch schaue, startet es plötzlich und seine Räder drehen sich. Das Auto versucht, aus dem Graben herauszukommen. Ich will hinrennen, um zu ihm zu gelangen, bevor es das schafft. Mein Herz klopft in meinem Hals, weil ich weiß, dass Bree dort ist, kaum noch fünfzig Meter entfernt.
Gerade, als ich losrennen will, höre ich aber plötzlich eine Stimme.
„HILF MIR!“
Ich schaue hinüber und sehe Ben, der im Beiwagen sitzt und versucht, herauszukommen. Flammen züngeln um das Motorrad, hinter dem Tank. Mein Motorrad brennt. Und Ben hängt fest. Ich stehe dort, hin- und hergerissen zwischen Ben und dem Auto, in meine Schwester ist. Ich muss gehen und sie retten. Aber zugleich kann ich ihn nicht sterben lassen. Nicht so.
Wütend renne ich zu ihm. Ich greife nach ihm, fühle die Hitze aus den Flammen hinter ihm, und ziehe an ihm, versuche, ihn herauszubekommen. Aber das Metall des Beiwagens hat sich so verbogen, dass seine Beine in der Falle sind. Er versucht auch, zu helfen, aber während ich ziehe, wieder und wieder, züngeln die Flammen immer höher. Ich schwitze und stöhne, aber ich ziehe mit all meiner Kraft. Schließlich ist er draußen.
Und genau in dem Moment explodiert das Motorrad.
ACHT
Die Explosion lässt und beide durch die Luft fliegen, und ich lande hart auf meinem Rücken im Schnee. Zum dritten Mal an diesem Morgen spüre ich, wie meine Lebensgeister mich verlassen.
Ich sehe in den Himmel hinauf, sehe Sterne und versuche, einen klaren Kopf zu bekommen. Ich spüre immer noch die Hitze der Flammen in meinem Gesicht, und meine Ohren klingeln von dem Lärm.
Als ich mich auf die Knie kämpfe, fühle ich einen stechenden Schmerz in meinem rechten Arm. Ich sehe hinüber und entdecke einen kleinen Granatsplitter, der am Rande meines Bizeps' eingedrungen ist, vielleicht zwei Zoll lang, ein Stück verdrehtes Metall. Es schmerzt wie verrückt.
Ich lehne mich hinüber und, ohne weiter darüber nachzudenken, greife ich das andere Ende des Metallstücks, beiße die Zähne zusammen und drücke mit einem Ruck zu. Einen Moment lang erlebe ich den schlimmsten Schmerz meines Lebens, als das Metall meinen Arm komplett durchdringt und auf der anderen Seite wieder herauskommt. Blut strömt meinen Arm hinunter und in den Schnee, befleckt meinen Mantel.
Schnell ziehe ich den einen Ärmel aus und sehe das Blut auf meinem Shirt. Mit meinen Zähnen reiße ich ein Stück vom Ärmel ab, nehme das Stoffstück und binde es eng um die Wunde, dann ziehe ich meinen Mantel wieder an. Ich hoffe, es wird den Blutstrom stoppen. Ich schaffe es, mich aufzusetzen, und als ich hinübersehe, sehe ich, was von Papas Motorrad übrig ist: Jetzt ist es nur noch ein Haufen nutzlosen, brennenden Metalls. Jetzt sitzen wir fest.
Ich schaue zu Ben hinüber. Er wirkt auch wie betäubt, auf seinen Händen und Knien, er atmet schwer, seine Wangen sind schwarz vor Ruß. Aber zumindest ist er am Leben.
Ich höre einen Motor aufheulen und sehe hinüber, in die Ferne: Das andere Auto ist aus dem Graben entkommen. Es schon wieder auf der Autobahn, beschleunigt, mit meiner Schwester darin. Ich bin wütend auf Ben, weil er schuld ist, dass ich sie verloren habe. Ich muss sie einholen.
Ich wende mich dem Auto der Sklaventreiber vor mir zu, das noch immer auf der Seite liegt, und frage mich, ob es noch läuft. Ich renne hinüber, entschlossen, es zu versuchen.
Ich drücke mich mit all meiner Kraft dagegen, versuche, es wieder auf seine vier Reifen zu stellen. Aber es ist zu schwer, ich kann es kaum bewegen.
„Hilf mir!“, brülle ich Ben zu.
Er steht auf und eilt an meine Seite, humpelnd. Er nimmt seine Position an meiner Seite ein und zusammen ziehen wir mit aller Kraft. Das Auto ist schwerer, als ich mir das vorgestellt hatte, wegen all der Eisengitter. Aber es bewegt sich mehr und mehr und schließlich, nach einer letzten großen Anstrengung, bekommen wir es wieder auf alle vier Reifen. Mit einem Knall landet es im Schnee.
Ich verschwende keine Zeit. Ich öffne die Fahrertür, lange hinein, greife den toten Fahrer mit beiden Händen am Hemd und ziehe ihn aus dem Sitz. Sein Rumpf ist voller Blut, und meine Hände werden rot, als ich ihn in den Schnee werfe.
Ich lehne mich in das Auto rein und untersuche den Sklaventreiber auf dem Beifahrersitz. Auch sein Gesicht ist voller Blut, aber ich bin mir nicht sicher, ob er tot ist. Tatsächlich entdecke ich, als ich ihn näher betrachte, einige Anzeichen für eine Bewegung. Dann bewegt er sich in seinem Sitz. Er ist am Leben.
Ich lehne mich noch weiter herüber und greife nach seinem Shirt, fest in einer Faust. Ich halte meine Pistole an seinen Kopf und schüttele ihn grob. Schließlich öffnet er seine Augen. Er blinzelt desorientiert.
Ich nehme an, dass die andere Sklaventreiber in die Arena Eins wollen. Aber sie sind uns jetzt so weit voraus, dass ich es ganz genau wissen muss. Ich komme ihm ganz nah.
Als er sich umdreht und mich ansieht, bin ich einen Moment lang fassungslos: Die Hälfte seines Gesichtes ist weggeschmolzen. Es ist eine alte Wunde, nicht von dem Unfall, das heißt, er muss ein Bioopfer sein. Ich habe Gerüchte über diese Menschen gehört, aber ich habe noch nie einen gesehen. Als die nuklearen Bomben über den Städten abgeworfen wurden, trugen die wenigen, die überlebten, diese Narben davon. Die Gerüchte erzählten, sie wären sadistischer und aggressiver als andere. Wir nennen sie die Psychos.
Mit diesem muss ich also besonders vorsichtig sein. Ich umfasse die Waffe enger.
„Wo bringen sie sie hin?“, frage ich durch meine zusammengebissenen Zähne hindurch.
Er sieht mich mit leerem Blick an, als würde er versuchen, zu begreifen. Ich bin mir jedoch sicher, dass er versteht.
Ich drücke den Lauf in seine Wange, um ihm klarzumachen, dass ich ernst meine. Und ich meine es ernst. Jeder einzelne Augenblick ist kostbar, und ich kann fühlen, dass Bree immer weiter von mir weg ist.
„Ich sagte, wo bringen sie sie hin?“
Schließlich öffnet er seine Augen in etwas, das Angst zu sein scheint. Ich glaube, die Botschaft ist angekommen.
„Die Arena“, sagt er schließlich mit heiserer Stimme.
Mein Herz flattert, meine schlimmsten Befürchtungen sind bestätigt.
„Welche?“, schnappe ich.
Ich bete, dass er nicht sagt Arena Eins.
Er macht eine Pause, und ich kann sehen, wie er darüber nachdenkt, ob er es mir sagen soll oder nicht. Ich drücke die Pistole noch fester gegen seinen Wangenknochen.
„Sag es mir jetzt oder es ist vorbei!“, brülle ich, der Zorn in meiner Stimme erstaunt mich selbst.
Schließlich, nach einer langen Pause, antwortet er: „Arena Eins.“
Mein Herz pocht, meine schlimmsten Befürchtungen sind bestätigt. Arena Eins. Manhattan. Man sagt, das ist die schlimmste von allen. Das kann nur eins bedeuten: den sicheren Tod für Bree.
Ich fühle eine neue Welle der Wut auf diesen Mann, diesen Zulieferer, diesen Sklaventreiber, vom niedersten Rang der Gesellschaft, der hierhergekommen ist, um meine Schwester zu entführen, um die Maschine zu füttern, einfach nur, damit andere zusehen können, wie hilflose Menschen sich gegenseitig töten. All diese sinnlosen Tode, nur für ihre eigene Unterhaltung. Das ist genug, dass ich ihn auf der Stelle umbringen will.
Aber ich nehme die Pistole aus seiner Wange und lockere meinen Griff. Ich weiß, dass ich ihn töten sollte, aber ich kann mich nicht überwinden. Er hat meine Fragen beantwortet, und irgendwie wäre es nicht fair, ihn jetzt zu töten. Stattdessen werde ich ihn zurücklassen. Ich werde ihn aus dem Auto werfen und hier lassen, was bedeuten wird, dass er langsam verhungert. Ein Sklaventreiber allein in der Natur hat keine Möglichkeit, zu überleben. Das sind Stadtmenschen – keine Überlebenden wie wir.
Ich lehne mich zurück, um Ben zu sagen, dass er diesen Sklaventreiber aus dem Auto ziehen soll, als ich plötzlich in einem Winkel meines Auges eine Bewegung erkenne. Der Sklaventreiber fasst nach seinem Gürtel, mit einer schnelleren Bewegung, als ich es für möglich gehalten hätte. Er hat mich ausgetrickst: Er ist tatsächlich in relativ gutem Zustand.
Schneller, als ich es je für möglich gehalten hätte, zieht er eine Pistole. Bevor ich auch nur registrieren kann, was passiert, zielt er schon in meine Richtung. Ich war dumm, ich habe ihn unterschätzt.
Aber ein Instinkt in mir übernimmt die Kontrolle, vielleicht ein Instinkt, den ich von Papa geerbt habe, und ich ziehe, ohne zu denken, und schieße unmittelbar, bevor er schießen kann.