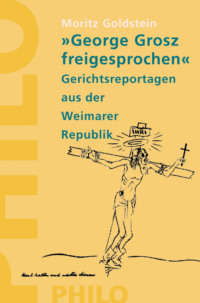Kitabı oku: «"George Grosz freigesprochen"», sayfa 3
Der Apparat
Wären die Richter mit Allwissenheit ausgestattet, läge ihrem Blicke offen, was in der Seele des Angeklagten vorgeht jetzt, da er seinen Spruch erwartet, und damals als er sein Verbrechen beging, kennten sie ferner seine ererbten Anlagen, seine sozialen Abhängigkeiten, seine menschlichen Begegnungen, kurzum, überblickten sie das vielfältige Gewebe von Ursachen und Wirkungen, in dem die einzelne Tat des einzelnen Menschen nur ein Knoten ist – so vermöchten sie kein Schuldig zu sprechen und keine Strafe zu verhängen. Sie würden sich schämen, das unzerreißbare Netz der Notwendigkeit durch die Begriffe Schuld und Sühne zu verwirren.
Allein Richter sind Menschen, allen menschlichen Schwächen unterworfen, keiner Unvollkommenheit so sehr und so verhängnisvoll wie dem Irrtum. Was verbrochen worden ist, wer verbrochen hat, warum er verbrochen hat – sie wissen es oft nicht, sind vielfach darauf angewiesen, es zu erschließen, aus – manchmal sehr lückenhaften – „Tatbeständen“ einer Tat, die sie nicht gesehen haben, und aus Bekundungen von Zeugen, die wiederum Menschen sind, mit den gleichen Unvollkommenheiten und Schwächen, aber dazu vielleicht noch mit bösem Willen, Furcht für sich oder den Angeklagten und Kunst der Verstellung. Zu urteilen, zu schlichten, zu entscheiden hat ja jeder von uns wieder und wieder im täglichen Leben: zwischen Kindern, zwischen Untergebenen, zwischen Verwandten und Freunden. Dann stehen wir hilflos unter den streitenden Parteien, tappen zu und vergreifen uns zu unserer Beschämung, werden selbst Partei, oder wir entscheiden kraft unserer überlegenen Macht an Jahren oder an Gehalt, und die anderen fügen sich, weil sie gegen diese Macht nicht ankönnen. Damit ist dem Staate nicht geholfen, der zu seiner eigenen Rechtfertigung der Fiktion bedarf, daß Recht geschehe. Justiz also besteht darin, daß Urteil und Strafe der Willkür entzogen werden, der Willkür aus Machtmißbrauch und der aus Unvollkommenheit, und daß statt ihrer die Norm walte.
Durch vollkommenen Gebrauch dieser Norm – wenn schon nicht durch Allwissenheit – könnte es noch immer ein ideales Gericht geben. Dann müßten die Spieler des Gerichtsverfahrens gegeneinander manövrieren, wie Schachmeister mit den Figuren auf den 64 Feldern. Dergleichen kommt natürlich vor. Als der Advokat Labori für Zola und Dreyfuß vor den französischen Geschworenen focht, da war es zugleich ein Schaukampf juristischer Meisterschaft vor den Augen der Welt. Dem Alltagsbetrieb fehlt es hierzu an Raum, an Zeit und an Menschen. Im Gericht funktionieren Beamte, zugegeben, daß es unterrichtete, gewissenhafte, selbst menschenfreundliche Beamte sind; die Anwälte üben einen Beruf aus, zugegeben selbst, daß sie es voller Kenntnis, mit Eifer und Gewandtheit tun. Prozeßparteien, Angeklagte und Zeugen vollends sind allzu häufig weniger als Durchschnitt, kümmerliche Gewächse, gewiß nicht als Menschen, in ihrer Sphäre betrachtet, aber an diesem Ort, vor den Schranken, zwischen Zuhörern und Zuschauern, auf Rede und Antwort gestellt. Da gibt es keine imposanten Hiebe und eleganten Paraden, keine überraschenden Angriffe und siegreichen Verteidigungen. Und tritt doch einmal ein Fechter von Rang auf, so fehlt ihm gewiß der ebenbürtige Gegner. Der Werkeltag der Justiz ist der nüchterne Betrieb einer Maschine, die Urteile fabriziert.
Bekanntlich vollzieht sich das Gerichtsverfahren in der Form eines Kampfes, zwischen Anklage und Verteidigung im Strafprozeß, zwischen Behauptung und Widerlegung im Zivilstreit. Hört man den Anwälten als Unbeteiligter zu, so erfährt man wenig von der Sache, um so mehr von juristischen Formalien. „Ich rüge die Klageänderung,“ sagt einer, „Ich stütze mich auf einen neuen Ehebruch,“ ein anderer. Der eine trägt Behauptungen vor; der andere verrät sich mit der Wendung: „Wird natürlich bestritten.“ Natürlich! Denn wo bliebe er, wenn er etwa überzeugt worden wäre und nicht bestritte? Der Staatsanwalt zieht hervor, was die Schuld bestätigt, er betrachtet die Belastungszeugen mit Wohlwollen, die Entlastungszeugen mit Mißtrauen und Mißgunst. Der Verteidiger macht es genau umgekehrt; wo ein Widerspruch sich aufdecken läßt, springt er dazwischen, oft sich das Wort gegen die Ungeduld des Vorsitzenden erst erkämpfend. Keinem von beiden darf es passieren, daß er mit dem Auge des anderen sieht; jeder von ihnen ist hier vor allem Funktionär und dann erst Mensch.
Im Strafverfahren wird zuerst der Angeklagte vernommen. Er leugnet; oder er gibt freimütig zu, wessen er überführt ist, um desto mehr Glauben zu finden, wenn er leugnet, wessen er nur verdächtigt wird. Das Gericht schreitet also zur Beweisaufnahme durch Zeugenvernehmung. Wie kann man in so wichtiger Sache irgend jemandem glauben, von dem man nichts weiß als Namen und Geburtstag und daß er mit dem Angeklagten weder verwandt noch verschwägert ist? Im allgemeinen sagen doch Leute nicht die Wahrheit, sondern schwindeln raffiniert und mit vollendeter Verstellungskunst. Zeugen sind nun immer entweder von der Anklage oder von der Verteidigung geladen und irgendwie interessiert. Selbst aber vorausgesetzt, daß sie die Wahrheit sagen wollen, so ist ja über die Psychologie der Aussage genug experimentiert worden, jeder kann in seiner Umgebung die Beobachtungen wiederholen, ja an sich selber erfahren: daß es schwer und manchmal unmöglich ist, zu unterscheiden, was war und wovon man im Augenblick der Aussage nur wünscht, daß es gewesen wäre. (Nietzsche: „Das habe ich getan, sagt mein Gedächtnis. Das kann ich nicht getan haben, sagt mein Stolz. Endlich – gibt das Gedächtnis nach.“)
Das Gericht hat ein sehr einfaches Mittel, die zweifelhafte Aussage in eine glaubwürdige zu verwandeln: den Eid. Was beschworen worden ist, gilt als wahr, solange nicht das Gegenteil bewiesen wird. Vielleicht gibt es im ganzen Gerichtsbetrieb nichts so Maschinenhaftes wie die Handhabung des Eides. Scheinbar vollzieht sich die Zeremonie unter feierlichen Formen. Der Gerichtshof erhebt sich, mit ihm alle Anwesenden bis auf Justizwachtmeister und Publikum, der Vorsitzende setzt sein Barett auf, der Schwörende erhebt die rechte Hand. Aber das ist nur ein dürftiges Mäntelchen. Schon der vorgeschriebene Hinweis auf die Bedeutung des Eides wird meist geschäftsmäßig erledigt, und dem hastigen und nüchternen Vorsprechen der Formel vermag der Zeuge oft kaum zu folgen. Niemand außer diesem selbst nimmt sich die Mühe, irgendwelche Teilnahme zu bekunden. Und wenn man als unbeteiligter Zuhörer den Akt oft miterlebt hat, vielleicht viele Male in derselben Verhandlung, so ist einem schon das Gefühl für seine Wichtigkeit abhanden gekommen. Man mag immerhin den Mitmenschen zutrauen, daß sie sich im allgemeinen ein Gewissen daraus machen, falsch zu schwören. Trotzdem leistet der Eid nicht mehr, als daß er dem Staat die formelle Handhabe bietet, falsches Zeugnis zu bestrafen. Die Kraft eines Beweises hat er nicht. Wenn der Angeklagte bestreitet, was drei Zeugen beschworen haben, so fragt ihn der Vorsitzende wohl: „Wollen Sie allen drei Zeugen Meineid vorwerfen?“ Sagt der Gefragte darauf schlankweg „ja“, was will das Gericht machen? Es steht dann einfach Behauptung gegen Behauptung, zwischen denen nach irgendwelchen Kriterien entschieden werden muß. Widersprechen gar die beschworenen Aussagen selbst einander, so ist ja notwendig auf einer Seite falsch geschworen worden; aber selbst wenn man nicht an einen harmlosen, subjektiv wahrhaftigen Falscheid glaubt, in jedem dieser Fälle Anklage wegen Meineides zu erheben, verbietet sich schon durch ihre Häufigkeit.
Vereidigt wird der Zeuge auf seine Aussage, und sie ist es, die das eigentliche Material der Gerichtsverhandlung bildet. Wenn man im Leben etwas über Vorgänge erfahren will, an denen man nicht teilgenommen hat, so sagt man zu seinem Gewährsmann „Nun erzähle mal.“ So verfährt das Gericht nicht; denn es würde sich damit uferlosem Geschwätz ausliefern. Vielmehr nimmt der Vorsitzende den Zeugen zwischen seine ganz präzisen Fragen, aus denen es kein Entrinnen gibt. Will er ausbrechen, so wird er mit einem harten „Das interessiert uns nicht“ zurückgerufen. Schließlich ist das Stück Wirklichkeit, über das vernommen wird, in gradlinig-rechtwinklige Reihen gebracht, aus denen man wie aus einer Rechenaufgabe das Resultat ziehen kann.
Gut; aber was wird dabei aus der Wirklichkeit? Es kann geschehen, daß der Richter an ihr vorbeifragt. Als Beispiel ein Beleidigungsprozeß: Der Portier behauptet, die Wirtin habe ihn beschuldigt, daß er elektrische Kraft von der Treppenbeleuchtung heimlich für seine Wohnung ausnutze. Vorsitzender: Woher wissen Sie das? Portier: In einer Mieterversammlung hat es der Mieter A. gesagt. Vors.: War denn die Wirtin in der Versammlung? Portier: Nein, aber alle Mieter haben es gehört. Vors.: Dann hat doch der Mieter A. Sie beleidigt und nicht die Wirtin, und Sie hätten den Mieter A. verklagen müssen. Ich rate Ihnen, die Klage gegen die Wirtin zurückzunehmen. – Der Portier ist hilflos, verlangt aber, daß der Mieter A. als Zeuge vernommen werde. Nach langer Debatte zieht der Portier seine Klage zurück. Niemand kommt darauf, das erlösende Wort zu sprechen, nämlich: Der Mieter A. hat nicht gesagt, der Portier habe Elektrizität gestohlen, sondern er hat in der Versammlung gesagt, die Wirtin habe diese Behauptung aufgestellt, und er soll nun als Zeuge darüber vernommen werden, daß, wann und wo sie das gesagt habe. Aus jener Verhandlung ging der Portier weg mit dem Gefühl, sich in den Maschen der Juristerei verstrickt zu haben.
Vielleicht am krassesten wirkt die Schematisierung der Wirklichkeit in Ehestreitsachen. Ist Ehebruch begangen worden, ja oder nein? Ist Verzeihung gewährt worden, ja oder nein? Das Urteil läßt sich dann jedesmal wie aus einer Tabelle ablesen. Was eigentlich vorgeht zwischen zwei Menschen, die in Liebe oder Haß verbunden sind oder waren, davon gelangt kein leiser Nachklang in die Akten.
Die Beweisaufnahme ist zu Ende, das Urteil muß gesprochen werden. Nach der Empfindung des Laien ist alles ungeklärt, die Aussagen widersprechen sich, manches, was man wissen müßte, läßt sich nicht feststellen. Unsereiner würde nicht wagen, irgendeine Meinung zu äußern. Trotzdem fordert der Vorsitzende den Staatsanwalt auf, seine Anträge zu stellen, und trotzdem erhebt dieser sich sogleich, sagt bestimmt, welche Behauptungen der Anklage bewiesen, welche Einwände der Verteidigung widerlegt seien, und formuliert die Strafe auf den Tag und den Pfennig genau. Ihm gegenüber hat der Verteidiger es leicht; er braucht bloß auf alles hinzuweisen, was zweifelhaft geblieben sei, und vor Bestrafung auf unsicherer Grundlage zu warnen. Dann zieht sich der Gerichtshof zurück, und wenn er wieder erscheint, weiß er, was Rechtens ist. Er weiß es Punkt für Punkt, mit kluger, abwägender Begründung. Sicher kommt ihm die jahrelange Übung zugute. Immerhin: unsereiner hätte es sich nicht getraut.
Unzulänglich ist Gericht, wie alles Menschenwerk. Weil es sich um Menschenschicksal handelt, bemerkt man die Unzulänglichkeit besonders schmerzlich. Und begreift sogleich schmerzlich die Notwendigkeit dieser kalten Normen und Formen. Leicht kann der Beruf des Richters unmöglich sein. Hoffentlich empfinden ihn die Richter nicht als leicht. Hoffentlich halten sie sich immer gegenwärtig, daß sie Recht nicht schaffen, sondern bestenfalls finden können. Wohl aber uns anderen, die wir nicht zu richten brauchen!
Schuld und Sühne
Soviel darf auch der Laie von der Jurisprudenz wissen, daß es einen Streit der Theorien gibt, von denen jede auf ihre Art das Amt des Richtens rechtfertigen will. Schon daß es gerechtfertigt werden muß, bedeutet ein hartes Urteil. Zugleich aber begreift der Laie, daß während der Ausübung seines Berufes der Richter nur fragen darf, was der Angeklagte begangen hat und welche Strafe das Gesetz verhängt, und nicht, was ihn, den Menschen, berechtigt, über ihn, den Menschen, Gericht zu halten. Auch der Soldat in der Schlacht darf nicht nachdenken über das Recht zu töten, der Handwerker nicht über die Existenz der Außenwelt und der Verfasser des Eisenbahnkursbuches nicht über die Idealität von Raum und Zeit. Bei irgendwelchen Voraussetzungen muß jeder, der handeln will, sich beruhigen.
Aber andererseits kann ja das Gericht nicht einen Schritt tun, ohne gewisse Maßstäbe der Moral und Intelligenz anzulegen. Wenn Angeklagte und Zeugen befragt werden, wenn Staatsanwalt und Verteidiger plädieren, wenn die Geschworenen sich über Schuldig oder Unschuldig oder über mildernde Umstände schlüssig machen, und wenn schließlich das Gericht sein Urteil spricht: immer wird der Fall gemessen an allgemeinen Ansichten und Einsichten, von denen vorausgesetzt wird, daß sie sich von selbst verstehen und daß jeder Vernünftige und Redliche sie anerkennt.
Indessen, diese Voraussetzung trifft keineswegs zu. Die ethischen und psychologischen Wertungen der Gerichtspraxis sind sehr häufig Klischees, von scheinbarer Allgemeingültigkeit, die keiner Prüfung standhält. Dazu gehört schon der Eindruck, den der Mensch vor den Schranken macht. Daß der eine – Angeklagte oder Zeuge – durch Erscheinung, Kleidung, Auftreten, Aussage gewinnt, der andere Abneigung weckt, schon dies beruht auf sehr primitiver, wenn auch suggestiver Ausdeutung äußerlicher Merkmale. Ein Angeklagter, in eine Wohnungsschiebung verwickelt, gibt als seinen Beruf an: Vertreter einer Sektfirma. „Um Gottes willen!“ ruft der Vorsitzende aus, eine rasch erregte primitive Voreingenommenheit unvorsichtig verraten. „Leichte Damen“ müssen Zeuginnen sich nennen lassen, mit denen ein junger Mensch, der unterschlagen hat, ausgegangen ist. Es war von ihnen nichts weiter festgestellt worden als diese Tatsache. Nach welchem Maßstabe also leichte Damen? Nicht am Ende auf Grund konventioneller Anschauungen einer sehr dünnen Gesellschaftsschicht? „Wirrkopf“ heißt ein anderer vor aller Öffentlichkeit. Gewiß, für oberflächliche Verständigung genügt dieser Begriff. Auch als Element eines Urteils, an dem Menschenschicksale hängen? Über eine jugendliche Diebin: „Man muß doch mehr Verdorbenheit und schlechten Charakter annehmen.“ Was ist Verdorbenheit, was Mangel an Widerstand, was Zwang der wirtschaftlichen Lage, was Kraftüberschuß? Was ist guter, was schlechter Charakter, was überhaupt Charakter?
Am stärksten im Banne der konventionellen Verurteilung steht die Sexualsphäre. Das Sexus ist unanständig – daher wird bei jeder Verhandlung, die dieses Gebiet berührt, das Publikum hinausgeschickt. Aber den Grundsatz der Öffentlichkeit des Gerichts einmal anerkannt, so geschieht dem Recht mit jedem Verfahren hinter verschlossenen Türen Abbruch. Schamgefühl? Aber niemand nimmt Rücksicht auf die bittere Scham eines noch nicht abgestumpften Menschen, den irgend ein Betrug vor seine Richter zerrt. Aus der Untersuchungshaft vorgeführt zu werden und dazustehen im Pfeilregen der geschäftsmäßig gleichgültigen oder unverschämt neugierigen Blicke: entsetzliche Marter! Über den Freund, den Gatten, über Vater und Mutter, über die eigenen Kinder, ja nur über den Nebenmenschen auszusagen, aus der Stille des Hauses, aus vertrautem Briefwechsel, aus belauschtem Gespräch zu verraten: tiefe Beschämung, auch ohne daß von erotischen Dingen nur entfernt die Rede geht. Böses Beispiel? Aber kann der ungefestigte Zuschauer nicht auch aus breit verhandeltem Diebstahl, Einbruch, Raub, Mord die Luft zur Nachahmung schöpfen? Übrigens werden Sexualverbrechen, wenn sie erst vor den Richter gelangen, kaum noch reizen, viel eher abstoßen.
Auch der Richter indessen wagt nicht immer, Wert und Art des Menschen zu bestimmen. Für schwierige Fälle – als ob es leichte gäbe! – hat er Sachverständige zur Verfügung. Sonderbarerweise gelten als sachverständig für Seelen nicht Dichter oder Weise oder Heilige – denn die stehen in keinem Adreßbuch –, sondern Ärzte. Tragikomisches Kapitel der Gerichtspraxis!
Der medizinische Sachverständige stellt fest, daß der Angeklagte zwar geistig und moralisch minderwertig, aber nicht unzurechnungsfähig sei und daher den Schutz des Paragraphen soundso nicht genieße; aber daß die freie Willensbestimmung bei Begehung der Tat ausgeschaltet war und er daher nicht verantwortlich gemacht werden könne. Glücklicher Zeitgenosse! Das Rätsel, um das die Denker sich bemühen, Freiheit oder Determination des Willens, er hat es selbst, vielleicht nicht ein für allemal, aber von Fall zu Fall. Er erklärt den Angeklagten für einen minderwertigen Menschen. Benützt er den Maßstab für Menschenwert überhaupt? Im Gesichtskreis des römischen Statthalters von Judäa war Jesus aus Nazareth minderwertig; der Militärarzt hätte Friedrich Schiller als minderwertig mit Geringschätzung behandelt; gegen Nietzsches revolutionäre Lehren haben Gegner eingewandt, daß es Fälle unzweifelhafter Geisteskrankheit gibt; aber auch unzweifelhafter Gesundheit des Geistes? Das Gericht müht sich mit einem Zeugen ab, der einen blöden und zurückgebliebenen Eindruck macht, von dem aber auch der Sachverständige nicht sagen kann, ob er den Vorgang versteht, über den er befragt wird. In seiner Ratlosigkeit verfällt der Vorsitzende auf die groteske Frage: „Halten Sie sich selbst für geisteskrank?“
Neben den ethischen und psychologischen Theorien für den Handgebrauch gibt es auch welche über den Strafzweck. Unbeschwert von Skrupeln plädiert der Staatsanwalt gegen vier Einbrecher: „Die Strafe muß empfindlich ausfallen, damit sie endlich einmal von ihrem bösen Vorhaben absehen.“ Er setzt also voraus, was von Theoretikern umstritten wird, daß der Staat straft, um zu bessern, und ferner, daß die Strafe, in diesem Fall 1 Jahr 9 Monate Gefängnis, bessernde Wirkung ausübt. Das Volk denkt anders. Fürsorgeerziehung wird ja wohl in rein pädagogischer Absicht verhängt. Aber die bekümmerte Mutter eines jugendlichen Taugenichts fleht den Richter an: „Bitte, stecken Sie ihn nicht in Zwangserziehung, sonst verdirbt er uns noch ganz und gar.“ Vermutlich hat die Mutter recht, daß diese Art von Erziehung nicht bessert, sondern verschlimmert.
Der Fall dieses Jugendlichen liegt so: ein achtzehnjähriger großer, derber, blondhaariger Bursche von offenem intelligentem und sympathischem Gesichtsausdruck. Er ist von Hause weggelaufen, hat sich umhergetrieben und schließlich gestohlen. Ist in Fürsorgeerziehung gebracht worden, ausgebrochen, hat sich nicht nach Hause getraut, ist in Not geraten und hat wieder gestohlen. Dazwischen hier und da Arbeit. Jetzt steckt er in einem ganzen Bündel von Strafverfolgungen. Ein Teil ist abgeurteilt, ein Teil verbüßt. In zwei Sachen wird neu verhandelt und gerichtet. Man erwägt sorgfältig, welche Straftaten nach der Prozeßordnung zusammengelegt, wie verbüßte Strafe, Strafaufschub, Untersuchungshaft verrechnet werden können. Der Bursche aus dem Gefängnis vorgeführt, erhält eine Handfessel angelegt, um von seinem Begleiter zurückgebracht zu werden. Beim Abgehen bricht er in Tränen aus und droht mit Selbstmord. „Was hat er gesagt?“ fragt der Vorsitzende. Es ist nichts zur Sache, das Gericht wendet sich zum nächsten Fall. Ein Verbrecher oder ein Verirrter, der mit dem Überschuß an jugendlicher Kraft und mit ungeleiteter Sehnsucht nichts anzufangen weiß? Ohnmächtig hinkt die Justiz mit ihrer wohlerwogenen Zahl von Monaten Gefängnisses hinter dem wildgewordenen Junghengst drein, den eine starke, milde und kluge Hand vielleicht zähmen und zu Höchstleistungen erziehen könnte, den aber solche pedantische Abstrafung ganz gewiß nur noch störrischer macht.
Der Richter freilich beruft sich aufs Gesetz. Ihm ist anerzogen, daß er sich nicht für Parlament hält und nicht Gesetze zu machen, sondern anzuwenden hat, ohne zu fragen, ob er sie billigt. Daß er sich von der eigenen Meinung über die Gerechtigkeit des Gesetzes freimacht, darin besteht seine Berufsehre. Sie ist nicht leicht zu erfüllen, und es fällt dem Außenstehenden nicht leicht zu begreifen, daß an solcher Bindung des Richters an das Gesetz, die im Einzelfall zu schwerem Gewissenskonflikt führen kann, das bißchen Rechtssicherheit hängt, das uns Menschen erreichbar ist. Der Laienrichter hingegen erschrickt vor den Konsequenzen seiner Pflicht. Deshalb erlebt man, daß der Staatanwalt im Plädoyer und der Vorsitzende in der Rechtsbelehrung die Geschworenen zur Härte ermahnt, indem ihnen klargemacht wird, daß es nicht ihres Amtes sei zu entscheiden, ob auf dieses Verbrechen diese Strafe paßt (z. B. in einer Anklage wegen Lohnabtreibung, wo vom Ankläger bis zum Verteidiger sich alle darüber einig sind, daß das Strafgesetz mit unseren Anschauungen nicht mehr übereinstimmt). Deshalb aber erlebt man auch, daß die Geschworenen die allzu harte Strafe abwenden auf dem einzigen Wege, der ihnen offensteht: indem sie die Schuldfrage verneinen. Dem Juristen wird dergleichen ein Versagen der Laiengerichte bedeuten, dem Menschen, der nicht parteipolitisch fanatisiert ist, wird es lieber sein, daß inkorrekt zu milde, als daß korrekt zu streng bestraft wird.
Wir rufen, rufen mit dir in die unerbittliche Zeit,
Ins unerbittliche Walten: Gerechtigkeit! dröhnt ein Dichterwort. Wir Menschen, gezwungen über Menschen zu richten und doch nicht fähig dazu, wir rufen es nach – und rufen vergebens.
Vossische Zeitung, 30. Januar, 11. Februar und 4. März 1923