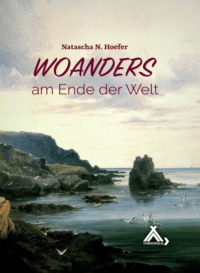Kitabı oku: «Woanders am Ende der Welt», sayfa 7
Kaum, dass sie ausgetrunken haben, schenkt der Wirt von dem anderen Zeug ein. Es sieht nicht sehr viel anders aus als das von eben.
»Yehermat«, ruft der alte Mann am Nachbartisch ihnen zu.
»Prost«, rufen sie zurück und trinken.
Marlene hustet, das brennt! Der alte Mann, der ihnen zugeprostet hat, lacht und klopft auf den Tisch. Aber Traute setzt ihr Glas ab und sagt: »Das ist lecker!«
»Dann nimm noch einen«, und Gisela gießt Traute nach.

Als sie aus der Bar in die Sonne treten, fühlt Marlene sich leicht und lustig. Jetzt weiß sie, was ein echter Schwips ist.
»Au revoir«, ruft Gisela lachend über die Schulter zurück.
»A la prochaine«, hören sie den Wirt zurückrufen.
Traute hat Mühe, geradezugehen. Sie hat am meisten von dem Lambig getrunken.
»Was singen wir jetzt?«, fragt Marlene.
Traute fängt schon wieder mit dem Panzerlied an, aber Marlene und Gisela übertönen sie mit Oh Tannenbaum. Danach einigen sie sich auf Kling Glöckchen klingelingeling.
»Jetzt sind wir schon wieder falsch«, ruft Traute aus, als sie bald darauf an den Abgrund treten.
»Hu, mir ist schwindelig«, giggelt Gisela.
»Wir wollten zum Dorf«, mault Traute.
»Du mit deinem Dorf! Du willst dir wohl ’nen Soldaten anlachen!« Gisela lacht überdreht.
Marlene muss mitlachen.
»Sei du nur still«, faucht Traute sie an, »so wie du bei Leutnant Rosen Liebkind machst!«
»Was? Rosen?!«, ruft Marlene aus, mehr belustigt, als empört.
»Stimmt schon, dass er dich auffallend oft anspricht«, bemerkt Gisela und legt den Kopf schief. »Viel Spaß mit dem. Gratulation, Marlene!«
»Du spinnst ja«, protestiert Marlene, nun doch verärgert.
»Nein, Gisela hat Recht«, setzt Traute nach.
»Und du, sei still! Du willst ja nur in das Dorf, weil du sowieso zu faul zum Wandern bist!« Und sie äfft Trautes Gejammer von vorhin nach: »Ich krieg’ keine Luft mehr! Ich bin außer Atem! Oh lasst uns atemlos das Panzerlied singen!«
Gisela kann nicht aufhören zu lachen.
Traute reißt die Augen auf, wendet sich ab und beginnt zu laufen.
»Was ist jetzt?«, fragt Marlene.
»Jetzt ist sie beleidigt«, gibt Gisela prustend zurück.
»Traute, es war doch nur Spaß«, ruft Marlene halbherzig, aber die Beleidigte rennt nur noch schneller.
»Vorsicht!«, ruft Gisela noch, plötzlich nüchtern, aber da passiert es: Traute rutscht auf dem Geröll aus – und stürzt in den Abgrund!

Sie weiß nicht, wie sie dorthin gekommen ist, aber als Marlene wieder klar denken kann, starrt sie in die Tiefe.
»Traute! Nicht bewegen!«, schreit Gisela neben ihr.
Gut vier Meter unter ihnen liegt Traute auf dem Rücken. Ein Auswuchs des Felsens hat sie gerettet. Unter ihr, gähnende Leere; dann, ganz weit unten, das anrollende Meer. Trautes Bein sieht merkwürdig verrenkt aus.
»Wir brauchen Hilfe«, sagt Marlene, »aus der Bar!«
»Du oder ich?«, fragt Gisela. Marlene stürzt los.
Der Schock hat sie ernüchtert. Sie läuft, was sie laufen kann. Der
Weg kommt ihr weit vor. Endlich, das Chez Gégé!
»Hilfe, à l’aide«, bringt Marlene hervor. Sie sieht in fragende, fast irritierte Gesichter. Sind die Leute hier noch mehr geworden? Alles ist so verqualmt.
Der Wirt tritt auf sie zu.
»Traute, mon amie! Tombée!« ruft Marlene verzweifelt.
Der Wirt nickt langsam. Er verschwindet in einem Nebenraum. Als er zurückkommt, trägt er ein zusammengerolltes Seil und eine Schaufel über der Schulter. Vier weitere Männer begleiten sie zu der Absturzstelle.

»Endlich!«, ruft Gisela ihnen entgegen.
Der Wirt schaut hinab. Traute liegt noch so da wie vorhin. Sie schluchzt hysterisch, will oder kann sich nicht bewegen.
Während einer der Männer das Seil um seine Hüften knotet, gräbt ein anderer eine Rille. Marlene begreift. Die Rille soll den Füßen der Männer Halt geben, die das Seil halten werden.
Es ist so weit. Der Angeseilte klettert zu Traute. Er beugt sich über sie, tastet sie ab. »C’est son genoux!«, ruft er nach oben.
Die Männer beraten sich. Marlene und Gisela schauen sich bange an.
Einer geht fort. Kommt Minuten später wieder, mit einem weiteren Seil und in Begleitung eines Einheimischen, der auffallend muskulös und groß ist. Der trägt eine Bahre, wie die aus dem Feldlazarett, und eine Decke. Wo haben die diese Bahre her, fragt sich Marlene? Aber sie geht dieser Frage nicht nach. Hauptsache, sie retten Traute!
Der Große wird abgeseilt. Marlene beugt sich vor. Jetzt ziehen sie den Mann, der Traute untersucht hatte und der bei ihr geblieben war, wieder nach oben. Dann binden sie die Bahre und die Decke an das Ende des Seils und lassen beides herunter. Auf der Felsnase ist kaum Platz, um die Decke über der Bahre auszubreiten. Der Große muss sich breitbeinig über Traute stellen, um das zu tun.
Marlene tritt einen Schritt zurück. Sie kann nicht länger hinabsehen. Ihr wird schlecht, sie erbricht sich. Wortlos reicht ihr einer der Umstehenden ein Taschentuch.
Es dauert noch lange, bis Traute auf die Bahre gebettet, in die Decke gerollt und mit dem Seil an der Bahre festgezurrt ist. Dann ziehen die Männer sie nach oben.
Am späten Nachmittag kommen Marlene und Gisela in dem Dorf an, das Traute so gerne sehen wollte. Sie liegt apathisch auf der Bahre, die stets zwei ihrer Helfer abwechselnd tragen.

Wochen später bestätigt sich die Befürchtung des Arztes: Trautes Knie ist steif. Sie wird ihr Leben lang lahm bleiben.
Es ist ihre Schuld, Marlenes. Ihre und Giselas; sie haben sich beide über Traute lustig gemacht. Deshalb ist die zu nah am Abgrund fortgerannt und hinuntergestürzt. Aber noch mehr ist es ihre Schuld, weiß Marlene; sie hat Traute zuletzt nachgeäfft. Sieht Gisela das genauso? Marlene weiß selbst nicht, wie es dazu kommt, es passiert einfach: Ihr Schuldbewusstsein schiebt sich zwischen sie und ihre einst beste Freundin. Marlene und Gisela verlieren Kontakt. Sie grüßen sich noch, wenn sie sich sehen, aber mehr nicht.
Traute redet mit Marlene kein Wort mehr. Wie es zwischen Traute und Gisela steht, weiß Marlene nicht.
Jetzt ist sie ganz allein in dem fremden Land.
Florian ließ das Tagebuch sinken. Er musste an Hildegard denken. Die beste Freundin seiner Oma war vor zwei Jahren gestorben. Das war ein harter Schlag für seine Oma gewesen. Danach hatte sie verkündet, sie sei alt und wolle in ein Heim. Florian hatte ihr zugeredet, es nicht zu tun. Aber sie – sie hatte sich aufgegeben, irgendwie. Ja, indem sie ihr Haus aufgegeben hatte, hatte sie ihr Leben aufgegeben. Seitdem wirkte sie ruhig und gelassen und – komplett gelangweilt, in diesem Heim, für das sie noch zu fit war. Gut, sie las, sah fern und lebte viel in ihren Gedanken. Aber war das noch leben? Sie war nicht wirr und auch körperlich noch ganz gut beieinander. Ihr fehlten Erlebnisse, neue Anregungen. Sie hätte reisen sollen, anstatt sich im Heim zu begraben!
Wenn ihm Boris‘ Haus gehören würde, dann würde er seine Oma einmal hierher mitnehmen. Oh ja, das wär’s. Ein Haus in der Bretagne. Und warum nicht wirklich dieses hier? Boris schien es doch gar nichts zu bedeuten; der ließ es verfallen, kam nie hierher. Wenn er ihn einfach fragen würde? Hey Boris, willst du dein Haus in Mengleuff nicht verkaufen?
Gut, nun aber zurück zur Geschichte seiner Oma. Er spürte, dass er noch immer zu aufgekratzt war, um an schlafen zu denken. Im Bett lauerten die Gedanken an Katharina. Nein! Dann lieber weiterlesen, bis zur kompletten Erschöpfung. Doch zuvor nahm er sich einen Zettel. Er schrieb darauf: Cap de la Chèvre; Bar Chez Gégé; deutsches Dorf. Recherchieren, das war ab heute seine selbstgestellte Aufgabe. Recherchieren und Fotos machen oder zeichnen, für seine Oma. Um ihr Lust zu machen, mit ihm nochmal herzukommen. Also, dieses Cap würde er sich ansehen, gleich morgen.
Aber als Florian weiterlas, wurde ihm klar, dass er am nächsten Tag nicht zum Südkap von Crozon fahren würde. Etwa einen Monat nach Trautes Unfall, im Oktober 1942, war etwas viel Einschneidenderes passiert, und den Ort dieses Geschehens musste er als ersten sehen.
Das tat er dann allerdings nicht gleich am nächsten Tag; an dem hatte er einen totalen Durchhänger, verschuldet durch Yvonnes Lambig und eine durch Liebesschmerz bedingte Antriebslosigkeit. Während Marie nebenan verbissen Rasen mähte, Efeu kürzte und (schnell und leise, um bloß nicht von Florian dabei bemerkt zu werden) seinen Dünger auf die Erde unter den ramponierten Hortensien verstreute, lungerte Florian den Großteil des Tages im Bett herum, dann im Garten. So war es am Mittwoch, seinem dritten Tag in der Bretagne, dass Florian sich, das Tagebuch seiner Oma im Rucksack, auf den Weg zu »dem Berg« machte, wie die Einheimischen den Ménez-Hom laut Reiseführer nur nannten.
3 Die Krankheit kommt zu Pferd angeritten; Aber sie kehrt zu Fuß zurück.
4 Der Krumen und der Tropfen halten den Menschen aufrecht.
7. Verhängnisvolle Begegnungen
Sie reden kein Wort. Marlene starrt aus dem Fenster der Limousine. Sie hat sich rechtfertigen müssen, erklären, wo sie die Nacht über geblieben ist und warum sie die Botschaft nicht überbracht hat. Sie hat den durchweichten Umschlag zurückgegeben. Der Oberst hat sie durchdringend angesehen, als er das geöffnete Siegel sah. Aber er hat nichts dazu gesagt. Dann hat sie die Geschehnisse wahrheitsgemäß erzählt – aus der Ich-Perspektive, sie hat nie »wir« gesagt. Sie hat seine Rolle, die Rolle ihres neuen, einzigen und unmöglichen Freundes, im Unklaren gelassen. Sie hat gefürchtet, dass man nach ihm ruft, um auch ihn auszufragen. Der Oberst tat es nicht. So hat sie alles andere erzählt – nur den Fremden in der Kapelle hat sie weggelassen. Hat der Oberst ihr trotzdem etwas angemerkt? Sobald sie auf die Kapelle kam, ist er hellhörig geworden. Warum will er die Kapelle jetzt sofort sehen? Marlene hat Angst. Angst davor, Spuren vorzufinden, des fremden Mannes von letzter Nacht und der Kameraden, die er haben könnte. Er kannte ihn, diesen Mann; er könnte Ärger bekommen, sollten sie ihn erwischen. Sie hofft, er ist schon weit weg. Dabei weiß sie, sie dürfte das nicht hoffen.
»Wie weit noch?« Der Oberst dreht sich zu ihr und sieht sie an, forschend.
»Noch ein paar Kilometer, Herr Oberst. Die Kapelle liegt direkt an der Straße, auf der linken Seite.« Marlene bemüht sich um präzise Aussagen.
Der Oberst dreht sich wortlos zurück.
Sie sehen den Kirchturm aus der Ferne. Sie muss nichts sagen, der Oberst befiehlt dem Chauffeur, rechts am Straßenrand anzuhalten. Er steigt aus der Limousine und überquert die Landstraße. Soll Marlene mit? Der Oberst hat keinen Befehl dazu gegeben. Marlene bleibt sitzen und beobachtet ihn, wie er über die steinerne Schwelle den Kirchhof betritt.
Nach wenigen Minuten kehrt der Oberst zurück. »Abgeschlossen«, sagt er.
Seltsam, schießt es Marlene durch den Kopf. Letzte Nacht stand die Kapelle offen. Wer hat abgeschlossen seitdem, wann? Und dann, warum hat der Oberst nicht den Chauffeur geschickt, um zu überprüfen, ob das Kirchenportal offen ist? Er hatte es eilig, die Kapelle zu sehen, allein. Hat er einen Verdacht? Gegen wen? Marlenes Gedanken überstürzen sich.
Der Chauffeur fragt: »Aufbrechen, Herr Oberst?«
»Nein. Die Deutschen sind kein Volk der Barbaren. Wer hat den
Schlüssel zu diesem Gotteshaus? Finden Sie das heraus!«
Der Befehl geht an den Chauffeur, der aus der Limousine steigt. Er steuert die Tür des nächstgelegenen Hauses an. Ein relativ großes Haus, vielleicht das des Pfarrers.
Die Tür öffnet sich nicht unter den anhämmernden Fäusten. Der Chauffeur versucht es bei den anderen der wenigen Häuser. Doch alles ist verlassen. Keine arbeitenden Menschen, keine spielenden Kinder. Die Stille um sie ist unnatürlich.
Im letzten Haus, bei dem der Chauffeur es probiert, öffnet sich doch eine Tür. Eine gebeugte Alte humpelt heraus. Der Chauffeur spricht mit ihr; die Alte antwortet und schüttelt den Kopf.
»Sprach nur den Kauderwelsch von hier, Herr Oberst«, meldet der Chauffeur. »Aber sie sagte etwas vom curé in Promodern. Das ist dieses größere Dorf im Südosten.«
»Plomodiern. Gut. Fahren Sie nach Plomodiern und holen Sie den Schlüssel beim Pfarrer«, befiehlt der Oberst. »Sie bleiben hier«, dies an Marlene.
Sie steigt aus der Limousine, der Chauffeur startet und fährt ab.
»Kommen Sie«, fordert der Oberst sie auf. »Wir sehen uns die Kapelle genauer an.«
Marlene ist verwirrt, als der Oberst eine kleine galante Verbeugung macht, um ihr den Vortritt in den Kirchhof zu lassen. Folgsam tritt sie über den Schwellenstein. Sie kommt sich ungelenk vor, spürt den Blick des Obersts in ihrem Rücken.
»Wissen Sie, welchen Zweck diese steinernen Schwellen erfüllen?«, fragt er.
»Nein, Herr Oberst.«
»Sie tragen eine symbolische Bedeutung. Sie grenzen den heiligen
Kirchengrund vom Bereich des profanen Lebens ab.«
Marlene nickt, ohne zu begreifen. Worauf will der Oberst hinaus? Er ist schon ein paar Schritte weitergegangen und umrundet die drei Kalvariensteine. Vor dem höchsten, dem mittleren, bleibt er stehen.
»Diese kniende Figur ist bemerkenswert«, sagt er.
Marlene sagt nichts. Was soll sie auch dazu sagen?
»Ich vermute, dass es sich um eine Darstellung der Maria Magdalena handelt. Eine schöne junge Frau mit sanften, regelmäßigen Gesichtszügen und langen, offenen Haaren. Sie betet Jesu an, und das gleich zweifach: direkt über ihr liegt er tot auf dem Schoß seiner Mutter – und darüber hängt er noch einmal, leidend am Kreuze. Obwohl der Granit steingrau ist, sieht man doch: Maria Magdalenas Locken sind rotblond.« Der Oberst schaut zu Marlene.
»Ja, jawohl, Herr Oberst«, stammelt sie.
Er lächelt. Mitleidig? Herablassend? »Wie alt sind Sie?«
Marlene fühlt sich erröten. »Siebzehn Jahre, Herr Oberst«, antwortet sie.
Der Oberst wendet den Blick zurück zu der knienden Maria Magdalena. »Aus welcher Richtung sind Sie vergangene Nacht bei dieser Kapelle angekommen?«, fragt er beiläufig.
»Von dort, Herr Oberst«, sie zeigt in Richtung des Berges. Jetzt beginnt das Verhör, denkt sie.
Doch sie irrt sich. Der Oberst befiehlt: »Kommen Sie«, und sie umrunden gemächlich die Kapelle. Er weist sie auf die grotesken Zierfiguren und auf die Wasserspeier hin – ein dicker Mann, ein affenähnliches Wesen, das aber ein Löwe sein soll, mit Mähne; langgezogene Mäuler, durch deren Zahnreihen bei Regen das Wasser herausschießt. Gestern Nacht muss es so gewesen sein. Ein ganzer Sturzbach muss zwischen diesen scharfen Zähnen hervorgeschossen sein, denkt Marlene. Heute ist der Himmel blau und rein, ohne Wolken. Nur das Gras durchnässt ihre Schuhe. Die Nacht ist hier draußen wie fortgewischt. Doch drinnen – was wird drinnen sein? Wo bleibt der Chauffeur mit dem Schlüssel?
Zerstreut hört Marlene die Worte, mit denen der Oberst die Architektur der Kapelle beschreibt. Renaissancekuppel, Barocktor, drei Galerien, Rhythmisierung des Kirchturms – vergeblich versucht Marlene, dem Sinn dieser Begriffe zu folgen. Wo ist er jetzt? In Sicherheit?
Endlich das ersehnte Motorgeräusch. Marlene blickt rasch zum Oberst, der in seinen Erläuterungen gestockt hat. Seine Wangen sind gerötet, in seinen Augen, die in Richtung Landstraße spähen, liegt ein Funkeln, das Marlene beunruhigt. Sie beißt sich auf die Lippen. Was erwartet der Oberst in der Kapelle? Mittlerweile weiß sie genau, was geschieht, wenn sie, die Deutschen, auf Konspiratorennester stoßen. Die Einheimischen wissen es auch. Haben sie deshalb den Ort verlassen? Und die gebeugte Alte? Vielleicht wollte sie nicht. Lieber zuhause sterben.
Der Oberst hat sie wortlos stehengelassen und ist auf dem Weg zum Kirchenportal. Eigenhändig schließt er auf. Lautlos schwingt die Tür in ihren Angeln – unerwartet lautlos für eine so alte Tür. Der Oberst atmet ein, senkt den Kopf, als ob er sich durch ein niedriges Tor bücken müsste, und verschwindet im dunklen Kircheninneren.
Marlene zögert. Dann geht sie ihm nach.
Es ist drinnen gar nicht so dunkel. Nach einigen Sekunden haben sich Marlenes Augen an das Dämmerlicht gewöhnt.
Der Oberst steht mit dem Rücken zu ihr, vor der Altarwand der Kirche. Der Goldglanz und die kräftigen Farben sind noch überwältigender als bei Nacht, im bloßen Schein der Öllampe. Marlene tritt selbst fasziniert näher, um die Reihe der bunten Figuren, der plastischen Bilder und des bewegt wirkenden Schnitzwerkes zu betrachten. Es stellt Ranken dar, erkennt sie, Blätter und Traubenreben, Schleifen um Engelsköpfe, alles goldschimmernd, voller Schnörkel und Kurven, ein einziges Gewimmel.
Marlene fühlt sich befremdet von dem Gold und dem Glanz, der Pracht und Verspieltheit dieses Kirchenschmuckes. Er ist so anders als der von zuhause, aber auch zu der Welt der armen Bauern- und Fischerhäuser von hier will er nicht passen. Noch weniger zu der Welt der Bomben und Maschinengewehre.
Sie tritt ganz nah an die hölzerne Balustrade heran, die den Altarbereich vom Kirchenschiff abtrennt, beugt sich ein wenig darüber. Nichts. Keine Decke, keine Öllampe mehr. Sie atmet auf. Schnell späht sie zum Oberst hinüber. Hat die Richtung ihres suchenden Blickes ihm etwas verraten? Nein. Der Oberst hat kein Auge für sie. »Ha. Direkt vor der Haustür«, stößt er heiser aus. Er schreitet die Altarwand von rechts nach links und von links nach rechts ab, ein Heiligenbild nach dem anderen fixierend. Er seufzt tief auf, blickt zu Marlene und sagt:
»Gehen wir.«
Florian schlug die Kladde zu und blickte auf die Kapelle vor sich. Es war anders, den verstörenden Eintrag ein zweites Mal zu lesen – vor Ort, dort, wo alles passiert war.
Er saß auf dem Sockel des größten der drei Kalvariensteine, dem mit der knienden Maria Magdalena. Er hob den Kopf. Ja, diese Figur war schön. Er griff in den neuen Wanderrucksack und holte den gleichfalls neuen Skizzenblock und die Bleistifte heraus. Er hatte auch den Fotoapparat dabei; aber die Lust, einmal wieder zu zeichnen, hatte neulich in Camaret von ihm Besitz ergriffen. Wenn er zeichnete, war das eine andere, eine intensivere Art, Gegenstände, Orte oder Menschen zu erforschen.
Er stand auf und entfernte sich vom Kalvarienstein, um die Maria Magdalena aus günstigerer Perspektive zu skizzieren. Im Stehen, ohne feste Unterlage, war das nicht einfach; trotzdem verspürte er am Ende eine lange nicht mehr empfundene Zufriedenheit angesichts seiner gelungenen Skizze. Er setzte sich wieder auf den Sockel des Kalvariensteins, um jetzt die Kapelle zu umreißen. Ihren Turm mit der Kuppel, aus dem ein schmalerer, wiederum oben abgerundeter Türmchenabschluss erwuchs. Die Kuppelform war typisch für Renaissance- und Barockarchitektur; Marlenes Oberst hatte Bauzeit und Stil der Kapelle richtig eingeschätzt, der Mann hatte sich mit Architektur und Kunstgeschichte ausgekannt.
Florian hatte den Eintrag zur Entstehung der Kapelle an einem uralten Wegekreuz im Reiseführer nachgelesen, aber was ihn eigentlich interessierte, stand nicht darin: Welche Bedeutung hatte die Chapelle Sainte-Marie im zweiten Weltkrieg gehabt? War sie ein Konspiratorennest gewesen? Diese Frage stellte er sich zeichnend erneut; ehe er den Skizzenblock wegsteckte und aufstand, um die Kapelle zu umrunden.
Die groteske Figur des dicken Mannes, vielleicht ein Mönch, und das affenartige Löwenviech waren noch da, auch die brutal aussehenden Wasserspeier. Einen davon musste er doch noch skizzieren; dieser Wasserspeier glich einem Krokodilmaul mit Riesenzähnen, die ineinander verkantet waren. Vorne sah man das Loch für das abfließende Wasser. Florian setzte ein paar letzte Striche auf das Blatt und hielt inne. Sie war unheimlich, diese Begegnung mit den steinernen Zeugen der Vergangenheit seiner Oma. Es war fast, als würde er eine Zeitreise machen und Dinge sehen, die niemand sehen durfte. Andererseits wollte seine Oma, dass er sie sah. Sonst hätte sie ihm ihr Tagebuch nicht gegeben.
Plötzlich hatte er keine Geduld mehr zum Weiterzeichnen. Von wo aus hatte seine Oma sich damals der Kirche genähert? Jetzt sah er es. Nur nach hinten, zum Berg hin, war in der Kirchhofmauer eine Öffnung, eine Einfahrt. Von dort also. Von dort musste Marlene in den Kirchhof gefahren sein, bei Nacht und Unwetter auf einem Motorrad, festgeklammert an diesen Kriegsgefangenen, den sie nur den
»Jungen« oder einfach »er« nannte oder einmal ihren »neuen und einzigen und unmöglichen Freund«.
Florian betrat die Kapelle. Diesen Augenblick hatte er sich für zuletzt aufgespart. Würde sie noch so aussehen, wie Marlene es beschrieben hatte?
Es war nicht mehr 1942, und für die modernen Touristen hatte man Scheinwerfer angebracht, die die Altarwand beleuchteten. Florian überkam eine Gänsehaut. Er tat es dem Oberst nach und schritt die Reihe der Heiligenfiguren ab, deren Farben nicht verblasst waren. Sie schienen unheimlich lebendig in ihren Nischen oder auf ihren Sockeln für ihn zu posieren.
Hatte der Oberst das hier sehen wollen? Und zwar unbedingt, nicht als Barbar, sondern dank des Schlüssels, den der Chauffeur aus dem nächstgrößeren Dorf holen musste? Für Konspiratoren hatte der sich doch nicht interessiert! Dabei, dieser Mann, der bei Nacht und Gewitter in der Kirche aufgetaucht war, war der nicht im Widerstand gewesen? Und der junge Kriegsgefangene selbst? Konnte er im Widerstand und zugleich ein Kriegsgefangener gewesen sein?
Florian trat hinaus in das blendende Licht. Er würde zu Fuß den Berg besteigen, beschloss er. Er hatte gesehen, dass es von der Kapelle aus einen Wanderweg zum Gipfel gab.

Marie fuhr an der Chapelle Sainte-Marie vorbei auf den Parkplatz. Es war ein idealer Tag zum Wandern – klarer Himmel, heiße Sonne, aber ein erfrischender Wind. Sie hatte die Nase voll von Gartenarbeit, sie brauchte mal eine Abwechslung.
Sie holte den Rucksack aus dem Kofferraum. Er enthielt zwei große Baguette-Sandwiches, einen Apfel und eine Flasche Wasser zum Picknicken. Dass der deutsche Cayenne am anderen Ende des Parkplatzes stand, bemerkte sie nicht.
Sie machte einen Haken über den Kirchhof und grüßte die schöne, aber etwas finstere Kapelle. Dann ließ sie sie im Rücken, um der Landstraße ein Stück weit zu folgen. Die wand sich, begleitet von einem glucksenden Bachlauf, in ein Tal hinunter. Aber Marie wollte hinauf; also bog sie bald in einen steilen Schotterweg ein, dessen Steine in der heißen Sonne weiß aufleuchteten. Auch die staubige Erde war weißlich-beige. Nach ein paar Hundert Metern endete der Weg vor einem Schild, das daran erinnerte, dass man sich in einem Naturschutzgebiet befand, in dem Fahrzeuge verboten waren. Der Fußpfad, auf dem es jetzt weiterging, wäre ohnehin für kein Fahrzeug befahrbar gewesen, meinte Marie kopfschüttelnd.
Sie kraxelte über Felsbrocken und Wurzeln, die sich hartnäckig im Boden festkrallten. Auf dieser Höhe des Berges wuchsen noch spärliche Haine aus windgebeutelten Kiefern. Nachdem sie eine Kieferngruppe durchschritten hatte, schaute Marie sich um: Unter ihr, bereits in der Ferne, lag die Chapelle Sainte-Marie, umgeben von gelben Feldern mit Heuballen und frischgrünen Weidewiesen. Weiter links erstreckten sich die Hügel in Richtung Châteaulin, bedeckt mit Feldern und Wäldern. Rechts sah man einen Streifen Blau am Horizont – das Meer.
Marie atmete auf und schritt weiter. Der Wind zerzauste ihr Haar. Der Wind war auf dem Ménez-Hom immer da, oft genug stürmisch. So stieß sie bald nur noch auf vereinzelte Bäume, denen man ihren Kampf mit den Stürmen ansah: Ihr Astwerk war dünn, an der Nordseite manchmal gänzlich abgebrochen, so dass die Bäume wie Schilder gen Süden zeigten. Hin und wieder ragten ganz nackte Stämme wie Pfähle aus dem Boden. Die hohen Gräser, die den Ménez-Hom überzogen, neigten sich und blitzten in der Sonne auf wie grüne Wellen.
Ganz oben, auf dem yed, würden Menschen sein; ein Fahrweg führte dorthin, der Genuss der Panoramaaussicht war beliebt. Doch hier, um Marie herum, war keine Menschenseele. Nur Weite, Stille, das Rauschen des Windes. Und dann doch eine einsam dahinwandelnde Silhouette – ein zweiter Wanderer hatte zum Besteigen des Berges seine Füße dem Auto vorgezogen.
Sie folgte ihm in einiger Distanz, bis sie bemerkte, dass der Abstand zu ihm sich verringerte. Zunächst beschloss sie, ihrerseits langsamer zu gehen. Dann wurde ihr das zu nervend, zumal die Person stehengeblieben war, um etwas zu fotografieren. Was hatte der Wanderer entdeckt, fragte Marie sich? Einen Hinkelstein oder den Rest eines Hünengrabs? Die Kelten hatten auf dem Ménez-Hom Belen gehuldigt, dem Gott des Lichts. Außerdem gab es hier noch Mauerreste zu sehen, bei denen man nicht mehr wusste, ob sie von den Kelten stammten, von der Festung Aiqins des Normannen oder schlichtweg vom Teufel, wie der Volksmund behauptete. Manche Grundsteine hatten den Umriss eines marc’h, eines Pferdes, was schließlich nicht mit rechten Dingen zuging.
Als der Wanderer sich umdrehte, um seinen Rucksack aufzuheben, blitzte etwas weiß an seiner Hand auf. Ein Verband. Oh nein! Er!
Aber auf ein Treffen mit diesem Florian hatte Marie nun gar keine Lust! Entsprechend erleichtert war sie, als sich ein paar Minuten später ihre Wege trennten: Der Deutsche überquerte die Fahrstraße zum Gipfel und folgte weiter dem Fußpfad; Marie würde folglich den Fahrweg hochgehen. Als sie sich wenig später noch einmal umwandte, hatte der blöde Kerl es sich allerdings anders überlegt. Er ging nun hinter ihr die asphaltierte Straße hoch. Na toll!
Auf dem Parkplatz am Ende der Straße schloss Marie sich kurzerhand einer Gruppe von Ausflüglern an. Sie wandte sich um, wo war er? Da! Schnell wandte sie ihm den Rücken zu, als er an ihrer Gruppe vorbeiging. Jetzt schlurfte er auf den steinernen Rundtisch zu, der den höchsten Punkt des Berges markierte, stemmte die Hände in die Hüften und schaute um sich. Unschlüssig schlenderte er ein paar Schritte weiter, blieb dann abrupt stehen. Er zückte den Fotoapparat und drückte ab. Aber da war doch gar nichts, wunderte Marie sich. Nur die gelbe Markierung des Wanderweges. Jetzt schaute der Deutsche sich eifrig nach allen Seiten um. Er schien etwas Interessantes entdeckt zu haben, denn er hastete los.
Marie trat aus der Ausflüglergruppe heraus. Sie musste wissen, was ihren Nachbar derart gefesselt hatte. Der stapfte durch hohes Gras auf ein Buschmassiv zu. Vielleicht musste er mal, dachte sie und blieb lieber stehen. Aber dann zückte er wieder die Kamera – und fotografierte die Büsche. Er ging um die Büsche herum und knipste sie aus anderer Perspektive. Dann hatte er ein weiteres Buschmassiv entdeckt – es gab nicht viele hier oben – und nahm Kurs darauf. Hatte der einen Knall?
Marie näherte sich ihrerseits dem Grünzeug, das Florian begeistert und systematisch abgelichtet hatte. Und jetzt sah auch sie es: Inmitten des Buschmassivs war eine Treppe! Unten war das Fundament eines Kellers, überwuchert von Efeu, Farn, Gräsern, Brennnesseln und Dornenranken. Ein Keller? Nein! Das Baumaterial war Beton, erstaunlich intakt, nur hier und da von lichen überzogen, gelblichem Moos. Der Rest eines Bunkers.
Marie stieß einen leisen Pfiff aus. Sie sah nach ihrem Nachbar. Der machte gerade Fotos des zweiten Buschmassivs, das er entdeckt hatte. Eine zweite Bunkerruine? Marie sah mit neuem Argwohn um sich. Ja. Es war ihr vorher nie aufgefallen. Aber die einzigen Büsche, die auf der Bergkuppe wuchsen, standen hier, ganz oben auf dem yed, und zwar in ringförmiger Anordnung. Yed bedeutete
»Ausguck«. Seitdem Menschen den Ménez-Hom bestiegen hatten, hatten sie den Berg strategisch genutzt: Von hier aus hatte man ein Dreihundertsechzig-Grad-Panorama und konnte die umliegende Gegend kilometerweit im Auge behalten. Die verdächtigen Buschmassive zeigten wie die Ziffern einer Uhr in alle Richtungen.
Marie ging ein paar Schritte zurück, sie musste etwas überprüfen. Ja, so war es: Dieser Mann, dieser Florian, der ihr gestern Blumendünger geschenkt hatte, dieser Mann hatte vorhin nicht das gelbe Zeichen des Wanderwegs fotografiert. Das Zeichen war aufgemalt auf ein Stück deutschen Weltkriegsbeton.
Marie griff sich an den Kopf. Sie war erschüttert. Sie hatte immer so gerne die Landschaft von hier oben aus gesehen – die Windungen des Flusses Aulne, der in die Bucht von Brest einmündete; die Hügelketten im Osten; die Küsten der Bucht von Douarnenez und von Crozon, die wie zwei gebogene Arme am Horizont aufeinander zustrebten, dazwischen das schimmernde Meer. Sie hatte das alles nie mit einem militärischen Blick angesehen, und es plötzlich zu tun, war ein Schock für sie.
Der noch größere Schock war aber die andere Erkenntnis. Marie fühlte sich schwach. Sie hatte gewusst, dass ihr Nachbar ein rücksichtsloser Klotz mit einem Protzauto war, der auf Blumen und Nachbarinnen keine Rücksicht nahm. Aber das hätte sie ihm doch nicht zugetraut. Pierre hatte Recht gehabt. Florian war kein gewöhnlicher Tourist. Er war in die Bretagne gekommen, um Nazi-Bunker zu fotografieren. Und wenn ein Deutscher das tat, und zwar derart begeistert, dann … war Florian selbst ein Nazi?! Dann war er wohl ein Nazi.