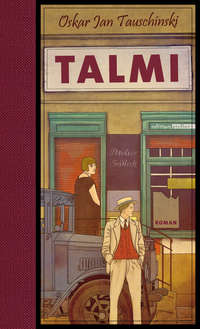Kitabı oku: «Talmi», sayfa 2
Ich hatte im ersten Augenblick also weder Zeit noch Lust, mir Gedanken darüber zu machen, was geschehen war. Erst nach der Ouvertüre, als der Vorhang aufging und die Ensembleszenen in Violettas Heim begannen, gönnte ich mir einen Blick zur Seite. Mein jugendlicher Wohltäter, der während des Vorspiels auf seinem Platz herumgewetzt hatte, saß nun wie hypnotisiert da. Mit seinem Opernglas – einer altmodischen Damenlorgnette aus Elfenbein – fixierte er jeden Auftritt, jede Verbeugung, jeden Handkuß auf der Bühne. Ob er auch die Musik hörte, weiß ich nicht; jedenfalls genoß er die Vorstellung mit allen Sinnen. Sein weiches, stark gelocktes, sehr blondes Haar, das fast wie entfärbt wirkte, fiel ihm ins Gesicht, aber er war von den gesellschaftlichen Ereignissen im Hause der Kameliendame dermaßen in Anspruch genommen, daß er vergaß, es aus der Stirn zu streichen.
Seine linke Hand lag auf der Logenbrüstung dicht vor mir, und ich hatte Muße, sie zu betrachten. Sie war groß, weiß und langfingrig – eigentlich war sie etwas zu schön für eine Männerhand. Dabei hatte sie nichts Vornehmes, Intellektuelles oder seelisch Verfeinertes, wie sie da hell schimmernd auf dem dunklen Plüsch lag. Im Gegenteil, die Vorstellung lag nahe, daß sie flink und sicher zupacken könne. Das breite Gelenk verstärkte diesen Eindruck noch, um so mehr, als die Armbanduhr, die es trug, wiederum klein und für einen Mann fast zu zierlich war.
»Von der Freude Blumenkränzen sei mein Leben heiter durchzogen … Jeder Abend soll mich finden, wo die Lust mich taumelnd umfängt …«, sang Violetta, und ihr energisches, fleischiges Gesicht, das zugleich intelligent und hochmütig war, strafte sie Lügen. Aber wie sollte man aussehen, um solchen Unsinn singend zu rechtfertigen? Stimmlich war die Frau – eine rumänische Gastsängerin mit kompliziertem Doppelnamen – übrigens ganz hervorragend, und der Beifall, den sie nach der Arie erntete, dementsprechend stark.
Als der Applaus einsetzte, lief es wie ein Ruck durch die Gestalt meines jungen Nachbarn, der bis dahin die Sängerin ununterbrochen beobachtet hatte. Mit einem Ausdruck, als wolle er sagen: »Ach ja, natürlich …«, legte er den Operngucker zur Seite und begann selbst geräuschvoll zu klatschen.
In der Pause wandte er sich dann mit überaus liebenswürdigem Lächeln zu mir und sagte:
»Oh, verzeihen Sie, es war sehr, sehr unartig von mir! Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt.« Dabei ergriff er meine Hand mit einer etwas zu familiären Selbstverständlichkeit und küßte sie, indem er einen Namen murmelte, der wie Ronalik oder Ronecek klang. Der Handkuß selbst war ihm jedoch wiederum vollkommen gelungen. Der blonde Kopf hatte sich dabei tief hinabgeneigt, und die Lippen streiften meinen rauhen Handrücken, als gelte der Kuß einem Heiligtum.
Ich sagte: »Sedlak. Sehr angenehm …« und fühlte, daß er meinen Namen ebenfalls nicht auffaßte. Er würde ihn wohl auch nicht verstanden haben, wenn ich ihn buchstabiert hätte, denn sein Blick war wieder zum Stehparterre hinabgeglitten, wobei das linke Auge sich um den Bruchteil einer Sekunde verspätete. Die schlanke Skiläuferin gönnte uns jedoch keinen Blick mehr. Sie schien überhaupt nur noch einen Rücken zu haben.
Der junge Herr neben mir sprach unausgesetzt. Er deutete auf die Logen und nannte die Namen mehrerer Insassen. Es waren wohlbekannte, adelige Namen, mitunter auch die von Großindustriellen, Bankiers und Regierungsmitgliedern. Er schien die Leute alle – wenigstens vom Sehen – zu kennen und sprach von ihnen mit ungezwungener Lässigkeit wie von Gleichgestellten. Was er sagte, war weiter nicht bemerkenswert, nur wie er es tat, beschäftigte mich ein wenig. Es war ausgesprochener Dialekt, dessen er sich bediente, aber in jener verweichlichten, verzärtelten, nasalen Betonung, wie ihn Schauspieler benützen, wenn sie altösterreichische Aristokraten darstellen. Einer ungeschriebenen Bühnenkonvention zufolge schien man in den »höheren Kreisen« so zu reden. Ich konnte damals nicht beurteilen, inwiefern dies den Tatsachen entsprach. Die wenigen Aristokraten, die ich vom Geschäft her flüchtig kannte, bemühten sich alle, möglichst ungezwungen, sportlich und amerikanisch zu wirken, um nicht in den Verdacht zu kommen, mit dem Grafen Bobby der Anekdote verwandt zu sein.
Mein junger Gastgeber war sich dieses Gefahrenmomentes sichtlich nicht bewußt. Seine breitschultrige, knabenhafte und doch schon gedrungene Sportlerfigur wirkte amerikanisch genug. Er konnte also in Gebärde und Sprache ruhig die Merkmale seiner Kaste zur Schau tragen. Denn daß es sich bei ihm um einen Angehörigen der oberen Zehntausend handelte, stand für mich nun schon fest. Auch die wesentlich gröbere rechte Hand, die ich jetzt im vollen Lampenlicht sah, konnte an dieser Meinung nichts mehr ändern. Die beiden abgebrochenen Nägel daran und die tiefen Rillen am Daumen und Zeigefinger, aus denen trotz sorgfältiger Maniküre nicht aller Schmutz zu entfernen gewesen war, deuteten darauf hin, daß der junge Mann wohl ein Motorrad, wenn nicht gar ein Kabriolett sein eigen nannte.
Inzwischen war Traviata wieder zu Wort gekommen. Die robuste Bukaresterin mit den fleischigen Zügen opferte zuerst ihren Schmuck für den Aufwand ihres Alfredo und dann ihre Liebe selbst, um seiner unbekannten Schwester zum Eheglück zu verhelfen. Schließlich war sie, um ihren Schmerz zu betäuben, zu einem »glanzvollen Freudenfest« geeilt und dort von dem übelberatenen Geliebten eine Dirne gescholten worden. Ja, Alfred hatte sich so weit vergessen, ihr das soeben im Kartenspiel gewonnene Geld vor die Füße zu werfen. Was blieb also einer Frau vom Format der Kameliendame übrig, als an Schwindsucht zu sterben?
Die massige Rumänin saß nun in ihrem Lehnsessel. Das große, intellektuelle Gesicht war weiß gepudert, und das rosaseidene Nachtgewand mit den Spitzen paßte schlecht zu ihren lebensvollen und zielbewußten Bewegungen. Es gehörte viel guter Wille dazu, um zu glauben, daß sie der Auszehrung zum Opfer gefallen war. Aber in ihrer Gesangskunst wurde sie dem Part gerecht. Wenn man die Augen schloß und über die verlogenen deutschen Worte hinweg den so ganz wahrhaftigen italienischen Tönen lauschte, dann wußte man um den Schmerz dieses einsamen Sterbens, um den Hoffnungsstrahl beim Anblick des reumütigen Geliebten, um die Euphorie, die dem plötzlichen Tod vorangeht.
Ein leises Zucken neben mir ließ mich die Lider auftun. Da saß mein Nachbar, hielt den Gucker vor die Augen, und während er aufmerksam die Gebärden der dahinsiechenden Traviata verfolgte, liefen ihm Tränen über das Gesicht.
Alles hatte ich eher erwartet als dies. Es würde mich nicht erstaunt haben, wenn er, um so recht up to date zu erscheinen, über die schwindsüchtige Karyatide spöttelnde Bemerkungen gemacht oder, ermüdet von der langen Aufführung, wohlerzogen gegähnt hätte. Aber so unverhohlene Tränen bei einem Sportsmann? – Meine Gefühle waren zwiegeteilt. Einerseits rührte es mich, daß seine junge Seele so beeindruckbar war, daß sie die Gabe hatte, sich hinreißen zu lassen, mitzugehen. Ich mußte ihm doch wohl unrecht getan haben, als ich ihn für oberflächlich und banal hielt. Wenn er das sentimentale Libretto und die vollendet interpretierte Musik nicht genau auseinanderzuhalten wußte, so lag das vielleicht nur an seiner Jugend. Aber anderseits war es auch wieder befremdlich, zu sehen, daß er gar keine Anstalten traf, seiner Rührung Herr zu werden. Auch als der Vorhang fiel und es hell wurde, zog er nicht sein Taschentuch hervor, sondern ließ die letzten Tränen unbekümmert auf seinen Wangen trocknen. Das Weinen hatte ihn auch nicht – wie zu erwarten gewesen – zum Kinde gemacht. Wie er so dastand, heftig applaudierend, wirkte sein Gesicht mit den stark geröteten Augen und den leicht geschwollenen Unterlidern, die zukünftige Tränensäcke ahnen ließen, wie das einer nicht mehr ganz jungen Frau. Übrigens schien er meinen Blick zu fühlen, denn er richtete wieder einmal mit gewandter Bühnenweltmannsgeste das Wort an mich:
»Ich habe vergessen, Ihre Garderobe in der Pause auszulösen und hierher zu bringen. Sind Sie mir böse deswegen?«
Ich stammelte etwas wie »Durchaus nicht!« und »Ich hol’ mir schon meinen Mantel«, aber er wollte nichts davon hören.
»Sie erlauben doch, Gnädigste, daß ich Sie auch heimgeleite, wenn Sie mir schon die Freude Ihrer Gesellschaft gemacht haben«, sagte er, und ehe ich Zeit fand, die romanhafte Unnatürlichkeit dieses Satzes zu erfassen, gingen wir schon über Treppen und Gänge der Stehparterre-Garderobe zu. Im Gehen summte, ja sang mein Begleiter halblaut die Duettmelodie des letzten Aktes, während er in seinen hellen Überzieher schlüpfte.
Bei der Kleiderausgabe herrschte arges Gedränge. Er nahm mir den Nummernzettel aus der Hand und stürzte sich ein wenig zu temperamentvoll in den Menschenknäuel. Ich stand wartend neben dem Spiegel. Jemand gebärdete sich so unbekümmert beim Ankleiden, daß ich einen heftigen Stoß in den Rücken abbekam. Unwillig sah ich mich um. Es war die Marille, die jedoch keine Anstalten traf, sich zu entschuldigen. Der Blick, der dem meinen begegnete, war zu zornig, um so verächtlich auszufallen, wie er gemeint war. Das nützt dir alles nichts, schienen die Augen der jungen Frau zu sagen, du hast ja doch einen Bukkel! – Dumme Gans, mußte ich meinerseits denken. Selten hat mir mein Buckel so gute Dienste geleistet. Wie müde wäre ich jetzt, hätte ich wie sonst drei Stunden lang auf den Zehenspitzen stehen müssen, um über so gerade Schultern wie die deinen hinwegzusehen!
Aber da kam man schon mit meinem Mantel. Die Marille wandte sich brüsk ab und ging, während die Augen meines jungen Schutzherrn ihr nun mit deutlichem Triumph folgten, wobei auch jetzt das linke sich um den Bruchteil einer Sekunde hinter dem rechten verspätete.
WER BIST DU?
(Susannens Aufzeichnungen vom 13. März 1945)
Ich bin gestern nicht weit mit meiner Schreiberei gekommen. Immer wieder versinkt man in Gedanken und ertappt sich dann nach einer Viertelstunde dabei, daß man tatenlos vor seinem Schreibblock sitzt. Schließlich war ich so müde, daß ich alles liegen ließ und schlafen ging. – Und doch habe ich kaum die Hälfte meiner ersten Begegnung mit Ernstl zu Papier gebracht! Also weiter, weiter, keine Zeit verlieren!
Auf der Gasse war es empfindlich kalt – nicht anders als jetzt, da ich dies alles niederschreibe. Aber der Ring war von Bogenlampen erleuchtet und nicht von Bränden. Die Fenster der Kaffeehäuser und Geschäfte strahlten. In vielen Wohnungen brannte Licht … Heute kann ich es kaum glauben, daß dies einst selbstverständlich war.
Übrigens muß ich morgen mit Margot in den Keller hinunter, um nachzusehen, ob wir dort nicht Notbetten aufschlagen können; vielleicht die Polsterbank aus dem Vorzimmer, die ist nicht so schwer zu tragen, und das alte Feldbett, aber das muß ich noch ausbessern. Es wird Zeit, an den Keller als Lebensraum zu denken. Da wird die Petroleumlampe erst ihre Triumphe feiern! – In solchen »irdischen« Belangen ist Margot nicht mit Gold aufzuwiegen. Es war doch gut, daß ich sie zu mir genommen habe, als sie sich mit der alten Blaschka überwarf, obwohl ich es weiß Gott nicht leichten Herzens tat. Dieses Geplapper mit norddeutschem Akzent den ganzen Tag zu ertragen – zuerst im Geschäft und dann abends wieder – ist ein bißchen viel. Aber schließlich ist sie ein armer Teufel, und außerdem … hat sie dich, Ernstl, gekannt. Grund genug, sich ihrer anzunehmen. Vielleicht ist es überhaupt gut, daß ich jetzt nicht allein bin. Es wäre trostlos, hätte man in der heutigen Zeit nur an sich selbst zu denken.
Am schlimmsten wird es mit Lebensmitteln sein. Wir haben gar keine Reserven. Ich wüßte auch keinen Menschen, der uns einen Schleichhändler empfehlen könnte. – Außer Berti. Berti kennt sicher solche Leute. Aber der findet ja, die Zukunft solle für sich selber sorgen, es gebe genug Menschen, die jetzt schon hungern, und es sei nicht der Augenblick, an Kommendes zu denken, wenn man gleich helfen muß.
Übrigens hat sich Berti lange nicht blicken lassen. Seit der Aktion für die ungarischen Juden habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ob damals wohl alles glatt abgelaufen ist? Wenn er nur aus Klugheit nicht kommt, so soll es mir recht sein. Ich habe jetzt immer das Gefühl, beobachtet zu werden, und was ihn betrifft, so ist gar nicht daran zu zweifeln, daß man ihn bespitzelt. Hoffentlich liegt kein ernsterer Grund für sein Fernbleiben vor. Diese Pfadfindernaturen, die meinen, jeden Tag etwas Edles tun zu müssen, geben immer neuen Stoff zur Beunruhigung. Manchmal glaubt man schon zu wissen, was in ihnen vorgeht, und dann steht man wieder vor einem Rätsel. Was riskiert Berti nicht täglich für die anderen! Und dabei liebt er die Menschen durchaus nicht. Im Gegenteil, er verachtet sie. Eigentlich hat er ja auch dich verachtet, Ernstl. Und doch kann ich ihm deswegen nicht zürnen, denn erstens hatte er recht, und zweitens hat ihn die Kenntnis deiner Schwächen nicht gehindert, dein Freund zu sein. – Oder nennt man so etwas nicht Freundschaft?
Ich bin vom Thema abgekommen und doch wieder nicht, denn alle Umwege führen zu dir. Margot und Berti – sie gehören ja auch mittelbar zu deinem Vermächtnis wie meine eigenen Erinnerungen an dich.
Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, also wir gingen den Ring entlang bis zur Bellaria. Dort gedachte ich in den 49er einzusteigen, um meinen Beschützer auf taktvolle Weise loszuwerden. Ich hüllte mich warm in meinen neuen Wollmantel, den ich mir nach langem Sparen und Rechnen erst gegen Ende des Winters beim Räumungsverkauf erstanden hatte. Ein Blick zur Seite genügte mir, um festzustellen, daß meines Begleiters Mantel – ein heller, nicht ganz sauberer Trenchcoat – für die Jahreszeit zu leicht und überdies etwas schadhaft war. Das bildete einen merkwürdigen Widerspruch zu der tadellosen Paßform seines schwarzen Sakkos und der graugestreiften Hose.
Wahrscheinlich wohnte der junge Mann allein in Wien und ging hier seinen Studien nach. Vielleicht war er der Sohn eines Gutsbesitzers oder eines in der Provinz lebenden Industriellen. Jedenfalls schien sich hier niemand um ihn zu kümmern. Man ließ ihm freie Hand in der Dosierung der bequemen Lebensgewohnheiten eines Studenten innerhalb der selbstverständlichen Ansprüche eines Jünglings aus reichem Haus.
Worüber sprachen wir? Natürlich über Traviata. Der junge Mann fand alles herrlich: die Aufführung, die Sänger, die Oper. Sein Enthusiasmus freute mich. Anscheinend hafteten dem Sprecher weder die Blasiertheit noch das Banausentum an, für die junge Leute aus begüterten Kreisen so anfällig sind.
Ich beeilte mich daher, ihn in seiner günstigen Meinung zu bestärken. Das fiel mir nicht schwer, da ja die Aufführung besonders geglückt gewesen war. Nur bezüglich des Librettos erlaubte ich mir einige Bedenken, indem ich sagte, man könne es heutzutage kaum noch begreifen, daß gesellschaftliche Vorurteile solcher Art zum Trennungsgrund für Liebende werden konnten.
Der junge Mann sah mich erstaunt an.
»Wieso?« fragte er. »Aber bedenken Sie doch, Alfred ist ein Baron, und sie, die Violetta … Er muß doch Rücksicht nehmen auf seine Familie, auf die Schwester, den Vater. Oh, ich kann mich am besten in den Vater hineindenken. Das ist ein wirklicher Gentleman. Aber ich wäre wohl noch strenger zu meinem Sohn.«
War es taktlos von mir gewesen, dies Thema zu berühren? Nun, wenn ja, dann war es doch auch ein wenig unfein und anmaßlich von ihm, seinen Klassendünkel mir gegenüber, die er doch unmöglich für eine Gleichgestellte halten konnte, so zu betonen. Jedenfalls war ich nun nicht gewillt, meinen Standpunkt aufzugeben.
»Da hätten Sie unrecht«, sagte ich, »und bis Sie einmal Ihrem Sohn gegenüber in eine solche Lage kommen, werden Sie Ihre Meinung sicherlich noch revidiert haben. In Ihren Jahren laufen Sie übrigens weit eher Gefahr, die Rolle Alfreds zu spielen.«
Ich konnte mir den strengen Ton erlauben, vor allem weil ich älter war, dann aber auch meines Buckels wegen, der mich von vornherein von jeder subjektiven Anteilnahme ausschaltete.
Er sah mich einen Augenblick an, ehe er antwortete: »Ich hab ja gar keinen Vater … Das heißt, ich hab längst keinen mehr!« setzte er überstürzt hinzu, als bedürfe der erste Teil seines Satzes einer Erläuterung.
Ich ließ nicht locker. »Was würden Sie dazu sagen, wenn man Ihnen einfach die Zukunft zerstörte, um Ihrer Schwester zu einem sehr zweifelhaften Eheglück zu verhelfen?«
»Meine Schwester?« verwunderte er sich. »Die kriegt bestimmt keinen Mann mehr … Wer redet von uns? Aber in diesen Kreisen hat man doch etwas Höheres, wofür man sich einsetzen muß, als Liebe …«
In diesen Kreisen? dachte ich. Das klingt nicht so, als ob er dazugehörte. Sollte ich mich getäuscht haben?
Aber warum verteidigt er dann den Standpunkt dieser Kreise?
»Ich wüßte nichts Höheres als die Liebe«, sagte ich streng und fühlte, daß meine Worte abgeschmackt und biedermännisch klangen. Dem jungen Mann schien das nicht aufgefallen zu sein. Er war durch meine Unerschütterlichkeit ins Wanken gekommen.
»Vielleicht haben Sie recht. Aber schauen Sie, es gibt doch auch andere Rücksichten … gesellschaftliche, meine ich. Ein guter Name, ein Stammbaum … solche Dinge verpflichten doch.«
»Zu Hartherzigkeit und Intoleranz darf eben nichts verpflichten. Wenn Ihre ›höheren Kreise‹ tatsächlich die höheren sind, so haben sie vor allem die Pflicht zu einer betont humanen Haltung. Nur so können sie heutzutage ihre Überlegenheit beweisen – wenn überhaupt von einer solchen die Rede sein kann!« Ich hörte meine Worte ledern und trocken durch die Bellariastraße gellen (denn ich war natürlich nicht in den 49er eingestiegen). Sie klangen unwahr und propagandistisch wie die eines Politikers, und ich wunderte mich selbst über meine Leitartikelberedsamkeit, die ich bisher nie an mir festgestellt hatte. Im Grunde lag mir kein Thema ferner als die Pflichten und Rechte der Aristokratie. Sichtlich hatte ich mich in diesen lehrhaften Ton nur geflüchtet, um den eigenartigen Konservatismus des jungen Mannes zu bekämpfen. Nun war ich schon sicher, daß er selbst kein Aristokrat sein konnte. Wo sollte man ihn also einreihen? Vielleicht war er der Sprößling einer ärarischen Familie, die in k. u. k. Erinnerungen und in Reminiszenzen aus der Backhendelzeit plätscherte und dem Sohn gar nichts anderes mitgegeben hatte als diesen ranzigen »Grafenkrampf«. Ja, nur so konnte es sein.
Gar nichts anderes – ist vielleicht zu streng gesagt. Gute Manieren und Anstand hatte man ihm zu Hause jedenfalls auch beigebracht, denn was sonst hätte ihn bewegen können, den freien Platz einem Krüppel anzubieten, anstatt die Gelegenheit wahrzunehmen, mit dieser jungen, hübschen Person bekannt zu werden?
»Übrigens scheint mir«, begann ich nun in viel freundlicherem Ton, »daß ich mich gar nicht genug für Ihre große Liebenswürdigkeit bedankt habe. Es war wirklich sehr nett von Ihnen, mich in die Loge zu laden.«
»Ach, nicht der Rede wert …«
»O doch, doch. Ich war ja schließlich nicht die einzige im Saal, die stehen mußte, und Sie hätten sich mühelos eine erfreulichere Abendgesellschaft verschaffen können.«
»Sie meinen die Blonde, neben Ihnen? Die kenn’ ich eh vom Sehen. Verkäuferin bei Meinl ist sie. Ich hab sie nur so angeschaut, weil ich sie zuerst gar net erkannt hab … so braungebrannt, wie die jetzt ist.«
Das Wort »Verkäuferin« hatte wieder recht verächtlich geklungen, so daß der Protest aufs neue in mir erwachte.
»Wenn Sie glauben, daß ich mehr bin, so irren Sie. Ich bin Manipulantin in einem Damenkonfektionshaus, und als ich so jung war wie das blonde Fräulein, habe ich auch Kunden bedienen müssen!«
So jung wie die! – Ich war selber damals erst fünfundzwanzig, aber in meiner Körperverfassung kommt man ja schon als alte Frau zur Welt.
Der junge Mann zeigte leises Erstaunen, das ich als Enttäuschung auslegte.
»Komisch«, sagte er, »Manipulantin sind Sie? Und ich hätte Sie für eine Künstlerin gehalten. Ich weiß nicht warum, aber ich war sicher, Sie sind eine Malerin oder so etwas …«
Mir wurde plötzlich warm ums Herz. Niemand hatte je eine Begabung in mir gesucht. Es war bekannt, daß ich Abendkurse für Aktzeichnen an der Akademie besuchte. Manche wußten sogar, daß ich bei Aglaia Privatstunden nahm. Aber man hielt dies bei einer hoffnungslos zum Altjungferndasein Verurteilten für den begreiflichen Wunsch nach Kompensation. Nicht einmal Aglaia, die Bewunderte, Große, machte mir viel Hoffnungen. »Ich weiß nicht recht, was mit dir los ist, Suse«, pflegte sie zu sagen. »Es steckt was in dir, das sieht ein Blinder. Aber die Bildhauerei ist eine zu harte Disziplin für dich, zu streng, zu groß. Dir liegt das Dekorative mehr als das Plastische. Irgendwie sitzt dir bei der Arbeit die Manipulantin im Genick.« – Das war nicht gerade aufmunternd, und es gehörte viel Zähigkeit und Willensaufwand dazu, um nach so zweifelhaftem Lob: »Es steckt was in dir …« weiterzuarbeiten. Und gar der Professor beim Aktzeichnen, der packte mich noch rauher an. »Sö san mir die Richtige! Da schaun S’ her: die Rückenlinie da, die siecht aus, als wann s’ von einer Maus aus’bissen wär’. So g’hört ’s und so und so … Segen S’, ein Akt, dös san fünf bis zehn Linien. Alles, was drüber geht, haaßt nix! Der Busen, den S’ da g’malen haben, der is ja barock …!«
Barock war ein Ausdruck tiefster Verachtung in der Sprache des Professors.
Was konnte ich dafür? Unter meinen Händen wurde eben alles barock.
Und nun hatte ein Unbefangener, Fremder mich für eine Künstlerin gehalten! Dabei wußte der eitle junge Bursche da neben mir bestimmt gar nicht, wie froh und zuversichtlich mich sein Irrtum machte.
»… ich sehe Sie direkt in einem weißen, etwas fleckigen Kittel in einem Atelier stehen«, beendete er seinen Satz.
»So leicht kann man irren. Jetzt sind Sie wohl sehr enttäuscht, was?«
»Oh, nein …«
Die zögernde Antwort brachte mich wieder in Harnisch.
»›Oh, nein‹ heißt ›ja‹! Sie hätten eben doch Ihren natürlichen, jugendlichen Wünschen folgen sollen und die hübsche Verkäuferin in die Loge laden; stattdessen …« Ich wollte fortsetzen: ›… haben Sie sich von Ihrem Snobismus verleiten lassen und sind erst recht fehlgegangen.‹ Aber ich hielt rechtzeitig inne und sagte mit komischer Übertreibung: »… haben Sie Philanthropie walten lassen und eine Bresthafte begönnert.«
Er sah mich verwundert an und blieb stehen.
»Philanthropie – was ist das?«
Nun war es an mir, zu staunen. Hatte man in dem ärarischen Elternhaus keine Fremdwörter benützt? Und warum nicht? Aus Unbildung – oder vielleicht aus Deutschtümelei?
»Menschenfreundlichkeit, Menschenliebe, Nächstenliebe«, erläuterte ich etwas beschämt über die Lehrerinnenrolle, die mir da zufiel.
»Wie merkwürdig Sie sich ausdrücken«, meinte er. »Philanthropie – eine Bresthafte begönnert … Nein, ich bin nicht enttäuscht, o nein, gar nicht! Ich hab ja so viel gelernt.«
»Gelernt?«
»Ja. Ich weiß jetzt, was eine Arie und ein Duett ist, daß die Musik, ehe der Vorhang aufgeht, Ouvertüre heißt und der Text, den die Künstler singen, Libretto – oder hab ich etwas falsch gesagt?« fragte er, als er die Verblüffung in meinen Augen las. »Ich habe auf jedes Wort aufgepaßt, das Sie in der Pause fallen ließen. Ach, man kennt ja viele Ausdrücke vom Hören und Lesen und ist nicht so ganz sicher, was sie bedeuten. Sie müssen wissen …«, er stockte verlegen, »… ich bin heute zum ersten Mal in der Oper gewesen.«
»Aber gehen Sie …«, sagte ich, denn ich wußte wirklich nicht, was ich erwidern sollte; auch waren wir inzwischen vor meinem Haustor angelangt.
»Ich bin nämlich …« Er setzte den begonnenen Satz nicht fort, aber es war mir, als bereitete es ihm Mühe, die unausgesprochenen Worte bei sich zu behalten. Seine Blikke vollführten einen raschen Kreislauf, als glaubte er sich beobachtet. Dabei hatte sich das linke Auge wieder ein wenig träger als das rechte verhalten. Dann sagte er: »Und auch was Philanthropie heißt, weiß ich jetzt. Nur das mit der Haltung, zu der die Adeligen verpflichtet sind, habe ich nicht ganz verstanden.«
»Nun, das kommt schon noch«, sagte ich belustigt. »Übrigens habe ich von humaner Haltung gesprochen.«
Man sah es ihm an, daß er gern gefragt hätte, was das bedeutet, aber es fehlte ihm an Mut.
»Ich wohne hier«, fuhr ich fort, »es war sehr lieb von Ihnen, mich nach Hause zu begleiten. Ich danke Ihnen.«
»Schade«, sagte er, »ich hätte Sie gern bis Hütteldorf gebracht, um mit Ihnen reden zu können. Sie sind so interessant.«
Auch das hat noch niemand gefunden, dachte ich, aber ich sagte nur: »Sie machen mir Komplimente. Leben Sie wohl!« Und ich streckte ihm meine Hand entgegen.
Wieder erfolgte der vollendete Tanzstundenhandkuß. Zuerst neigte sich der hübsche Kopf im Stierkalbnacken, und dann beugten sich die breiten Sportlerschultern tief über meine Hand. Wieder berührten die Lippen so sacht meine Haut, als gelte der Kuß einer Reliquie. Dabei fiel das etwas zu lange und zu blonde Haar nach vorn und streifte kitzelnd mein Handgelenk.
Als ich eine Minute später in meinem Zimmer stand, fühlte ich mich plötzlich so schläfrig, daß ich, ohne etwas zu essen, zu Bett ging. Ich löschte das Licht und meinte, ich könnte mir ja im Dunkeln den ganzen heutigen Abend und namentlich die merkwürdige Bekanntschaft durch den Kopf gehen lassen. Aber ich schlief sofort ein und erwachte erst beim Schrillen des Weckers.
Aufstehen, waschen, anziehen, aufräumen, Frühstück – der alltägliche Leerlauf, dem nur die Eile ein wenig Gehalt verlieh. Erst in der Straßenbahn, als ich ins Geschäft fuhr, fiel mir der junge Mann in aller Deutlichkeit ein. Das merkwürdige Mißverhältnis zwischen seinen gepflegten Umgangsformen und seiner offensichtlichen Ignoranz schien mir heute noch verwirrender als gestern. Aber soviel ich darüber in den nächsten Tagen auch nachgrübelte, ich fand keine Erklärung. Und die Episode, die sich vierzehn Tage später ereignete, war nicht gerade dazu angetan, das Rätsel zu lösen.
Es war an einem sehr sonnigen Frühlingsmorgen. Ich trat gerade aus dem Laden meiner Milchhändlerin, bei der ich Brot, Semmeln und Rahm gekauft hatte, und wollte die Tasche daheim abstellen, ehe ich ins Geschäft fuhr.
Vor dem Laden hielt das Lieferauto der Anker-Brotfabrik. Die Tür des Packraums stand offen, und ein Mann war damit beschäftigt, die leeren Semmelkörbe im Inneren zu verstauen. Da sprang der Chauffeur aus dem Wagen und kam mit einem sehr nasal betonten: »Ich küß die Hand, Gnädigste!« auf mich zu.
Es dauerte eine Sekunde, bis ich wußte, wer vor mir stand. Ich streckte wortlos die Hand aus und genoß mit einer Rührung, die mich selber befremdete, den Anblick der Handkußprozedur, die sich nun in allen Phasen wiederholte. Ich spürte die zärtliche Berührung der Lippen und die kitzelnde der allzu blonden, allzu langen Haare. Aber ehe ich etwas sagen konnte, war der Alte hinten mit seinen Semmelkörben fertig und rief etwas in unartikulierten Lauten, die sich kaum die Mühe nahmen, Worten zu ähneln. Der junge Mann warf den Kopf ärgerlich herum, wandte sich aber gleich mit entschuldigendem Lächeln an mich.
»Sie müssen mir verzeihen; das ist halt mein Dienst.«
Er sprang ins Auto. Der andere kletterte brummend hinterdrein und schlug die Tür zu. Ich sah noch, wie sich die schöne linke Hand des Chauffeurs mit der allzu kleinen Armbanduhr zu einem winkenden Gruß vom Lenkrad hob, dann fuhr das Auto davon.
Und wie du zu den Logensitzen gekommen bist, Ernstl, das habe ich erst viel später erfahren.