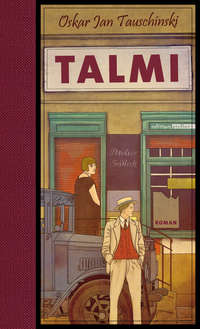Kitabı oku: «Talmi», sayfa 5
»Oh, ja, natürlich, gewiß. Aber jetzt muß ich gehen, Baronin«, sagte ich, denn ich wußte mich am Ende meiner Kräfte.
»Ich gehe mit Ihnen. Für mich ist es nämlich Zeit zur Abendandacht. Ich fühle mich nirgends so sicher wie in der Kirche. Und dann … Sie werden mich verstehen: Man hat heutzutage so sehr das Bedürfnis, für die vielen Unglücklichen zu beten, die es jetzt überall gibt … Also, ich werde meiner Freundin sagen, daß sie sich noch ein wenig gedulden muß«, schloß sie. »Ist es Ihnen recht, Frau Sedlak?«
Freundin! dachte ich. So sehen die Freundinnen aus! Deine Vilma läßt ihr Kind von dir aus der Taufe heben, aber darüber hinaus vertraut sie dir nichts an, sonst wüßtest du … Oder weißt du vielleicht? – Nein! Das hat dir deine Freundin gewiß nicht erzählt. Du ahnst nicht, welche Hilfslakaienrolle dein Hilfslakai in ihrem Leben gespielt hat. Anscheinend wart ihr nicht immer so intim wie jetzt.
»Ja, bitte«, sagte ich müde. »Bereiten Sie Frau Müller darauf vor, daß es noch einige Zeit dauern wird.«
Wir gingen durch die Zimmer der Untermieterinnen. Die Kinder schliefen bereits. Die junge Witwe saß da, mit gesenktem Kopf und aufgestützten Ellbogen, die Hände ins Haar gewühlt. Die Hofrätin wandte uns den Rücken, als bemerke sie uns gar nicht. Auch unseren Gruß überhörte sie.
Ich tappte durch die völlig verdunkelten Straßen nach Hause.
Du frittatenfressendes Kerzlweib! dachte ich grimmig, du Betfunsen, du bigottes Rabenvieh! – Heiliger Martin, laß die Kirche einstürzen über diesem Weibsbild!
DIE GROSSE WELT IM TRIESTINGTAL
»Aber, aber, Frau Susanne! Wieso denn plötzlich solch eine Zornaufwallung? Das paßt doch gar nicht zu Ihrem sonst so maßvollen Wesen! Noch dazu richtet sich Ihr Groll gegen eine Frau, die Ihnen jedenfalls nichts getan hat!«
So oder ähnlich müßte man Frau Sedlak auf diesen unbeherrschten Ausbruch erwidern, wenn sie geneigt wäre, uns ihr Ohr zu leihen. Aber sie will ja ihr eigenes Buch nicht lesen. – Wir sind bis zu diesem Punkt mit Anteilnahme ihren Aufzeichnungen gefolgt, was nicht besagen will, daß wir uns mit der Erzählerin immer und unbedingt solidarisch fühlten, denn wir vertreten hier die Interessen der Objektivität, während es Susanne anscheinend unmöglich ist, sachlich zu bleiben. Die Regierung in diesem Buch wollen wir ihr neidlos überlassen, aber wir bestehen auf unseren demokratischen Rechten und sind jederzeit geneigt, Kritik an ihr zu üben oder gar in Opposition zu treten. Gerade jetzt scheint es uns, als hätten wir sie lange genug walten lassen und als sei der Augenblick gekommen, einige Berichtigungen einzustreuen.
Vor allem ist sich die gute Susanne wohl nicht im klaren darüber, daß sie mit der zu Beginn geäußerten Behauptung, Ernstl nie geliebt zu haben, weit von der Wahrheit abgerückt ist. Merkwürdig. Eine so kluge und scharfsichtige Person tappt in bezug auf sich selbst dermaßen im Dunkeln! Meint sie denn, eine Beziehung müsse so aussehen wie in »Romeo und Julia«, um den Namen Liebe zu verdienen? Weiß sie denn nicht, daß auch solche menschlichen Bande, die sich durchaus nicht den Anschein geben, leidenschaftsbetont zu sein, oft verkleidete Liebesbeziehungen sind? Aber in Susannens Fall kann von einer Maskerade kaum noch die Rede sein. Allzu durchsichtig wirkt schon jetzt das Inkognito. Es gehört wahrlich ein gerütteltes Maß von Verblendung dazu, um einen so eindeutigen Krankheitsfall nicht an seinen Symptomen zu erkennen. – Heute, nach den jahrelangen Erfahrungen ihrer glücklichen Ehe, wäre sie gewiß hellsichtiger für die Tatsache, daß der liebenswürdige Mister Hopkins nicht ihre erste, sondern ihre zweite Liebe ist.
Hätten wir die Erzählerin nicht schon früher durchschaut, so wären uns bei ihren harten und ungerechten Worten gegen Mausi die Augen aufgegangen.
Susanne erwähnt die Sperl in ihrem Tagebuch nicht mehr. Sie ist »fertig« mit ihr. Wir aber können Mausis Jugendsünde mit dem hübschen kleinen Bauernburschen aus Berndorf nicht in so gehässigem Licht sehen, wie es die Erzählerin tut. Wäre Mausi nicht gewesen, so hätte Ernstl mit irgendeiner anderen Berndorferin den Schritt aus der Kindheit in die Jugend gesetzt. Daß es sich dabei um eine Angehörige der »gehobenen Stände« handelte, war allerdings ungünstig für ihn. Denn darin hat Susanne recht: in den ersten Erlebnissen eines jungen Burschen liegt sehr viel schicksalbestimmende Substanz. Und Ernstls gesellschaftlicher Snobismus hat hier in früher Jugend einen verhängnisvollen Nährboden gefunden.
Wie sollte der einfache Bursche sich seinen Mißerfolg erklären? Für ihn sah die Sache so aus, daß er sich eben nicht als fein und zivilisiert genug erwiesen hatte und daher nach bürgerlicher Auffassung nicht würdig war, der kleinen Baronesse gegenüber als gleichberechtigt aufzutreten. Ein Fehlschluß, der im selben Augenblick folgenschwer zu werden begann, als Ernstl sich vornahm, den Ansprüchen der »vollkommenen Gentlemen« gerecht zu werden und nicht nur denen ihrer frühreifen Töchter.
Es ist aber schwer zu glauben, daß dies Erlebnis in dem Sechzehnjährigen eine ganz neue, bisher nicht vorhandene Eigenschaft geweckt hat. Mit sechzehn ist man kein unbeschriebenes Blatt mehr, und die Eindrücke, die unserem Dasein Richtung geben, stammen größtenteils aus viel früheren Entwicklungsjahren.
Hier liegt eigentlich der Hauptvorwurf, den wir der liebevollen Berichterstatterin machen müssen, nämlich: die Kindheit und Jugend ihres Helden so ganz außer acht gelassen zu haben. Die Tatsache, daß sie persönlich daran nicht teilgenommen hat, kann sie nicht entschuldigen. Sicherlich hat Ernst ihr von seiner Jugend erzählt, denn wir werden noch erfahren, daß er ihr später recht viel – möglicherweise zu viel – anvertraute. Und selbst wenn er gerade in diesem Punkt zurückhaltend gewesen sein sollte, so hätte die Kluge und herzlich Interessierte nach der Frühzeit seines Daseins fragen müssen.
In Susannens Manuskript steht kein Wort über Ernstls Berndorfer Tage. Sicherlich hat die Erzählerin vergessen, darüber zu schreiben. Aber daß sie es vergessen konnte, ist bezeichnend. Wir wissen auch warum: aus Liebe! Genauer gesagt: aus einer Verkleidung der Liebe, nämlich aus Eifersucht, und zwar nicht bloß auf Mausi, sondern überhaupt auf alles, was Ernstl erlebt hat, ehe er Frau Sedlaks Bekanntschaft machte. Aber wenn wir Ernstl wirklich verstehen wollen, so müssen wir ihren Fehler wiedergutmachen und das von ihr »Vergessene« nachholen. In dieser Hinsicht habe ich nichts unversucht gelassen.
Ich bin nach Berndorf gereist und habe mich nach einem ehemaligen Bewohner des Ortes, Herrn Ernst Ronasek, erkundigt. Auf dem polizeilichen Meldeamt war nicht mehr zu erfahren, als daß ein solcher tatsächlich im Juni 1905 »hierorts« geboren, bis zum September des Jahres 1921 im Hause seiner Mutter Katharina Ronasek gemeldet gewesen und dann nach Wien verzogen sei. Von den fünf älteren Geschwistern lebte keines mehr in Berndorf, und die Mutter war 1946 im Altersheim der Gemeinde gestorben.
Ich dankte für die Auskunft und ging mir das Haus ansehen, in dem Ernstl seine Kindheit verbracht hat. Es ist ein unscheinbares Parterrehäuschen am äußersten Ende des Ortes und unterscheidet sich von einer Hütte nur durch die heute schon halbverfallene Holzveranda, deren reichliche Verzierung wie vergröberte Laubsägearbeit aussieht. Vielleicht hat das Haus zu Lebzeiten der Katharina Ronasek ein wenig freundlicher gewirkt. Ich kann mir denken, daß dort einige Dahlien und Rudbeckien im Garten standen und daß die Veranda von einem alten Weinstock umrankt war, der inzwischen eingegangen ist.
In Berndorf selbst, einer lieblich ins Tal gebetteten, aber nicht gerade originellen Ortschaft, springen sogar dem unaufmerksamen Beobachter zwei Dinge in die Augen. Das eine ist das gewaltige Metallwerk, weitab vom Marktflekken gelegen, mit seinen Hallen und Schuppen und Schloten, eine großzügige Fabrikanlage, in der die weltberühmten Berndorfer Metallwaren aus imitiertem Silber, dem sogenannten Berndorfer Silber, hergestellt werden. Die zweite Sehenswürdigkeit des Ortes ist das Theater. Ein aufdringlicher Bau aus den Gründerjahren – halb Ritterschloß, halb Steinbaukasten –, der unter den ländlich freundlichen Gebäuden des Städtchens dasteht wie ein Dromedar unter Rehen.
Die Industrieanlage ist ein Wahrzeichen unserer Zivilisation, und jeder, der nicht als Reaktionär verschrien sein möchte, wird einsehen, daß die verträumten Täler des Alpenostrandes nicht für alle Zeit verträumt bleiben konnten und der Technik den ihr gebührenden Platz einräumen mußten. Aber ein solches Theater im Triestingtal? Nein, das geht zu weit und erweckt die völlig verfehlte Vorstellung, als lebten wir in einer kunstsinnigen, für Kultur aufgeschlossenen Epoche! Der Bauherr dieses durchaus ortsfremden Musentempels war niemand anderer als der Besitzer des Metallwerks. Das Haus wurde zu Ehren Franz Josefs I. – anläßlich eines Jagdbesuches des Monarchen – errichtet und sollte dem Landesvater durch die Blume sagen: »Siehst du, was du in deinem Burgtheater kannst, das können wir Industriemagnaten in unseren Residenzen auch. Nicht nur ihr alten Despotengeschlechter habt ein Herz für die Kunst!« – So ungefähr war die Sprache dieses Bauwerkes zu verstehen, das sich niemals in seiner Umgebung akklimatisiert hat und auch heute noch, wo es längst zum Kino herabgesunken ist, seine Giebel und Söller dem peinlich berührten Beschauer störrisch und aggressiv entgegenstreckt.
Hier in Berndorf ist Ernstl Ronasek als ein Postumus – fast ein halbes Jahr nach seines Vaters Hinscheiden – zur Welt gekommen. Von ihm erhielt der Knabe nichts außer dem Namen, und auch den zu Unrecht, denn Herr Ronasek senior war das Opfer eines Betriebsunfalls im Metallwerk gewesen. Eine stürzende Lore hatte ihm den Unterleib und die Schenkel zerquetscht. Der Unglückliche hatte das letzte Jahr seines Erdendaseins unter dauernden Schmerzen im Ortsspital, zwischen Tod und Leben schwankend, verbracht.
Frau Ronasek war nach dem Unfall ihres Mannes genötigt gewesen, die Stellung einer Aushilfsköchin im Haus des Industriegewaltigen anzunehmen. Wir kennen das verballhornte Sprichwort »Gelegenheit macht Liebe«. Aber Gelegenheit macht zuweilen auch Babies, wenn von Liebe weit und breit nicht die Rede sein kann. Ernstls vier Brüder waren damals alle schon über die Pubertät hinaus, und die älteste Schwester mochte sogar schon in den Zwanzig stehen. Alle fünf Kinder hatten mit merklichem Unwillen die Veränderungen an dem Körper der Mutter beobachtet und dem neuen Ankömmling in der Familie von vornherein keinen herzlichen Empfang bereitet. Denn Ernstl war der Sohn eines jungen Lakaien. Von ihm erbte er das weißblonde Haar und den energischen Nacken – vielleicht auch das schmerzliche Verständnis für Klassenunterschiede und die Anlage zu guten Umgangsformen.
Persönlich kannte er keinen seiner Väter, weder den nominellen noch den natürlichen. Dafür hatte die gütig ausgleichende Natur ihm zwei Mütter beschert: die eigentliche und die bereits genannte ältere Schwester Theresia. Schlecht unterrichtete Berndorfer Klatschweiber wollten wahrhaben, daß Theresia die wirkliche Mutter sei und daß Frau Ronasek, die bereits nicht mehr so recht in Frage zu kommen schien, nur eingesprungen war, um der unverheirateten Tochter die Schande zu ersparen. Wir wissen es besser, doch verstehen wir, daß ein solches Gerücht aufkommen konnte und Nährboden fand, denn die Schwester war zu dem kleinen, dicklichen Knäblein zärtlicher und liebevoller als die alte, vergrämte und überbürdete Frau. Dieser Resi hat es Ernstl zu danken, daß seine Kindheit auch daheim ein wenig Wärme und Gemütlichkeit kennenlernte, gerade so viel, wie nötig ist, um ein gesundes und freundlich veranlagtes Kind bei guter Laune zu erhalten. Im allgemeinen war der Kleine allerdings sich selbst überlassen, denn seine Geschwister – sofern sie noch daheim lebten – waren tagsüber in der Fabrik, und auch die Mutter arbeitete außer Haus.
Was tat der Junge den ganzen lieben Tag?
Dasselbe, was wohl die meisten kleinen Berndorfer auch heute noch tun. Er lief brüllend über die Felder und Wiesen, schlug mit einem derben Stecken auf Ameisenhaufen ein, warf mit Steinen – teils nur so in die Luft, teils auch auf Spatzen und Frösche zielend. Daneben sammelte er Pilze und Beeren für andere und bunte Glasscherben sowie Kieselsteine für sich selbst, weidete die dürre Kuh eines Nachbarn und erntete das Obst im Garten eines anderen (wobei gesagt werden muß, daß letzteres nicht immer auf des Anrainers ausdrückliches Geheiß geschah). Überdies ging er natürlich in die Schule, jenes zweite Kulturdenkmal, das sich der Industriemagnat gesetzt hatte. Ein sehr bemerkenswertes Gebäude, in welchem jedes Klassenzimmer im Stil einer anderen Kunstepoche ausgestattet ist! Die Kinder werden hier nicht aus der ersten in die zweite Schulstufe versetzt, sondern aus Ägypten nach Hellas und gelangen von dort weiter in die Gotik und in die Renaissance. Das ist äußerst sinnvoll erdacht! – Aber sei es nun, daß Ernstl damals noch kein Gespür für Historizismus hatte oder daß er alle Kraft in den natürlichen Widerstand gegen seine Lehrer setzte – er nahm aus diesem hochpädagogischen Institut ebensowenig mit wie der Durchschnitt seiner Kameraden und vergaß das Gelernte ebenso schnell wie diese.
Die meisten Eindrücke seiner unbesonderen, dörflichen Kindheit fielen ins Unterbewußte, dorthin, wo sie den Humus aller menschlichen Erfahrung bilden, wo sie in Vernunft und Intelligenz, in Vorliebe und Abneigung, in Impuls und Hemmung umgesetzt werden, und zwar so völlig umgesetzt, daß sie ihren ursprünglichen Charakter von persönlichen Kindheitseindrücken gänzlich verlieren.
Freilich nicht alle Erlebnisse des kleinen Ronasek sanken so tief. Manche verblieben knapp unter der Oberfläche seines Denkens und Wollens und beeinflußten sie mehr, als er selbst ahnen konnte. Und einige dieser Abenteuer greife ich heraus.
Einmal – er mochte damals vielleicht fünf Jahre alt sein – beschloß Ernstl unaufgefordert und auf eigene Verantwortung, seine Schwester von ihrer Arbeitsstätte abzuholen. Er wanderte die endlose Straße bis zum Werk hinunter, schlüpfte mit großer List so dicht am Wächterhäuschen vorbei, daß er vom Pförtner nicht bemerkt wurde, und rannte dann schnurstracks auf die Halle zu, in der er Theresia vermutete. Die schwere Eisentür war nur angelehnt. Er brachte sie mit seiner ganzen Körperkraft noch ein wenig weiter auf und zwängte sich hinein. Das Schicksal hatte es gut mit ihm gemeint. Er hätte ebenso in eine der dröhnenden Maschinenhallen oder ins Gußwerk geraten mögen; weißglühende Spritzer der Metallegierung hätten ihn versengen, eine Lore hätte ihn niederstoßen können. Aber dies hier war nur eine schlichte Tischlerei, in welcher die Kassetten für das Berndorfer Eßbesteck gezimmert wurden. Mehrere Männer standen an großen Hobelbänken in ihre Arbeit vertieft, und es dauerte geraume Zeit, bis ein junger Bursche seiner ansichtig wurde.
»Was suchst denn du hier, du kleiner Stöpsl?« rief er lachend. »Kommst uns gar vielleicht helfen, was?«
»I kumm die Resi abhol’n«, gab Ernstl sachlich zurück.
»Die Resi? Wer ist denn das?« fragte ein älterer Mann.
Nun war Ernstl am Ende seiner Weisheit. Die Resi war die Resi; wer denn sonst? Es war unfaßbar, daß jemand so dumm fragen konnte.
Die Männer hatten ihre Hobel und Stemmeisen weggelegt und umstanden den unerwarteten kleinen Besucher ein wenig ratlos, wie eben Männer, denen die Pflicht zufällt, ein Kind zu bemuttern. Endlich erkannte ihn einer.
»Das ist ja der Jüngste von die Ronasek, das Kuckucksei, Mamas Fehltritt!«
Alle lachten. Nur ein kleiner, grauschädliger Mensch sagte: »Psst! Macht’s kaane so blöden G’schpaß! Der siecht net so aus, als verständ er net, was g’redt wird!« Und dann zu dem Kind gewandt: »Na kumm, klaaner Schmarrn, i bring di zu deiner Resi.«
Nun ging es an der Hand des alten Arbeiters über Höfe und Gänge und Stiegen, auf denen überall Lärm und Vekehr herrschten, sodaß Ernstl sich ein wenig fürchten mußte. Endlich kamen sie in einen Raum, in dem es hell war und Frauen an großen Tischen saßen. Beim Anblick der weiblichen Wesen schöpfte Ernstl ein bißchen Mut; aber schon kam eine, die hier anscheinend das Regiment führte, mit zorniger Miene auf die Eintretenden zu und schrie:
»Was ist denn nacha dös? San mir im Kindergarten?«
Der Arbeiter erklärte in kurzen Worten den Fall. Ernstl hatte indessen seine Resi an einem der ersten Tische erspäht, riß sich von der Hand des Alten los und rannte auf sie zu.
Theresia hatte sich erhoben und stand mit krebsrotem Gesicht da.
»Aber Ernstl«, stotterte sie, »was fallt denn dir ein?«
»Ronasek«, rief die Aufseherin, die inzwischen den alten Tischler hinausexpediert hatte, »gehen Sie sofort an Ihren Platz zurück! Dös war ja no schöner, wann jeder hier tat, was er glaubt. Und ihr alle«, wandte sie sich an die übrigen Arbeiterinnen, »sitzt’s herum und glurt’s, anstatt zu arbeiten …«
Sie hätte gern noch ein wenig länger ihre Machtbefugnis geltend gemacht, aber ihr Blick war auf den kleinen Jungen gefallen, und sie verstummte.
Ernstl hatte sofort begriffen, daß es galt, diese strenge Dame für sich zu gewinnen, wenn überhaupt an dem mißglückten Unternehmen noch etwas zu retten war. Er machte einen sehr schönen Diener (den gleichen Diener, den er machen sollte, wenn die Taufpatin zu Besuch kam, und den man ihm dann um keinen Preis der Welt abzwingen konnte).
Die Aufseherin schien zu fühlen, daß ihre Autorität vor dem Lächeln dieses weißblonden Blasengerls zu scheitern drohte, denn sie sagte:
»Na ja, es is halb vier. Setzen S’ den Buben halt neben sich auf die Bank – und daß er a Ruah gibt. Hoffentlich kriagen mir ka Kontrolle, sonst schaun mir guat aus.«
So durfte Ernstl eine geschlagene halbe Stunde neben Resi am Packtisch sitzen und zusehen, wie die große Schwester mit raschen, mechanischen Griffen Löffel in Geschenkkassetten ordnete, sie an die Nachbarin weitergab, die ihrerseits Gabeln in die freigebliebenen Spalten schob, wonach eine dritte Frau die Behältnisse mit Messern vervollständigte. Es waren herrliche Gegenstände, diese Kassetten, aus schwarzem, rotem und braunem Leder, mit eingepreßten goldenen Initialen. Innen waren sie mit bauschiger Seide, mit Samt oder Sämisch ausgeschlagen und geradezu wohnlich eingerichtet, so daß die eingebetteten Bestecke sich darin gewiß sehr glücklich fühlen mußten. Ja, sie glichen tatsächlich Wohnungen, kostbaren Wohnungen für noch Kostbareres. Denn die Bestecke, die Resi so mir nichts dir nichts in ihre gewöhnlichen Hände nahm, schienen Ernstl in überirdischem Glanz zu strahlen. Es waren Schätze, wie sie die Zwerge aus dem Märchenbuch in ihren Höhlen verborgen hielten. Als sein Blick auf einen der Nebentische fiel, war er nahe daran, einen Schrei auszustoßen. Da standen silberne Gefäße, Schalen und Aufsätze, Serviettenbehälter, Keksdosen, Pokale und Teekannen. Ernstl ahnte nicht, welchen Zwecken all diese Pracht dienen mochte, aber daß es sich um Symbole von Reichtum und Luxus handelte, verstand er sehr gut. Es tat ihm weh, daß die Packerinnen die Wertgegenstände in Watte und Seidenpapier hüllten und in Versandkartons unterbrachten und daß die Tische, je länger er zusehen durfte, um so leerer wurden. Seiner Auffassung nach hätten diese Wunderdinge wie Weihgeschirr auf Altären gut sichtbar aufgestellt werden müssen, und die Arbeiterinnen hätten anbetend davor knien sollen. Statt dessen sputeten sich die Frauen, um mit dem Tagespensum bis zum Erklingen der Fabriksirene fertig zu werden.
Dies Bild des Glanzes und Prunks, des Wohlstands und der irdischen Herrlichkeit blieb Ernstl für immer in halbbewußter Erinnerung und verlor auch dann nicht an emotionellem Gehalt, als er längst groß genug geworden war, um zu wissen, daß es sich bloß um die Imitation wirklicher Wertgegenstände gehandelt hatte.
Seit einigen Jahren war Frau Katharina Ronasek Doppelverdienerin, was nicht besagen will, daß sie in Geld schwamm, sondern bloß, daß sie je nach der Saison zwei völlig verschiedenen Beschäftigungen nachging. Winters arbeitete sie im Theater als Scheuerfrau, und sommers, wenn die Spielzeit beendet war, hatte sie ihren Platz hinter dem gewaltigen Küchenherd in der Villa Sperl, denn die freiherrliche Familie pflegte in der heißen Jahreszeit ihr Wiener Heim zu verlassen und in Berndorf, oder besser gesagt unweit von Berndorf, auf ihrem schön gepflegten Besitz zu residieren. So wenig der kleine Ernst mit seiner grämlichen Frau Mutter anzufangen wußte, ihre beiden Berufe bildeten für ihn doch eine stete Quelle der Anregungen.
Stundenlang konnte das Kind, in die Plüschvorhänge einer Loge geschmiegt, dasitzen und den leeren Zuschauerraum des Theaters betrachten, während die Alte auf den Knien zwischen den Sitzreihen herumkroch und den Boden scheuerte. Die Kristallüster, die Vergoldungen an den Logen und Rangbrüstungen, die Stukkaturen des hufeisenförmigen Plafonds, die im Tanz dahinfliegende Musen und Genien darstellten, schienen ihm der Inbegriff des Schönen. Nirgends sonst auf der Welt gab es einen Raum wie diesen, nirgends so bequeme, weiche Sitze, nirgends solche Farb- und Beleuchtungseffekte, nirgends so viel »Atmosphäre« – wenn es mir erlaubt ist, dieses Wort hier anzuwenden, das Ernstl nicht kannte und vielleicht erst zwanzig Jahre später bei Frau Sedlak zum erstenmal hörte. – Aber auch wo Worte fehlen, gibt es ja Begriffe, in denen gerade um ihrer Unnennbarkeit willen ein übersinnlicher Zauber waltet. Das Berndorfer Theater schien Ernstl voll von solch namenlosen, unsichtbaren Kräften. Man konnte hier die Augen schließen, das Denken ausschalten und fühlte dennoch rings um sich den Geist des Ortes weben. Ja, so konkret machte sich dieser Genius loci für Ernstl bemerkbar, daß das Kind der festen Meinung war, man könne sich ruhig von der Brüstung fallen lassen, um sofort von seinen starken Armen erfaßt und getragen zu werden, wie er ja auch die beschwingten Jünglinge und musizierenden Mädchen dort oben an der Decke trug. Nur der Gedanke an die erdgebundene Mutter und ihr verständnisloses Schelten hinderte Ernstl daran, tatsächlich aus der Loge zu springen und zum vielarmigen Glaslüster hinüberzufliegen.
Zu Hause hatte man einfache hölzerne Tische und Bänke und Bettstellen, eine Petroleumlampe und ein Marienbild mit einem brennenden Fleischklumpen vorne an der Brust; und diese häusliche Ausstattung war der Inbegriff dessen, was man haben konnte und nicht haben wollte, der Inbegriff von Enge und Kleinstadt und Gewöhnlichkeit. Zu Hause war man in Berndorf. Hier aber, im Theater, war man in der großen Welt, umgeben von allem, was schön und begehrenswert erschien.
Gab es denn sonst nichts Schönes in Berndorf?
Für Ernstl jedenfalls nicht. Und es gab vor allem niemanden, der ihm die Augen dafür hätte öffnen können, der ihm gezeigt hätte, daß des Anrainers rotbehangener Apfelbaum schön ist und der Himbeerschlag in der Mittagsglut mit den violett blühenden Weidenröschen und die alten, niederen Giebelhäuser am Marktplatz, ja selbst der gehörnte Kopf der dürren Nachbarskuh. Beim Theater war es etwas anderes. Da brauchten einem die Augen nicht erst geöffnet zu werden. Da sah man gleich auf den ersten Blick, daß es schön war, wunderschön, am allerschönsten! Und nur die Mutter in ihrem verschossenen Kleid, mit ihren schmutzigen Eimern und Besen und dem derben, bei der Arbeit in die Luft gereckten Hinterteil war ein Schandfleck in dieser Pracht. Man mußte sich ihrer Armut und Gewöhnlichkeit schämen, und mittelbar schämte man sich auch der eigenen Armseligkeit.
Manchmal nahm Ernstl von seinem verborgenen Logensitz aus an Proben teil. Die läppischen Lustspiele und Operetten, die hier einstudiert wurden, interessierten ihn nicht als solche. Die Handlung war ihm gleichgültig, auch wurde sie durch Zwischenrufe des Regisseurs, durch Wiederholungen von Szenen außer der Reihe und andere derartige Störungen so in Stücke gerissen, daß das Kind beim besten Willen nicht in der Lage war, in den Dialogen, Tänzen und Ensembleszenen eine fortlaufende Erzählung zu erkennen. Wichtig war ihm nur, wie sich die Schauspieler benahmen, wie sie grüßten und dankten, die Hände der Damen küßten, Champagner schlürften, tanzten und miteinander konversierten. Da die Stücke fast ausschließlich in erlauchten Kreisen und unter hochgestellten Personen spielten, gab es für den Bauernburschen etwas zu lernen. Was auf der Bühne geschah, mußte als vornehm angesehen und unter allen Umständen berücksichtigt werden. Insbesondere galt es, die jüngeren Herren dieser gehobenen Sphäre zu beobachten und keine ihrer Gebärden und Floskeln außer acht zu lassen. Wenn es überhaupt etwas gab, was des Erlernens würdig schien, so waren es die Umgangsformen eines jugendlichen Bonvivants.
Auch der zweite Beruf der Katharina Ronasek gewährte Ernstl Einblick in die große Welt. Sie nahm den Knaben in ihr Sommerengagement mit. Natürlich mußte er mit ihr in der Dachkammer schlafen, aber schon das war eine Wohltat, denn daheim schliefen ja noch zwei seiner älteren Brüder mit ihren geräuschvollen und unappetitlichen Gewohnheiten im selben Zimmer. Solange er klein war, durfte er sogar mit dem um ein Jahr älteren Töchterchen der Herrschaft unter der Aufsicht einer schlesischen Bonne im Garten spielen. Regnete es aber und Mausi wurde im Haus gehalten, so war es ihm nicht gestattet, das Kinderzimmer zu betreten, denn das wäre zu weit gegangen. Die Baronin vertrat die Meinung, daß alles seine Grenzen habe und daß man die Dienstleute nicht einfach ins Kraut schießen lassen dürfe. Schließlich wollte man doch einen Unterschied zwischen der kleinen Baronesse und dem Sohn der Köchin gewahrt sehen.
Der Unterschied wurde übrigens mit den Jahren merklich größer. Ich meine nicht nur den, der sich daraus ergab, daß aus dem Kind Mausi immer mehr ein Mädchen und aus dem Kind Ernstl immer mehr ein Bursche wurde – dies sowieso; aber auch der Klassenunterschied zeichnete sich deutlicher ab, seit Mausi ins Sacré-Coeur ging und in den Ferien von einer Französin statt vom schlesischen Kinderfräulein beaufsichtigt wurde und seit Ernstl von seiner Mutter und von deren Brotgebern immer nachdrücklicher dazu angehalten wurde, sich nützlich zu machen, Schuhe zu putzen, Holz zu hacken, die Hunde zu striegeln und was es sonst an kleinen Arbeiten in der Villa Sperl zu verrichten gab. Der »vollkommene Gentleman« wollte – mehr aus moralischen denn aus pekuniären Gründen – keine »chronischen Nichtstuer« im Haus dulden, und so begann Ernstls Laufbahn als Hilfslakai mit seinem fünfzehnten Lebensjahr. Einstweilen sollte er die Herrschaften nur im Sommer bedienen, später aber – so plante man – würde er sich vielleicht auch für das Wiener Haus eignen.
In der Villa Sperl also war es, wo der junge Ronasek mit einem neuen Begriff in Berührung kam: mit dem Begriff der Kultur. Man las dort Bücher, man spielte Klavier, man streute französische Brocken ins Gespräch ein, man kleidete sich nach der Mode, man badete und trieb Körperpflege aller Art. Es ließe sich freilich dagegen einwenden, daß die Bücher, die auf den Nachttischen der Herrschaft lagen, reine Unterhaltungsliteratur enthielten, daß die von der Hausfrau auf dem Klavier exekutierte Musik vorwiegend in Phantasien aus der »Weißen Dame« oder dem »Zigeunerbaron« bestand und daß die ausgiebig mit Fremdwörtern garnierten Gespräche nicht so inhaltsreich waren, wie sie sich den Anschein gaben. Aber Ernstl erhob diese Einwände durchaus nicht. Wenn er auch an den Brotgebern Sperl so manches auszusetzen hatte, als Familie betrachtet, schienen sie ihm über jede Kritik erhaben. Solche Lebensgewohnheiten und solchen Umgangston, solche Bedürfnisse und Liebhabereien mußte man sich angewöhnen, wenn man in der Welt etwas vorstellen wollte.
Es war dem Knaben auch nicht weiter aufgefallen, daß inzwischen ein Krieg über Europa dahingegangen war. Kein Wunder. In Berndorf hatte man dies nicht allzusehr bemerkt. übrigens wollten auch Sperls vorderhand von der Tatsache einer veränderten Welt noch keine Notiz nehmen und taten untereinander – erst recht aber Außenstehenden gegenüber – so, als fühlten sie sich verpflichtet und berufen, in ihrem Heim ein Asyl für die »gute alte, leider jetzt zu Unrecht in Verruf gekommene Zeit« zu errichten.
Auch diese Ansicht seiner Brotgeber übernahm Ernstl kritiklos. Das will recht verstanden sein: Er erfühlte und ertastete sie, denn natürlich nahm sich niemand die Mühe, ihm irgendwelche herrschaftliche Meinungen mitzuteilen. Für ihn war nun einmal die Familie Sperl das Maß aller Dinge, und Ernstl war nicht der Mann, sich nach einem anderen Maßstab umzusehen. – Nein, dazu war er nicht der Mann, aber ein Mann war er nun doch schon, ein entzükkender, blondlockiger, jugendbärtiger Knabenmann. Und dies wurde ihm im Sommer 1921, also gegen Ende seiner zweiten Lakaiensaison, zum Verhängnis.
Es erübrigt sich, darauf einzugehen, was sich zwischen der kleinen Sacré-Coeur-Schülerin Mausi und ihm begeben hat. Vorgänge dieser Art halten wir für allzu schwer schilderbar. Wir wissen mit Bestimmtheit, daß die jungen Leute zu gleichen Teilen an dem Vorfall Schuld hatten, wenn bei so natürlichen Ereignissen von Schuld überhaupt die Rede sein kann. Wir wissen auch, daß sie beide von dem Gefühl getragen wurden, es handele sich hier um noch nie Dagewesenes, ganz Einmaliges und ganz Persönliches. – Wir haben Ähnliches erlebt und ähnlich empfunden. Auch wir waren erschrocken und zutiefst verstimmt, als wir nach einiger Zeit feststellen mußten, daß es sich bei unseren Erlebnissen durchaus nicht um persönlich einmaliges Geschehen gehandelt hatte; und erst reifere Jahre haben uns dahingehend belehrt, daß gerade in der individuellen Verkleidung des Unpersönlichen und Gesetzmäßigen ein Sinn zu suchen und ein Trost zu finden ist.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.