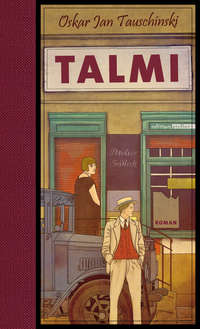Kitabı oku: «Talmi», sayfa 4
»Auf Wiedersehen!«
Die allzu blonden Locken fielen ihm in die Stirn, als er in der Tanzstundenverbeugung zusammenknickte, und kitzelten mich eine Sekunde später am Gelenk, als er meinen rauhen Handrücken mit priesterlicher Andacht küßte. Ich ergriff die Klinke des Haustors.
»Nur eine Frage noch, Gnädigste, verzeihen Sie mir bitte …« Bei dem unsicheren Klang seiner Stimme wandte ich mich um.
»Was heißt eigentlich …«, er schien mit aller Mühe das Wort aus dem Gedächtnis zu rekonstruieren, »Pa-ti-na?«
Ich hätte am liebsten laut aufgelacht, aber im selben Augenblick erschrak ich, weil ich fühlte, daß es nicht Spott war, was mich zum Lachen reizte, sondern Rührung. Ja, eine eigentümlich herzliche Rührung, von der es nur noch ein Schritt gewesen wäre, diesen bezaubernden, dummen Jungen da vor mir wie eine Mutter in die Arme zu nehmen und auf die Stirn zu küssen.
»Patina nennt man die Verunreinigungen, die sich mit der Zeit auf alten Kunstwerken abgelagert haben. – Auf Wiedersehen!« Ich schloß rasch das Haustor.
Vor mir lagen die wenigen Schritte bis zu Aglaias Atelier im Hinterhof. Ich dachte mit Schrecken daran, daß sie es mir anmerken würde, wie stark mein Herz hämmerte.
UNTERRICHTSSTUNDEN
(Susannens Aufzeichnungen vom 18. März 1945)
»Ich weiß alles, und Entschuldigungen werden nicht entgegengenommen!« rief Aglaia lachend, als ich eintrat. »Man läßt die greise Mentorin einsam und gramvoll warten und erlustiert sich derweilen auf der Gasse mit lockenhäuptigen Epheben! So – sehr schön! Das will ich mir merken!«
Ich sank, immer noch nach Atem ringend, in die Knie, küßte andeutungsweise den Saum von Aglaias Gewand, schlug dreimal gegen meine Brust und hob dann, wortlos um Vergebung flehend, meine Hände in die Höhe.
Aglaia half mir mit dem ganzen Aufwand ihrer wuchtigen Person auf die Füße und drückte mich so stürmisch auf den Diwan, daß Berti, der dort schon saß, Mühe hatte, seine zierliche Pose mit der Teetasse in der Hand beizubehalten. Auch ich bekam nun meinen Tee, den Aglaia herrlich wie niemand sonst zu bereiten wußte und den sie dann unter »O je!«-Rufen so verschwenderisch einschenkte, daß die Hälfte auf das Tischtuch oder die Kleider der Gäste rann.
Ach, Aglaia war einmalig! In ihrer tiefen, honigdunklen Stimme lag die ganze Wärme eines intensiven Herzens. Ihre groß angelegten Gebärden waren die bildhaften Äußerungen einer weiten, vorurteilslosen Seele. Fremdes Schicksal war ihr so gegenwärtig wie das eigene. Sie konnte über das Mißgeschick des gleichgültigsten Menschen bittere Tränen vergießen und an seinem Glück mit Lachen und Freudensprüngen teilnehmen, die bei ihrer massigen Gestalt und ihren Jahren unsäglich überraschend und komisch wirkten.
Es ist schwer, ihr Bild zu umreißen, aber eines steht fest: in ihrer Gegenwart glaubte man zu wissen, daß die Welt eine göttliche Schöpfung sei und das Leben eine Gnade. – Arme Freundin, dein eigenes Schicksal ist eher dazu angetan, den satanischen Ursprung der Welt und die Sinnlosigkeit aller Bewährung im Leben zu beweisen!
»Berti hat mir schon andeutungsweise von deinem Adonis erzählt«, kicherte Aglaia.
»Kennen Sie ihn denn?« fragte ich erstaunt.
»O ja, ein wenig«, murmelte Berti, »eigentlich bloß vom Sehen«, fügte er rasch hinzu.
»Ich kenne ihn selbst nur flüchtig und weiß nicht einmal seinen Namen.«
»Schade«, gab er zurück. »Wenn Sie besser mit ihm befreundet wären, hätten Sie vielleicht Gelegenheit gehabt, die berühmte … (er nannte den Namen der rumänischen Gastsängerin), die jetzt an die Metropolitan verpflichtet wurde, als Traviata zu hören.«
Ich machte ein dummes Gesicht und stellte die Tasse weg.
»Wieso … wieso wissen Sie denn das?«
»Was?«
»Na, daß ich mit diesem Jüngling in der Oper war und noch dazu wirklich bei Traviata.«
»Das wußte ich zwar nicht, aber ich höre es ohne Staunen, da ich das Vergnügen hatte, dabei zu sein, als Ihrem Freund die Eintrittskarten eingehändigt wurden.«
»Er ist nicht mein Freund, Berti, so hören Sie doch auf, mich zu necken! Aber jetzt möchte ich wissen, wie das mit den Opernkarten war.«
Wir saßen in der gemütlichen Sitzecke von Aglaias Atelier. Zu unseren Füßen war die elektrische Sonne eingeschaltet. Aglaia schnitt große Brotscheiben vom Laib herunter, bestrich sie mit Sardellenbutter und legte dann noch Wurst darauf, wobei sie immer, wenn sie sich unbeobachtet glaubte, die schönsten Wurststücke an die Siamkatze verfütterte, die nach alter Gepflogenheit ungeniert auf dem Teetisch hockte. Die hohe Stehlampe beleuchtete Aglaias Lehnstuhl, den Tisch und den Diwan, auf dem Berti und ich saßen. Der Rest des weiten Raumes lag im Dunkel. Aglaias Plastiken, große Gipsabgüsse in tragisch erstarrter Gebärde, halbbehauene Marmorblöcke monumentalen Gepräges und noch unfertige, in feuchte Tücher gewickelte Tonfiguren umragten uns und sahen so aus, als seien sie gerade in diesem Augenblick stehengeblieben, um aus respektvoller Entfernung und in konzentriertem Schweigen Bertis Erzählung mitanzuhören.
Die Sache hatte sich folgendermaßen zugetragen:
Berti, der wie jeder unglückliche Reporter dauernd auf der Suche nach Neuem, Aufregendem und Interessantem sein mußte – oder doch wenigstens nach Dingen, die bei den Zeitungslesern als solche galten –, hatte das Café Heinrichshof zu einem seiner Standplätze erwählt. Ausländische Gäste, vornehme und weniger vornehme Reiche, Filmleute, arrivierte Künstler, mondäne Frauen und Snobs aller Art konnte man in diesem repräsentativen Stadtkaffeehaus um jede Tageszeit beobachten. Die Nähe der Opernkreuzung, also eines Verkehrsbrennpunktes, bot ebenfalls Gelegenheit zu Erlebnissen und Erfahrungen, deren Schilderung dann den Wissensdurst der Pressekonsumenten befriedigen sollte.
Aus ähnlichen Gründen mochte wohl auch der junge blonde Mensch in das Café kommen, den Berti öfters hier antraf und der mit unverhohlenem Interesse an allem teilnahm, was sich im Saal begab. Zuerst glaubte Berti in ihm einen Kollegen sehen zu müssen; da er ihm aber niemals bei Presseempfängen oder in Redaktionen begegnete, gab er diese Annahme auf. Sollte es sich also um einen Detektiv handeln? Es war denkbar, ja wahrscheinlich, daß die Polizei oder ein privates Detektivbüro einen Vertreter nach dem mondänen Lokal entsandte. Aber wenn dies zutraf, so hatten die Vorgesetzten des jungen Burschen mit seiner Wahl einen Fehlgriff getan. Sein Betragen als Beobachter war viel zu auffällig. Niemand, der ihn auch nur einen Augenblick lang betrachtete, konnte annehmen, daß er die Illustrierte, die er in Händen hielt, tatsächlich las. Seine braunen Augen liefen unablässig von einem Gast zum andern, wobei es manchmal für den Bruchteil einer Sekunde so aussah, als schielte der junge Mensch. Leute, die still an ihren Tischen saßen oder in gedämpftem Ton und mit diskretem Gehaben Gespräche führten, schienen ihm uninteressant, obgleich Berti ihm hätte sagen können, daß gerade sie der Beobachtung würdig seien. Gäste hingegen in effektvollen Kleidern mit lautem Umgangston und dick aufgetragener Bedeutsamkeit machten auf den jungen Mann einen tiefen Eindruck. Je öfter er ins Kaffeehaus kam, desto sichtbarer wurde es, daß er sich an den letzteren ein Beispiel nahm. Sein ursprünglich eher schüchternes Auftreten wurde etwas zu sicher. Er rief mit hallender Stimme nach dem Kellner, bestellte immer den gleichen »kleinen Nußbraunen« mit einem Nachdruck, als wolle er durch seine Zeche den ganzen Betrieb aufrechterhalten, und er räkelte sich betont lässig in seinem Sessel. Offenbar war er bestrebt, es den modischen jungen Herren gleichzutun, die in tausend kleinen Abwandlungen – aber im Grunde zum Verwechseln ähnlich – zu den Habitués des Hauses gehörten. Diese Herren sprachen untereinander entweder aristokratisch genäselten Dialekt und tauschten übertriebene Höflichkeiten aus, oder sie warfen, dem Zug der Zeit Rechnung tragend, in salopper Sportlichkeit mit »Okay!«, »All right!« und »Hallo Baby!« um sich, womit vielleicht schon ihr ganzer englischer Wortschatz erschöpft war.
Der junge Mann hielt es mit zunehmender Akklimatisierung für angemessen, sich nach den näselnden Herren zu richten, obgleich sich seine gedrungene Sportlererscheinung mit dem muskulösen Nacken für den »Cave-man-Typ« zweifellos besser geeignet hätte. Er selbst gehörte jedenfalls nicht zu all dieser vielversprechenden Jugend, denn er saß immer allein und wurde von den anderen weder mit nasalem »Servus, grüß dich!« noch mit quakendem »Hallo!« angesprochen. Ob er es überhaupt darauf anlegte, Anschluß an die gesellschaftlichen Kreise zu finden, die hier verkehrten, war nicht recht klar, denn er machte gar keine Anstalten, um mit irgend jemandem im Saal ins Gespräch zu kommen. Vorläufig begnügte er sich mit der Rolle des Beobachters, und zwar so naiv unverfroren, daß Berti öfters eine leise Nervosität und manchmal sogar deutlichen Unwillen bei den aufs Korn genommenen Gästen zu bemerken glaubte. Überhaupt wirkte der Jüngling bei aller Mittelmäßigkeit recht auffallend, wozu seine fast platinblonde Mähne (die vielleicht Natur, möglicherweise aber gefärbt war) noch wesentlich beitrug.
Nun hatte anscheinend auch die rumänische Sopranistin, die ein paar Tage vor ihrem Gastspiel nach Wien gekommen war, den Heinrichshof zu ihrem Stammlokal erwählt. Berti kannte sie von dem Presseempfang, der ihr zu Ehren in der rumänischen Botschaft gegeben worden war. Er hatte sogar in seinem Blatt über sie geschrieben und rühmend hervorgehoben, daß die Künstlerin die Rolle der Violetta eigens für ihr Wiener Gastspiel deutsch einstudiert habe, obgleich sie die Sprache nicht beherrsche.
Täglich um die gleiche Zeit betrat die Sängerin energischen Schrittes den Saal und nahm an einem Ecktisch Platz. Zufällig war der junge Mann am ersten Abend in der Nähe gesessen. Von nun an bemühte er sich, immer wieder in ihrer Nachbarschaft Posten zu beziehen.
Obgleich Traviata weder schön noch jung war, wunderte es Berti nicht, daß der kindische Detektiv sie unverwandt betrachtete und Kalbsaugen machte, denn diese Kalbsaugen galten weniger der Weiblichkeit der Diva als ihrem exotischen Gehaben. Sie kam öfters in Begleitung von Herren, mit denen sie bei aufgeregtem Mienenspiel ihres groß angelegten, intelligenten Gesichtes eifrig plauderte. Es war klar, daß in den Gesprächen, die in der temperamentvoll und melodisch dahinrollenden Muttersprache der Frau geführt wurden, einzig von Engagementvorschlägen, Regieanweisungen, Partituren und Proben die Rede war. Die Künstlerin gefiel sich in so pompösen Opernbewegungen, ihre schöne Stimme, die auch im Sprechen die Primadonna ahnen ließ, klang so tragend, ihre Hüte und Pelze wirkten so extravagant, daß des jungen Gimpels Gaffen nur zu begreiflich war.
Zweifellos hatte die Dame den Bewunderer bemerkt, aber an Erfolg gewöhnt, nahm sie seine zudringlichen Blicke als selbstverständliche Huldigung entgegen und schenkte ihnen nicht die mindeste Aufmerksamkeit. Dem alten Oberkellner, der rumänisch sprach, erteilte sie in einem allzu herrscherlichen Ton immer die gleichen Befehle und widmete sich dann für die ganze Dauer ihres Aufenthaltes im Lokal einzig dem jeweiligen Begleiter.
Am Tag vor der Aufführung war sie jedoch allein erschienen. Unglücklicherweise hatte der alte Ober gerade dienstfrei. Ein anderer Kellner trat an ihren Tisch. Ohne hinzusehen, machte sie auf rumänisch ihre Bestellung, und erst als sie merkte, daß der so Angeredete sie nicht verstand, hob sie den Blick, der streng und ärgerlich war, und sagte: »Deitsch ich nix sprechen!«
In diesem Augenblick ereignete sich etwas, womit Berti am allerwenigsten gerechnet hatte: die vor Aufregung ein wenig belegte Stimme des Platinblonden ließ sich vernehmen:
»Die Dame bekommt einen Türkischen, zwei Brioches mit Butter und einen Wermut.«
Der Kellner verneigte sich und ging. Die Sängerin wandte sich belustigt um und musterte eine Sekunde lang ihren unerwarteten Vormund. Dann sagte sie höflich, aber etwas abwesend lächelnd: »Merci!« und steckte ihre große Nase in die Puderdose, die sie bis dahin offen in der Hand gehalten hatte.
Der junge Mann war sehr rot geworden. Man wußte nicht, ob er über seine Impulsivität beschämt oder über seinen Mut erfreut war. Aber er änderte seine Taktik, und als der Ober wieder an ihm vorbeikam, winkte er ihn heran und nannte die Namen einiger ausländischer Blätter, die die Sängerin in den letzten Tagen flüchtig angeschaut hatte. Auch dies war Traviata nicht entgangen; als ihr die Zeitungen gebracht wurden, wandte sie sich nicht an den Kellner, sondern an den Besteller und sagte abermals, diesmal mütterlich-gönnerhaft:
»Merci!«
Der Bursche erhob sich halb von seinem Stuhl und verneigte sich sehr artig und formvollendet. Bald darauf zahlte er seinen Nußbraunen, blieb aber sitzen und verließ das Café erst, als er die Künstlerin ihre Rechnung begleichen sah.
Unmittelbar nach der Gastsängerin brach auch Berti auf. Draußen wartete der junge Mensch bereits. Er hatte ein Taxi herbeigewinkt, öffnete nun den Schlag, half Traviata sehr geschickt und mit Grazie beim Einsteigen und sagte dann zum Chauffeur: »Fahren Sie die Dame zum Hotel Ambassador.«
Nun war es an der Diva, zu reden. Sie tat es dem höflichen jungen Mann zu Ehren sogar französisch. Es waren mehrere rasch abrollende Sätze. Bei den letzten Worten entnahm sie ihrem Täschchen zwei Theaterkarten, die sie ihm mit großer Bühnengeste einhändigte. – Es mochte dieselbe Geste sein, mit der sie in der Vorstellung dem verliebten Alfredo eine Kamelie überreichte. – Jedenfalls war dieser Aufwand an Worten und Gebärden vergeudet, denn der Jüngling, der gerade noch den Weltmann gespielt hatte, stand verdutzt da und betrachtete die Karten in seiner Hand.
Nun schien Berti der Zeitpunkt gekommen, um einzugreifen.
»Die Dame dankt Ihnen für Ihre Liebenswürdigkeit. Sie möchte Ihnen gern eine kleine Freude bereiten, weil sie nicht weiß, wie sie sich revanchieren kann. Sie bittet Sie, diese Opernsitze anzunehmen und sich die morgige Vorstellung anzuhören, in der sie die Hauptrolle singt.«
Traviata schien verstanden zu haben, was Berti sagte, denn sie nickte eifrig, rief dann nochmals abschließend: »Merci messieurs!« und gab dem Chauffeur einen Wink, abzufahren.
»Opernkarten – für mich?« hörte Berti im Fortgehen den verblüfften jungen Mann murmeln.
DER HEILIGE MARTIN UND FRAU MÜLLER
(Susannens Aufzeichnungen vom 20. März 1945)
»Vorhin ist eine hier jewesen«, sagte Margot, als ich vom Luftschutzkurs heimkam.
Sie war damit beschäftigt, Klinke und Schild der defekten Eingangstür mit Sidol zu putzen. Die offenkundige Sinnlosigkeit dieser Handlung verursachte mir ein inneres Kopfschütteln. Auch die strahlendsten Beschläge können die Kistenbretter, die rostigen Nägel und das Vorhängeschloß nicht vergessen machen. Aber ich sagte nur matt:
»Steht es dafür, Margot, daß Sie sich so plagen?«
»Das muß sein«, meinte sie. »Wie sieht denn das aus, ’ne unjeputzte Klinke? Was möchten da die Leute sagen?«
Margot fußt felsenfest auf ihren Grundsätzen. Ich wagte also nicht einzuwenden, daß es mir unter den gegebenen Umständen gleichgültig ist, was die Leute zu meiner Wohnungstür sagen.
»Wer ist denn dagewesen?« fragte ich.
»Och, so ’ne olle Pupp. Es liecht ohnedies ’n Zettelchen drin am Tisch.«
Das »Zettelchen« erwies sich als zierliche Visitenkarte und trug auf einer Seite die gedruckte Aufschrift: »Mausi Freiin von Sperl« und auf der anderen die eilig mit Bleistift hingekritzelten Worte: »Könnten Sie mich nicht besuchen, liebe Frau Sedlak? Ich habe Wichtiges mit Ihnen zu besprechen. Herzlichst Ihre …«
»Die Baronin Sperl wäre sehr gekränkt, wenn sie wüßte, daß Sie sie eine olle Pupp nennen, Margot. Sie ist höchstens vierzig.«
Margot zuckte unbestimmt die Achseln. »Ach nee!« sagte sie, und es blieb dahingestellt, ob sie die Besucherin für älter gehalten hatte oder ob ihr eine Vierzigjährige sowieso betagt genug erschien. »Jedenfalls ’ne rechte Nichtstuerin. Kommt daher, setzt sich breit hin und fängt an zu klönen, wo man doch gar nich weeß, was man zuerst tun soll. Hat se mir doch zujeschaut beim Bodenschrubben! Glauben Sie, daß se mir einen Eimer Wasser jebracht hätte? Nicht die Bohne! Und sowas nennt sich Freiin! Und Mausi och noch! Gott, wie niedlich!«
»Sie tun der Sperl unrecht, Margot. Vielleicht versteht sie vom Haushalt nicht viel, aber sie arbeitet seit Jahren bei einem Rechtsanwalt, und man soll sehr zufrieden mit ihr sein.«
Das stimmt. Mausis Vater, ein Industrieller, dem es 1898 anläßlich des Kaiserjubiläums unter Aufwendung von viel Geld gelungen war, in den Freiherrnstand erhoben zu werden, hatte sein Vermögen in Kriegsanleihen angelegt und war daher nach dem Weltkrieg nicht in der Lage gewesen, seiner Tochter, die nicht sehr hübsch zu werden versprach, einen ebenbürtigen Ehepartner zu verschaffen, da heiratsfreudige reiche Männer rarer sind als geldknappe Baronessen. So hatte Mausi sich bald mit dem Altjungferndasein abfinden müssen. Sie tat es sogar mit gewisser Grazie, indem sie einen Posten antrat und die Religion zu ihrer Privatliebhaberei erwählte.
Mausi ist eine flinke und gewissenhafte Bürokraft, legt aber Gewicht darauf, daß ihr Chef und ihre Mitarbeiter sie als Fräulein von Sperl anreden, und freut sich insgeheim darüber, daß man auch hinter ihrem Rücken von ihr als von der Baronin spricht. »Die Baronin ist zu Gericht gegangen.« »Die Baronin ist beim Diktat.« »Bringen Sie der Baronin den Akt Plunzengruber contra Gschiergl!« – Es ist, als läge ein wenig von dem Glanz, den dieser Titel in sich trägt, über den staubigen Aktenregalen der Kanzlei und als färbe der Adel auf die übrigen Angestellten des Rechtsanwaltes ab. Jeder von ihnen fühlt das deutlich – unbeschadet seiner sonstigen politischen Einstellung.
»Wenn man zur halbwegs besseren Wiener Gesellschaft gehört«, pflegt Mausi zu mir zu sagen, »dann kann man verschiedene Dinge nicht tun.« Sie meint: mit belegten Broten einen Ausflug in den Wienerwald machen, auf einen Stehplatz ins Theater gehen, ohne Hut und Handschuhe die Gasse betreten und dergleichen »proletarisches Gehaben« an den Tag legen. »Man ist zu bekannt. Man muß dem Rechnung tragen. – Da haben Sie es viel besser, meine Liebe«, meint sie gönnerhaft, aber man spürt deutlich, daß sie um keinen Preis der Welt mit mir tauschen würde.
Ich habe im Lauf der Jahre öfters kleine Aufträge von ihr erhalten, verbunden mit einer Unzahl von sterilen Weisungen, wie ich meine Arbeit anpacken solle. Denn Mausi ist natürlich eine Kunstmäzenin. Was aber konnte sie jetzt wollen? Es war nicht der Augenblick für die Anschaffung von zerbrechlichen Tonwaren. Ich nahm jedenfalls an, daß es sich wirklich um etwas Wichtiges handelte, und machte mich sofort auf den Weg.
Mausi Sperl hat durch die Fliegerangriffe doppelt zu leiden gehabt: zuerst sind ihre überzähligen Zimmer für Ausgebombte beschlagnahmt worden, und nun hat das Haus auch noch einen kleinen Treffer abbekommen. Die Scheiben sind sämtlich herausgefallen, die Gas- und Wasserleitungen defekt und auch die Kamine eingestürzt, so daß nicht geheizt werden kann. Nur das elektrische Licht ist intakt geblieben.
Diese Einzelheiten erfuhr ich, als ich das erste der drei Zimmer betrat, denn unpraktischerweise gelangt man in Mausis altmodischer Wohnung nur aus einem Raum in den anderen. Die bombengeschädigte Hofratswitwe, die in diesem Gelaß logiert, hat mir das alles erzählt und dazu auch noch, daß sie seit vorgestern nur trockenes Brot esse, was ihrem Magen äußerst unzuträglich sei, und daß sie angesichts der mit Papier verklebten Fensterhöhlen angezogen zu Bett gehe. – Arme Mausi, dachte ich, nicht bloß Bomben, sondern auch noch eine geschwätzige Mieterin!
Im nächsten, völlig kahlen Raum haust eine junge, farblose Kriegswitwe mit ihren zwei Kindern. – Die Kleinen saßen fröstelnd zusammengedrückt im einzigen Bett. Jedes hielt eine ungeschälte Kartoffel in der Hand. Die Frau war in Tränen.
»Seit elf Uhr bin ich unterwegs, und jetzt erst komme ich nach Hause«, schluchzte sie. »Ich war bei meiner Schwester in Hacking. Die hat einen Holzherd, auf dem man kochen kann. Was sich auf der Stadtbahn tut, ist unbeschreiblich. Man steht stundenlang im Gedränge; dann fährt man ein Stückchen, und dann muß man wieder zu Fuß gehen. Den Topf mit Erdäpfeln hab ich in eine Decke eingeschlagen, damit sie warm bleiben. Aber woher denn! Ganz kalt sind sie. Nicht einmal die Finger können sich die Kinder dran wärmen. Es ist nur ein Glück, daß der Frühling kommt … Vielleicht dauert’s doch nicht mehr lang.«
Es fiel mir schwer, Trostworte angesichts einer Welt zu finden, in der es außer dem Herannahen der warmen Jahreszeit nichts Tröstliches gibt. Aber kaum hatte ich ein paar konfektionierte Redensarten, wie etwa: daß man den Mut nicht sinken lassen dürfe und daß wir das Schlimmste vielleicht schon hinter uns hätten, hervorgestottert, als sich Mausi Sperl im Türspalt vernehmen ließ:
»Da sind Sie ja! Ich habe Sie an der Stimme erkannt. Kommen Sie schnell herein, damit mir die Wärme nicht davonzieht.«
Ich nickte der Witwe aufmunternd zu und trat bei Mausi ein. Welch ein anderes Bild zeigte sich! Die Fenster waren mit Sperrholzplatten ordentlich vernagelt. Darüber hatte die Sperl altmodische Plüschvorhänge drapiert. Auf dem Boden lagen Wolldecken. Im Zimmer war es warm, und es roch herrlich nach Gebackenem. Auf dem Tischchen neben dem Diwan lag ein offenes Büchlein: Die Nachfolge Christi.
»Nicht wahr, da staunen Sie, meine Liebe! Ich habe es relativ gemütlich. Natürlich muß man sich heute bescheiden und alle Prüfungen in Demut tragen.« Sie warf einen Blick in die Runde. »So muß ich mich jetzt mit diesem Plüsch-Greuel behelfen, der noch von meiner Großmama stammt. Meine guten Sachen habe ich zur Gräfin Hartenstein nach Kärnten geschickt.«
Ich nahm das Büchlein zur Hand.
»Ja, mein geliebter Thomas von Kempen«, plauderte Mausi weiter. »Die Welt wäre anders, wenn die Menschen in der Nachfolge Christi leben wollten.«
Das war nun auch meine Meinung. Ich freute mich, der Baronin in diesem Punkt beipflichten zu können, und tat es.
»Nicht wahr, nicht wahr, Frau Sedlak, Sie teilen meine Ansicht? Die Menschen haben leider ihre Ohren für die Gebote der Liebe verschlossen, und das ist nun der Erfolg …«
Ich fand, nun sei genug über diesen Gegenstand gesagt, und suchte nach einem anderen Stoff.
»Schön warm haben Sie es hier«, meinte ich schließlich, da mir dies Thema angesichts der allgemeinen Verfrorenheit aktuell schien.
»Mhm, ja«, gab Mausi unbestimmt zurück. »Wir sind als drei Haushalte gemeldet, da treffen mich die Stromsparmaßnahmen nicht so empfindlich. Übrigens kommen wir zur Sache: Ich möchte bei Ihnen etwas bestellen. Das war der Grund meines Besuches. Sie arbeiten doch noch nebenberuflich in Ihrem Fach, nicht wahr?«
»Jetzt? – Aber liebe Baronin, wie soll ich denn jetzt arbeiten? Es gibt in ganz Wien keine Glasuren, und den Ton muß man sich auf einem Handwagen vom Wienerberg holen. Bei meiner körperlichen Verfassung ist das nicht möglich. Abgesehen davon, daß kein Kachelbrenner eine Zuteilung von Holz für den Brand von Luxusgegenständen bekommt.«
»Wie dumm! Das habe ich nicht gewußt. Können Sie sich nicht hintenherum das nötige Material beschaffen? Man soll doch alles kriegen, sagen die Leute. Ich bin so unerfahren in diesen Dingen. Wissen Sie, ich brauche nämlich ein Geschenk für mein Patenkind, die kleine Monika Agathe Scholastika Müller. – Ja, denken Sie nur, Müller heißt der arme Wurm! Seine Mutter war meine beste Freundin im Sacré-Coeur, eine geborene Komtesse zur Linde. Das ist nun schon das dritte ›Müllerkind‹ meiner armen Vilma. Übrigens sind die Kleinen reizend – reizend, sage ich Ihnen …«
Ich weiß es. Ich kenne Frau Obersturmbannführer Müller, die geborene zur Linde. Vielleicht kenne ich sie besser als Mausi, obgleich ich durchaus nicht im Sacré-Coeur erzogen worden bin. Und ihre zwei älteren Kinder, die Zwillinge … Nein, nein, ich durfte mir um keinen Preis etwas anmerken lassen! So sagte ich nur beiläufig:
»Ich glaube mich an Frau Müller zu erinnern. Sie hat – wenn ich nicht irre, auf Ihre Empfehlung hin, liebe Baronin – vor mehreren Jahren bei mir etwas bestellt. Und womit kann ich Ihnen nun gefällig sein? Was gedachten Sie, der kleinen Monika – verzeihen Sie, ich habe die anderen Namen nicht behalten – zu schenken?«
»Agathe Scholastika Müller!« ergänzte Mausi lachend und schüttelte sich komisch vor innerem Schauder bei dem Familiennamen, dessen »ü« sie verächtlich wie »ö« aussprach und über Gebühr betonte.
Auch gut, überlegte ich. Die vorigen Kinder hatten Horst-Dieter und Siegrun geheißen. Vielleicht bereut Vilma heute schon … Ich dachte meinen Gedanken nicht zu Ende, denn Mausi hatte begonnen, das in Aussicht genommene Patengeschenk zu beschreiben.
»Wissen Sie, meine Liebe, ich denke an einen Weihwasserkessel. Natürlich etwas ganz Apartes. Sie kennen ja meinen Geschmack. Und recht groß muß er sein. Nicht eines von diesen kleinen Vogelnäpfchen, in die man kaum andeutungsweise einen Finger hineinstecken kann. Kinder muß man von klein auf zur Frömmigkeit erziehen.«
»Ich werde tun, was in meinen Kräften steht«, sagte ich. »Aber an einen Termin kann ich mich jetzt nicht binden.«
»Gar keine Rede davon. Sie machen alles, wie Sie es für richtig halten, und ich werde es Vilma schon erklären, warum das Patengeschenk ein wenig auf sich warten läßt. Wissen Sie, Beste, man muß Gott danken, daß einem nur die Rolle der Patenmutter zugefallen ist. Sie sind doch sicher meiner Meinung: Wir sind jetzt im Vorteil gegenüber den verheirateten Frauen. Wir brauchen für niemanden zu sorgen, um niemanden zu zittern.«
Ich hätte gern erwidert, daß ich gerade diese Sorge um nahestehende Menschen am meisten entbehrte. War sie nicht gleichbedeutend mit dem Begriff: Liebe? Aber ich sagte nichts dergleichen, sondern entgegnete, indem ich auf meinen schiefen Rücken wies:
»Mein Gott, für mich ist das ja überhaupt nie in Frage gekommen. Von mir müssen Sie ganz absehen. Aber eigentich ist es doch nur selbstverständlich, wenn eine Frau einen Mann für sich haben will, einen Hausstand, eine Familie. Es möchte doch jeder gern seinem Herzen nachgeben – ohne Vorbehalt …«
Ich ahnte nicht, was für Aufschlüsse mir diese nur gesprächsweise hingeworfene Bemerkung bringen sollte. – Mausi lachte.
»Seinem Herzen nachgeben! Haha. Nein, das Herz ist etwas viel zu Unzuverlässiges. Sentimentalität war nie meine Sache. Ich habe mich immer vom Verstand und von meinem Ethos leiten lassen.« Sie wurde plötzlich nachdenklich. »Nur einmal, noch als ganz junges Ding, wäre ich fast so albern gewesen, meinem Herzen ohne Vorbehalt nachzugeben. – Zu gelungen, diese Wendung! – Da sähe ich heute gut aus! Eine Bäuerin wäre ich jetzt wohl – nein, nicht einmal das, eine Chauffeursgattin, vor lauter Vorbehaltlosigkeit. Das war noch in der Zeit, als wir unseren Besitz bei Berndorf hatten. Das Objekt meiner großen Leidenschaft gehörte dem dienenden Stande an. Haha! Seine Mutter war eine Untergebene in unserem Haus. Na, meine Eltern wuschen mir gehörig den Kopf – noch heute danke ich ihnen dafür! –, und damit war diese Herzensangelegenheit aus der Welt geschafft. Übrigens hat sich Papa als der vollkommene Gentleman gezeigt, der er war. Den jungen Burschen, der begreiflicherweise aus dem Hause mußte, ließ er auf seine Kosten einen Autofahrkurs machen und brachte ihn dann irgendwo in der Lebensmittelindustrie unter. Ich habe nie mehr von ihm gehört.«
Ich hatte Mausi mit wachsender Spannung gelauscht. Also sie war das gewesen? Mausi war das nie mit Namen genannte junge Mädchen aus Berndorf? Eine plötzliche Wut kochte in mir auf. Pah! »Seine Mutter war eine Untergebene …« – statt einfach und geradeheraus zu sagen, daß sie Aushilfsköchin war, die im Sommer, wenn Sperls in ihrer Villa bei Berndorf residierten, für die freiherrliche Familie arbeitete. »Er gehörte dem dienenden Stande an.« Jawohl, Hilfslakai hätte er werden sollen und überdies dem gnädigen Fräulein Schwimmunterricht erteilen. Er war ein entzückender, sonnengebräunter Bursche von sechzehn, mit weißblondem Haar und einem fast noch kindlichen Stierkalbnacken, und sie eine häßliche, frühreife Siebzehnjährige, die, anstatt schwimmen zu lernen, auf dem besten Weg war, von diesem Kind in andere Umstände gebracht zu werden. Vielleicht ist sie schuld an Ernstls unseligem Streben nach gesellschaftlicher Vollwertigkeit. Vielleicht ist sie überhaupt die Ursache von allem, allem, was dann gekommen ist …
Ich rang nach Beherrschung, um nicht aufzuspringen und die Tür hinter mir ins Schloß zu werfen. Aber Mausi schien meine Erregung nicht bemerkt zu haben. Sie lächelte immer noch voll innerer Genugtuung darüber, daß sie schon als Backfisch so viel Vernunft bewiesen hatte und daß ihr Vater ein vollkommener Gentleman gewesen war.
Mit Ernstls Augen gesehen und von ihm erzählt, hatte sich die Geschichte ganz anders dargestellt.
»Ja, ja«, sagte ich schließlich, wieder gefaßt, »so macht halt jeder im Leben andere Erfahrungen«, und ich bemerkte mit Staunen, wieviel Wahrheit plötzlich in dieser fertiggekauften Phrase lag. »Es riecht übrigens herrlich bei ihnen, wie in einer italienischen Rosteria.«
Mausi machte ein verschmitztes Gesicht.
»Ihnen kann ich es ja sagen«, meinte sie, »aber natürlich ganz im geheimen. Ich besitze einen Elektroofen. Das heißt, er gehört – genau genommen – meiner Kusine, die in Zürich lebt. Und jetzt habe ich endlich herausgefunden, daß man auf diesem Ofen auch zur Not kochen kann, wenn man ihn auf die Seite legt. Vorhin habe ich mir Frittaten gebacken. Köstlich, sage ich Ihnen! Tja, ich habe lange mit mir gekämpft, ob es nicht meine Pflicht sei, den Ofen auch meinen Untermietern zur Verfügung zu stellen. Die Ärmsten frieren ja so und haben nichts Warmes zu essen. Aber ich bin zur Überzeugung gekommen, daß ich dies nicht tun darf. Ja, verstehen Sie mich recht: Der Ofen gehört doch nicht mir. Wenn er verdorben wird – und das wird er bestimmt, wenn drei Haushalte damit heizen und darauf kochen –, so kann ich ihn jetzt gar nicht ersetzen. Man darf nur das Eigene mit dem Nächsten teilen. Das lehrt schon die Legende vom heiligen Martin und dem Bettler. Fremdes Eigentum, das uns anvertraut ist, darf nicht angetastet werden. Finden Sie das nicht auch?«