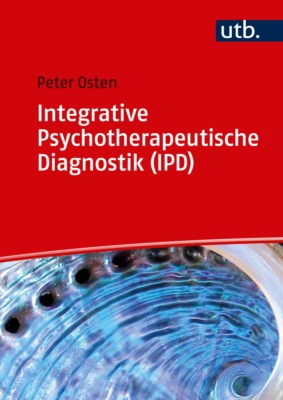Kitabı oku: «Integrative Psychotherapeutische Diagnostik (IPD)», sayfa 5
Ursprung des Subjekts
Die Leibphilosophie (Böhme, 1985) stellt den Aspekt des Lebens als Widerfahrnis in den Vordergrund, weil das leibliche Sich-gegeben-Sein zunächst immer eine pathische Erfahrung ist, also etwas, das einem geschieht. Es sind nicht die Akte des Willens, der Handlung oder des Ichs allein, in deren Gefolge das Leibsubjekt in Erscheinung tritt. In der Dialektik der Aufklärung stellen Horkheimer und Adorno (1988) den Ursprung des Subjekts als Ergebnis einer Überlebensstrategie des Menschen dar. Die Entzweiung von Natur und Vernunft habe dem Menschen die Beherrschung der äußeren Natur ermöglicht. Der Preis dafür war die Unterwerfung auch der eigenen Natur. So entstand das autonome Subjekt als Abhebung von seiner eigenen Natur. Das Subjekt wird in dieser Vorstellung als Instanz der Naturbeherrschung vollkommen entleiblicht.
Böhme (2008) hingegen sucht den Ursprung des Subjekts nicht in der Entzweiung mit der Natur, sondern aus der Leiblichkeit selbst heraus zu deuten. Die Furcht vor dem Leiden, Scheu vor der Regression, die Angst vor dem Selbstverlust, das sind Themen, die das Einverständnis mit der eigenen Natur behindern. Er definiert den Ursprung des Subjekts genau hier, in der Erfahrung von Schmerz, wo keine andere Theorie eine Fundierung des Selbst für möglich halten würde: „Es ist das verpanzerte Ich, das sich auf solche Erfahrungen nicht einlassen will oder kann“ (ebd., 143). Es ist die „Enge eines auf sich zurückgeworfenen Lebensvollzugs, aus dem das Ich sich losreißt“ (ebd.), gleichzeitig kann es aber seine Eingelassenheit in den Leib wieder erleben.
Dem Schmerz ist eine Betroffenheit mitgegeben, die das Ich-Bewusstsein im ersten Moment in den Hintergrund treten lässt. Angst, Schmerz, Hunger, Durst usw. rufen eine Ahnung oder sogar die Gewissheit der Selbstgegebenheit auf den Plan – ein Ich ist dafür noch nicht vonnöten. Der Schmerz wird zunächst als etwas Fremdes erfahren, das mich aber angeht: „Es schmerzt mich.“ Es ist der Schmerz, der mir den Körper unausweichlich als meinen Leib zuordnet (ebd., 156). Das phänomenologisch verstandene Leib-Selbst erlebt sich verwundbar im „Urzustand seiner kreatürlichen Unfreiwilligkeit“ (Lévinas, 1998; Czapsky, 2017) oder im Zustand seiner „Jemeinigkeit“, wie Heidegger (1929) es ausdrückte. Erst im Austritt aus der Regression des Schmerzes bildet sich das Ich, das nun konstatiert: „Ich habe Schmerzen“, und das diese Schmerzen nun im nächsten Schritt – entfremdet – als Sachverhalt des Körpers versteht und behandelt. Diese Form „leiblich betroffener Selbstgegebenheit“ ist bei Böhme das Prinzip der Subjektivität.
Leiblichkeit indes ist niemals isoliert zu denken, sondern immer im Aspekt von Interaktion, Sozialität und Ökologie, also der Zwischenleiblichkeit (Merleau-Ponty, 1966). Sie entsteht aus der erotischen Begegnung von Frau und Mann (Marion, 2013), die ein Ereignis im Sinne Badious (2016a) darstellt. Sie reift während der Gestation im Mutterleib in engster organismischer Verbundenheit (Petzold, 1995, 2011) heran, und ihr Überleben ist auch nach der Geburt ohne intimste leibliche Eingebundenheit nicht denkbar. Formen der Angewiesenheit verwandeln sich über die Lebensspanne zwar qualitativ und graduell, sie stellen aber eine der grundlegenden konstitutiven Bedingungen dessen dar, was wir die „Person“ nennen. Im Abschnitt über die Epigenese der Person werden diese Skizzen noch weiter ausgeführt (siehe II/2.4).
Böhme verneint die Bildung des Subjektbewusstseins aus der Interaktion mit dem Anderen nicht, aber er hält sie für prekär. Den Ursprung des Subjekterlebens nicht allein auf die Sozialität oder die Kultur zu projizieren, macht Sinn, denn hierin wäre es erstens vollkommen entleiblicht, zweitens sozialökologisch vollkommen abhängig. Es umgekehrt nur in die Leiblichkeit zurückzudeuten, wäre ebenso prekär, weil hiermit die soziale und ökologische Dimension der Leiblichkeit ausgeblendet würde. Erst wenn Leiblichkeit, Sozialität und Ökologie als zusammengehörig verstanden werden, kann ein Bild unhintergehbarer Bezogenheit des Subjekts auf die Welt hin entstehen. Bei Merleau-Ponty (1976) ist es das Verhalten des Menschen „zur Welt hin“ (être au monde), die leibliche, sinnsuchende Interaktion des Menschen mit der Welt, die eigentlich erst Humanbewusstsein erzeugt. Bewusstsein und Subjekt-Sein sind daher nie an sich primär, sondern sie sind primär in den Leib zurückgebunden. Das sinnbezügliche Verhalten, somit auch die Sprache und das Sprechen, das Denken und das leibliche Empfinden treten als Vermittler zwischen Leib und Umwelt auf und stellen so die Grundbedingungen des Bewusstseins und des Person-seins erst her (Derrida, 2012, 2013; siehe II/2.5).
So müssen vielschichtige „Quellen des Selbst“ anerkannt werden (Taylor, 1996). Das Selbst im Gefolge dieser Vorstellungen ist ein phänomenologisches Leib-Selbst, das epigenetisch aus der Synergie von Leiblichkeit, Sozialität und Ökologizität emergiert. Als im pragmatischen Sinn inkarniert (Merleau-Ponty, 1966) kann das Subjekt betrachtet werden, wenn vonseiten einer phänomenologisch wahrnehmbaren Bewusstseinsinstanz durch das Subjekt die Selbstaneignung der Leiblichkeit im Modus einer Identifikation vorgenommen wurde (Metzinger, 1996). Das ist aber nicht nur Aktivität im engeren Sinn, sondern auch ein pathisches Geschehen (Böhme, 1985), das etwas mit reflektierender Besinnung (Henrich, 2016), mit Zustimmung und Hingabe zu tun hat (Lévinas, 1998) und dann erst zu einem reifen Subjektsinn führt: Aneignung als ein Prozess des „wachen Nichthandelns“ (Hogrebe, 2006).
Weil die Natur, die Selbsttätigkeit des Leibes, uns immer wieder einholt, uns bedrängt, wir ihr ausgesetzt sind bis in die Regression und bis ins Sterben, bleibt es für das emanzipierte Subjekt immer noch und immer wieder eine Frage des praktischen Selbstverhältnisses, ob man die leiblichen Regungen als Gefährdungen des Selbstbesitzes erfährt, sie wegdrängt, sie als ,bloß körperlich abtut‘ oder sie zulässt, sich von ihnen führen lässt, aus ihnen lernt und sie als Zeichen der eigenen Lebendigkeit, sogar als Orientierung für das eigene Denken, Urteilen, Fühlen und Handeln entgegennehmen kann. Freilich, wenn diese Bewegungen nicht leidvoll sind, mag uns das leichter gelingen und sie erfreuen uns sogar – etwa beim Einschlafen oder im Vollzug der Sexualität. Wie auch immer, dem reifen Menschen ist seine Natur nie bloß äußerlich, sondern etwas, das er mit seinem Leib selbst ist: „Ich bin überhaupt nur ein [Subjekt], insofern ich mir unausweichlich [als Leib selbst] gegeben bin“ (Böhme, 2008, 148f., 157, Einfügung durch Autor; vgl. auch Waldenfels, 2000). In dieser Sicht ist das Subjektsein etwas potenziell Radikales, weil unverwechselbar und solitär. Damit stellt es die grundlegende Bedingung des revolutionär Neuen dar (Badiou, 2014).
Leibliche Präsenz, Daseinserfüllung
In Zeiten des Krieges, in mühsamer körperlicher Arbeit und Produktion, Versklavung und Verachtung des Lebens muss es notwendig gewesen sein, Leiblichkeit zu verleugnen, den Körper zu disziplinieren, ihn auf Herausforderungen und Gefahren hin abzurichten. Aber auch jetzt, da in unserer Gegenwart und Kultur diese Notwendigkeiten weitgehend in den Hintergrund getreten sind, ist die leibliche Präsenz im Sinne einer positiven Daseinserfüllung nicht von selbst gegeben.
Zum einen sind unsere Kultur und unser Denken, auch ohne die krassen Notwendigkeiten früherer Zeiten, immer noch vom Leistungsprinzip und anderen Verdrängungen durchdrungen (Marcuse, 1965), zum anderen ist das eigenleibliche Spüren oder Bei-sich-Sein immer an die Herausforderung der Begegnung mit sich und anderen gebunden – Konsequenzen des Daseins als Mensch. Der schlichte Wunsch, ,mehr bei sich sein zu können‘, impliziert oft nicht im Geringsten seine Bindung an die Konfrontation mit existenziellen Lebensthemen: Es sucht das Feine, Vergnügliche, Beruhigende, Saturierte. Bei sich sein kann aber bedeuten, in einem Zug mit dem Schönen auch alles Unangenehme spüren zu müssen. Das Selbst-Sein im Vollsinn eigenleiblichen, also phänomenologischen Spürens und Wahrnehmens stellt sich dem Menschen als eine Aufgabe dar (Böhme, 2012, 2017).
Daseinserfüllung wird in unserer Kultur nicht in erster Linie in lustvoller leiblicher Existenz gesucht, sondern eher in Bereichen des Erfolges, der gesellschaftlichen Stellung, im Besitz und im Ansehen. Obwohl das Gelingen dieser Vollzüge an sich nur eine mögliche Voraussetzung für das „Glück der Sterblichen“ (Janke, 2002) darstellt, spreizt es sich oft genug schon als „Glück an sich“ auf (Fenner, 2004). Als tiefgreifend wirksam für diese Verschiebungen werden hier der christlich-abendländische Glaube und Dogmatismus angesehen, die Formen leiblichen Vergnügens an sich schon als schuldhaft ausgearbeitet haben (Caillois, 1988; Frielingsdorf, 1997). Die psychische Gewalttätigkeit durch christliche Moral und religiöse Schuldzuschreibungen die Natur des Menschen betreffend, die Entwertung leiblichen Daseins, die Entmündigung, Okkupation und Verfolgung haben dafür gesorgt, dass das Bewusstsein des Menschen in ein Gegenstands- und Sozialbewusstsein ohne Leiblichkeit habituiert ist: Man ist „außer sich“ (Girard, 2012; Agamben, 2010).
In Sein und Zeit beschreibt Heidegger (1929), wie über Schuldbewusstsein die Vergangenheit und Sorgen die Zukunft betreffend die leibliche Gegenwart versäumt wird. Diese Bewegung wird heute durch eine dritte Ebene der Ablenkung geboostet, in der hybride Formen von Information und Kommunikation, die Akkumulation digitaler sozialer Welten im globalisierten Kontext, den Menschen in eine mentale und leibliche Ataxie verfrachten, in eine Agonie des Gegenwartsbezugs (Baudrillard, 1978), in der er zuerst seiner Mitte und seines Daseins verlustig geht, anschließend ungeheure Anstrengungen zur Wiedergewinnung des zuvor Verlorenen unternimmt (Böhme, 2017; vgl. Han, 2016). Das ist moderne Daseinserfüllung.
Reine Lust und Freude am leiblichen Dasein im Sinne des Verweilens (Han, 2015a) sind heute alles andere als eine selbstverständliche Kategorie. In den meisten Verrichtungen unseres Alltags ist die leibliche Anwesenheit schon gar nicht mehr vonnöten. Die zwischenleibliche Kommunikation wird vielfach durch jene am Bildschirm ersetzt oder in Algorithmen digitaler Medien simuliert (Jullien, 2014a). Bloß noch im Urlaub will man ,selbst da‘ gewesen sein. Wenn es (auch) hier nicht nur um das Posten geht, kann man annehmen, dass ein Erleben, vielleicht sogar ein Abenteuer gesucht wird, jedenfalls eine Erfahrung des eigenleiblichen Spürens (Schmitz, 2007). Aber „das Gefühl[,] da zu sein, stellt sich nicht mit dem Ereignis des Ankommens ein, sondern erst nach einem gewissen Zurücktreten, einem Abwarten, bis die Szene [und die Atmosphäre] sich öffnet und die Dinge auf einen zutreten“ (Böhme, 2017, 132; Einfügung durch Autor; vgl. Petzold, 1993e). Dies erfordert die Umstellung vom zugreifenden und konstatierenden Blick hin zur empfangenden Anschauung (Jullien, 2010). Für eine solche Erfahrung darf die Umgebung nicht nur ein zweidimensionales Bild sein.
Noch deutlicher wird das Erfordernis leiblicher Anwesenheit im Bereich der Kommunikation, wenn diese nicht mehr nur auditiv und visuell ablaufen soll. Hier geht es um eine Aktualisierung gemeinsamer leiblicher Anwesenheit (Böhme, 2017). In der Unmittelbarkeit des Sich-in-Augenschein-Nehmens, der freundschaftlichen Berührungen, des unverfälschten Hörens einer Stimme, des Sich-zu-erkennen-Gebens (Bauer, 2012; Henry, 2018) usw. wird jede Form der Subversivität, die die elektronischen Medien ermöglichen, in konkrete leibliche Kommunikation verwandelt. Noch bevor das erste Wort gesprochen ist, wird man bereits vom Gegenüber wahrgenommen, steht man schon in Beziehung, hat man sich bereits zu verantworten. Dass diese Herausforderungen für den postmodernen Menschen oft schon zu viel sind, man sich lieber hinter Bildschirme zurückzieht, spricht für die Entfremdung von leiblicher Präsenz. Selbst ein lebendiges Schweigen in leiblicher Anwesenheit mutiert so zum vakuumierten Warten auf die Antwort nach dem Absenden einer WhatsApp-Nachricht.
Leibliche Präsenz ist Öffnung in den sozialen und ökologischen Raum. Sie ist eine mit den Kommunikationspartnern praktizierte gegenseitige Versicherung gemeinsamer Anwesenheit. Vom einfachen Austausch ausgehend, lässt sie sich steigern in Formen geteilter leiblicher Ökonomie, etwa beim Singen, Musizieren oder bei gemeinsamer Arbeit, weitergehend in erotischer Intimität; in ihre höchste Steigerung gelangt diese Form der „Einleibung“ (Schmitz, 2007a) in der leiblichen Liebe und sexuellen Geschlechtlichkeit.
Geschlechtlichkeit
Mit der Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit wird deutlich, wie wenig Leiblichkeit in ihrer sexuellen Dimension eine ganz persönliche Angelegenheit bleiben kann. Spätestens hier wird die Öffnung des Leibes hin zum „social body“ (Petzold, 2011a) evident. Und das in mehreren Weisen. Es trifft in erster Linie für alle Formen zwischenleiblicher Kommunikation zu, hier befinden wir uns noch auf der eher angenehmen Seite. Wie sehr die Geschlechtsleiblichkeit auch im größeren sozialen Raum verankert und durch ihn bestimmt wird, erfahren wir, wenn wir wahrnehmen müssen, mit welcher Wucht, zum Teil Gewalttätigkeit, Religiöses, Gesellschaftliches, Politisches und Wissenschaftliches in das sexuelle Leib-Subjekt drängt und es zu kolonialisieren trachtet. Foucault (1987) hat das Biopolitik und Gouvernementalität genannt (Nancy, 2014b; Gugutzer, 2015).
Dabei geht es nur an der Oberfläche um Definitionen sexueller Präferenzen. Der „anonyme Diskurs“ der Gesellschaft (Foucault, 2005, 2012) will nicht nur bestimmen, was unter Männlichkeit und Weiblichkeit, was unter Geschlechtsdifferenz, unter Heteronormativität und Geschlechtsdissidenz verstanden sein soll, er will in das gesamte Leben der Geschlechter regulativ eingreifen, bis hinein in intimste Wertigkeiten (Bourdieu, 1992a). Hier wurde bis vor 30 Jahren noch entschieden, wer sich ohne strafrechtliche Verfolgung lieben, und neuerdings auch, wer rechtlich abgesichert heiraten darf. Der zeitepochale gesellschaftliche Diskurs will geschlechtersensible Optionen beruflicher Karrieremöglichkeiten fixieren, vergütungsrechtliche Machtdynamiken installieren, das Sexual- und Reproduktionsgeschehen, Abstammungsverhältnisse und das Sorgerecht bis ins Detail geregelt wissen.
Spätestens in der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschlechtlichkeit also verlässt das Individuum die eben noch diskutierten Möglichkeiten intimen eigenleiblichen Spürens und tritt ein in die Gefahrenzone gesellschaftlicher und sozialer Okkupation. Plessner (1965) konstatiert, dass der Mensch in einer exzentrischen Position jeweils darüber zu bestimmen hat, ob er einen Körper hat oder Leib ist, bei Husserl (1913) wird der Leib als Umschlagstelle zwischen Natur und Kultur charakterisiert, bei Merleau-Ponty (1966) taucht im selben Zusammenhang der Begriff der Ambiguität auf, obwohl er in der Geschlechtlichkeit die primäre Intentionalität des Menschen sieht.
Während Einigkeit darüber zu bestehen scheint, dass der Leib weder der einen noch der anderen geschlechtlichen Kategorie zuzuordnen ist, stößt man im Versuch, aus der breit entwickelten französischen und deutschen Phänomenologie Aussagen über die leibliche Wahrnehmung von Geschlechtlichkeit zu erfahren, auf die erstaunliche Tatsache, dass Untersuchungen hierüber vernachlässigt worden sind. Wie ist es möglich, dass Leibsein nicht von vornherein und grundsätzlich geschlechtlich verstanden und differenziert wurde? Wie ist es möglich, dass beim Bewusstsein über die kulturelle Dimension der Leiblichkeit die Geschlechtlichkeit nicht von Beginn an mitgedacht wurde? Der Schrecken, dass der intimste Bereich menschlichen Spürens und lustvoller Existenz gleichzeitig Austragungsort destruktivster persönlicher und gesellschaftlicher Macht- und Kontrolldynamiken darstellt, mag einen der am weitesten tabuisierten Gründe hierfür darstellen.
Im Hinsehen auf Geschlechtlichkeit taucht die heikle Frage auf, ob das Geschlecht im biologischen Sinn „Natur“ oder epigenetisch als Resultat der Sozialisation verstanden werden soll. Während für soziale und gesellschaftliche Zuschreibungen im geschlechtlichen Sinn in allen Fällen Zweiteres gilt, finden wir in der Unbestimmtheit des Begriffes „Natur“ den Kampfschauplatz der sogenannten Genderdebatte unserer Zeit wieder. Das Kernproblem dabei ist, dass gesellschaftlich-kulturelle Erwartungen oder Zuschreibungen geschlechtlicher Eigenschaften historisch an körperlichen Merkmalen festgemacht wurden, ähnlich denen des Rassismus. Zwei machtvolle Diskurse, einer die Natur, der andere die Kultur betreffend, beanspruchen – sozusagen über den Kopf des Subjekts hinweg –, dessen Leiblichkeit bestimmen zu wollen. Es ist seltsam, wie wenig bei allem Reden über Emanzipation das Subjekt, egal, ob männlich, weiblich oder X, sein eigenleibliches Spüren gegen beide Ansprüche zu verteidigen vermag. Die Auflehnung gegen solche Okkupation scheint nur durch persönliche Revolte möglich zu sein (Camus, 1953).
Unter leibphänomenologischer Sicht indessen wird „Natur“ nicht gleichgesetzt mit „Biologie“, noch weniger mit „Kultur“. Zwischen dem naturwissenschaftlich bestimmten Körper (Geschlechtskörper) und gesellschaftlich präformatierten Geschlechtsrollen (Geschlechtsidentität) befindet sich ein durch Zeugnisse der Wahrnehmung und des eigenleiblichen Spürens der Geschlechtlichkeit subjektiv und phänomenologisch wahrgenommener Leib (Geschlechtsleib). Nur diese, als subjektive Natur verstandene, Erfahrung soll in diesem Kapitel nun Gegenstand der weiteren Auseinandersetzung hinsichtlich des Begriffes „Natur“ sein (vgl. Gahlings, 2016; Böhme, 2017; Schigl, 2012).
Zum Subjektsein gehören unverbrüchlich dreierlei elementare Wahrnehmungen der Geschlechtlichkeit: erstens die Fremdwahrnehmung, zweitens das Wahrnehmen und Spüren am eigenen Leib und drittens die psychosoziale Konstruktion eigener Vorstellungen hierzu. Diese Reihenfolge ist diejenige, die der menschlichen Entwicklung entspricht, und aus ihr leiten sich bereits einige der zentralen Problemstellungen ab, die mit Sex (als biologischem Körper) und Gender (als sozialkonstruktivistischem, behavioralem Geschehen) in Zusammenhang stehen.
Unabhängig davon, wohin die Identitätskonstruktion im Leben eines Menschen sich entwickeln mag, geht die erste geschlechtersensible Projektion auf den Leib aus der sozialen Umgebung als Fremdwahrnehmung des morphologischen Geschlechts hervor. Drei weitere Ebenen der Bestimmung des biologischen Geschlechts – genetisch, hormonell, neuronal – bleiben davon zunächst unberührt. Sie kommen erst beim Auftreten ernster Fragen um das Geschlecht zum Vorschein, dann meistens im medizinischen Kontext (Steins, 2010). Insofern zeigt sich Geschlechtlichkeit zu Beginn des Lebens als etwas „Pathisches“, als etwas, das einem widerfährt (Böhme, 2017).
Mit dieser ersten Projektion wird der Mensch in einen dichten Schleier sozialer, kultureller und zeitepochal imprägnierter Erwartungen und Stereotypien gehüllt, mit denen er sich hinsichtlich der Konstruktion seiner Gender Identity lebenslang auseinandersetzen wird. Das sind Eigenschafts-, Fähigkeits- und Rollenzuschreibungen, Verhaltens- und Attributionserwartungen, stereotype Orientierungen in Richtung Beziehungsstile, Anpassung, Dominanz und Wertepräferenzen (Asendorpf, 2007). Ein opulentes, machtvolles Geschehen also, das mit seinen Definitionsansprüchen den Gefühlen und Präferenzen, den späteren Selbstwahrnehmungen, den geschlechtsleiblichen Erfahrungen und sexuellen Präferenzen des Individuums recht unempfindlich gegenübersteht.
Bis das Subjekt in Richtung möglicher Definitionen geschlechtsleiblicher Selbstzuschreibungen erwacht, eigene Rollen und Präferenzen konstruieren und vertreten lernt, vergehen gute zehn Jahre, in denen es diese Stereotypien – nicht nur passiv, sondern auch produktiv zwar, aber doch intensiv – in sein Selbst-, Fremd- und Weltbild aufnimmt. Mit Hermann Schmitz (2007a) kann man hinsichtlich dieses Prozesses auch von der Einleibung geschlechtssensibler Erwartungen sprechen, aus der heraus die Epigenese einer Geschlechtsidentität und -leiblichkeit hervorgeht. Von den Stereotypien abweichendes Verhalten wird derweil von den beiden Geschlechtern bilateral sanktioniert, vor allen Dingen in den Peergroups, die in dieser Hinsicht in unserer Kultur zum Teil eine radikalere Sozialisationsagentur darstellen als Eltern und Großeltern. Um in seiner Umgebung überleben zu können, wird das Subjekt sich zunächst diesen Erwartungen anpassen müssen, eine Revolte – so sie denn nötig wird – kommt, wenn überhaupt, erst später.
Dabei darf nicht vergessen werden, dass geschlechtersensible Präferenzen auch jenseits sozialisativer Einflüsse auftreten. Hierzu einige Beispiele: Säuglinge und Kleinkinder etwa zeigen eine Bevorzugung für gleichgeschlechtliche Spielpartner. Obwohl sie konzeptuell noch kein Geschlechtsbewusstsein besitzen, können sie eine Wahl treffen, die über motorische und stimmliche Aktivitätskonturen, die sich bei den Geschlechtern schon früh unterscheiden, prozedural selektiert wird. Auch olfaktorische Wahrnehmungen spielen hierbei eine Rolle (Hatt & Dee, 2009). In ähnlicher Weise sind Präferenzen für geschlechtersensibles Spielzeug und Kleidung zu verstehen, die weit vor jeder bewussten Repräsentation des eigenen Geschlechts auftreten. Phänomene der ,Geschlechtsapartheid‘ in der späten Kindheit können noch als Ausdruck evolutionärer Schemata gedeutet werden, obwohl hier freilich sozialisative Einflüsse schon deutlicher gegeben sind (mehr hierzu bei Bischof-Köhler, 2004, 2011 sowie bei Steins, 2010).
Muster von Weiblichkeit und Männlichkeit tradieren in der Regel subtil sozialisativ, weil die kulturelle Umgebung stereotype Rollen- und Funktionsverteilungen als „normal“ attribuiert und sie so verstärkt. Um Veränderungen bewirken zu können, sind daher langfristige mentale und gesellschaftliche Umarbeitungen bei den Geschlechtern vonnöten. Weder Frauen noch Männer noch X können im Denken wirklich auf die andere Seite kultureller Stereotypie oder Geschlechtsleiblichkeit gelangen. Nur eine diesbezügliche Hyperreflexivität und eine grundlegende – nicht nur auf die Variable „Geschlecht“ oder „Gender“ bezogene – Wertschätzung der Andersheit des Anderen (Baudrillard, 2016; Lévinas, 1998) zeigen somit ein Schlupfloch in Richtung einer ausgeglicheneren Diskursivität und eines breiteren Diversitätsverstehens auf (Landweer et al., 2012).
Dabei ist problematisch, dass in der ,Genderdebatte‘ zwischen dem biologischen Körper und der sozialen Konstruktion konzeptuell keine subjektive Leibwahrnehmung verankert wurde. Die subjektiv-leibliche Erfahrung, das Spüren von Geschlechtlichkeit am eigenen Leib wurden – wie die Leiblichkeit ganz generell – zeitepochal ausgeblendet (Gahlings, 2016). Demnach muss jeder einzelne Mensch sich ganz allein irgendwie im Geflecht körperlicher Gegebenheiten und gesellschaftlicher Zumutungen und Symbole zurechtfinden. Aufgrund dieser artifiziellen, entfremdeten Dichotomie ist in unserer Zeit hier alles prekär, fragil und voller Zweifel und erzeugt ein massenhaftes Unbehagen der Geschlechter (Böhme, 2017; Butler, 1991).
Ein historischer Grund hierfür liegt in der Tatsache, dass in unserer Kultur die leiblich und sozial wahrnehmbare Geschlechterdifferenz zur Grundlage einer Herrschaftsbeziehung durch das Männliche wurde. Simone de Beauvoir (1951) hat mit ihrem Werk Das andere Geschlecht die anhaltende und inzwischen blühende Debatte über die soziale Konstruktion des Geschlechts in Gang gebracht, die Zuschreibungen und Stereotypien dekonstruiert und sie in liberalere, vielfältige Formen bringt. Diese Bewegung wurde durch den Feminismus fortgeführt (Butler, 1991; Pasero & Weinbach, 2003; Illouz, 2007; Stoller, 2010), wobei auch männliche Vertreter am Dekonstruktivismus mitarbeiten (Bourdieu, 2012; Foucault, 1989a; Lyotard, 2015; Derrida, 2012; Kucklick, 2008).
Die Emanzipationsbewegung, als Versuch der Frauen, sich aus den Deutungen dieser Herrschaftsbeziehung zu befreien, hat Festschreibungen in unserer Kultur relativ erfolgreich in Frage gestellt. Resultat dieser ersten Bewegung war die begriffliche Differenzierung von sex und gender. Durch biologistische und evolutionäre Deutungen kamen hergebrachte stereotype Zuschreibungen von Frau und Mann jedoch durch die Hintertür wieder herein. Dies führte dazu, dass das Biologische an sich zuletzt als soziale Zuschreibung dekonstruiert wurde. Judith Butler (1991, 1997) und Ursula Pasero (Pasero & Weinbach, 2003) kritisierten, dass nicht nur das soziale Geschlecht eine gesellschaftliche Konstruktion, sondern auch das Biologische eine kulturelle Interpretation sei. Was man im Rahmen des sozialen Geschlechts (gender) leben könne, sei wiederum abhängig davon, welche körperlichen Möglichkeiten (sex) man habe – und diese würden in derselben Weise interpretiert und selektiert. Durch Ute Gahlings (2016) phänomenologische Ausarbeitungen der weiblichen Leiblichkeit wurde der Missing Link zwischen dem biologischen Körper und den Konstrukten der Sozialisation geschaffen (vgl. hierzu Orth, 2002).
Die Wirkung kultureller Genderformen ist indes nicht bloß repressiv, sie stellt für das Subjekt natürlich auch Orientierungen zur Verfügung. Die radikale Dekonstruktion von Genderformen kann dazu führen, dass der einzelne Mensch den leiblichen Erfahrungen seiner Geschlechtlichkeit, seiner ,Natur‘ im phänomenologischen Sinn, gewissermaßen nackt ausgeliefert ist (Böhme, 2017). Hier wird deutlich, dass geschlechtersensible Determinierungen nicht beliebig manipulierbar sind. Wenn der Leib die „Natur ist, die wir selbst sind“ (ders., 2013), wird unter der Deutung von Judith Butler Geschlechtlichkeit entleiblicht und radikal in den sozialen Raum verschoben. Es bleibt somit völlig offen, in welcher Form sie dann noch Natur sein kann bzw. ob Begriff und Inhalt von Natur als eigenleibliches Spüren überhaupt noch wertfrei differenziert werden können.
Emanzipation dagegen hieß schon immer frei werden von Natur‘, eine Transformation des Gegebenen in das Gemachte. Schon in der Nikomachischen Ethik Aristoteles‘ (2009) liegt das Menschsein nicht in den leiblichen Trieben, sondern in deren Überwindung durch die Vernunft. Und bestimmend für den politischen Menschen im damalig modernen Staat stand nicht das Ich, sondern das Wir. Entsprechend gilt in der christlichen Mystik als das Höchste des Menschen auch nicht der Leib, sondern seine Seele. Die Emanzipation vom Tier zum Menschen vollzieht sich in diesem Denken also größtenteils durch die Kontrolle und Verneinung von Leiblichkeit und Natur. Erst dies verlieh dem Menschen Würde. Das steht im heutigen Verständnis kontraversiell der Tatsache gegenüber, dass dem menschlichen Leib als solchem ethisch schon Würde zukommt.
Hinsichtlich der Theorien der Geschlechter ist den Theoretikerinnen der Differenz (Irigaray, 1991; Derrida, 2012, 2013) insofern Vorrang zu geben, als sie Unterschiede der Geschlechtsleiblichkeit weder ignorieren noch wegarbeiten, sondern die Differenz gerade dadurch aufwerten, dass sie jeder Form ihren eigenen Raum und ihr eigenes Gewicht geben. Geschlechtlichkeit wird hier nicht als etwas Sekundäres, als Epiphänomen, gesehen, sondern als primäre leibliche Existenzform des Menschen. Luce Irigaray hat in ihrem letzten Werk (2010) diese Vorstellung in ein Programm gestellt: Welt teilen.
So wird deutlich, dass die Zuordnung zu einem Geschlecht und dessen Bewertung eng mit herrschenden Machtstrukturen verbunden sind (Bourdieu, 2012; Han, 2005; Foucault, 2005). Der Diskurs über diversifizierte Formen von Geschlechtsleiblichkeit kann nicht mehr als individualisierte Kategorie betrachtet werden. Er ist in Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und Wissenschaft eingedrungen und verleiht der Moderne ihren Charakter. Dabei ist die Epoche, in der, neben deskriptiven und präskriptiven Stereotypien von Frau und Mann, alle darüber hinausgehenden anderen Erscheinungsformen von Geschlechtsleiblichkeit verleugnet und tabuisiert wurden, zu Ende gegangen. Zumindest in Deutschland wurde im Erscheinungsjahr dieses Buches das dritte Geschlecht gesetzlich anerkannt. Machtdiskurse sind implizit immer auch Diskurse der Freiheit (Höffe, 2015), ein zentraler Wert unserer Gesellschaft. Aber: „Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden“ (Luxemburg, 1918). Der Diskurs über Vorstellungen von Geschlechtsleiblichkeit ist daher nicht nur eine individuelle Angelegenheit, sondern immer auch eine politische Bewegung.
Das Ansinnen der Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann im Feld der Familie und Arbeit sowie der Zugang zu ökonomischen Ressourcen oder die Verminderung sexueller Diskriminierung – von Frau und Mann und X – stellen dabei nur die historische Spitze des Eisbergs dar. (Freilich, je nachdem, wo man sich in Europa aufhält, ist selbst dieser Prozess noch immer weit offen.) Im weiteren Sinne aber geht es um die Anerkennung von Vielfalt und Diversität – Anerkennung des Anderen (Baudrillard, 2016) –, nicht nur im Rahmen von Gender Diversity, sondern auch von Culture Diversity, von Personal Diversity, um Pluralismus also (Lyotard, 2015).
Die Vertretung subjektiver Geschlechtsleiblichkeit ist immer ganz allein dem Individuum aufgebürdet. Nicht alle Menschen empfinden das als ,Freiheit‘, vielen fehlen die Ressourcen hierzu (Höffe, 2015). Zweigeschlechtlichkeit stellt sich trotz der gesetzlichen Änderungen als ein empirisches Faktum dar, das Menschen mit diversifizierten Entwürfen ihrer Geschlechtsleiblichkeit auch noch in ihrer Abkehr definiert (Böhme, 2017). Soziale Umgebungen können beachtlichen Widerstand leisten, Ängste, Ignoranz und Abwertung stehen dem Ansinnen friedlicher Andersheit oft scharfkantig im Weg. Dies trifft auf die große Gruppe geschlechtsdissidenter Menschen zu; „Queer-Sexuals“: Schwule, Lesben, Bi-, Inter-, Pansexuelle und Asexuelle, Transgender, BDSMler (Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism) sowie Menschen, die Polyamourie praktizieren. Erst in den 1980er Jahren wurden sie aus den Kategorien psychiatrischer Zuschreibungen von Perversität, aus internationalen Klassifikationsschemata herausgenommen.