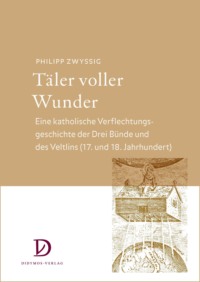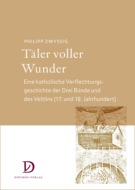Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 11
2.3.2. Diskurse und Semantiken
Die über die verschiedenen, sich ergänzenden, teilweise aber auch konkurrenzierenden Kommunikationskanäle in Rom eingetroffenen Informationen waren vielfältig und reichten von der Schilderung der aktuellen politischen Vorgänge über geographische und historische Betrachtungen bis hin zu personellen Auskünften. Trotz der situativen Bedingtheit dieser Informationen verdichtete sich in Rom das Bild der Verhältnisse im rätischen Alpenraum, vor allem, was dessen religiösen und konfessionellen Besonderheiten anbetraf. Verschiedene Akteure, allen voran die Missionare der rätischen Mission, hatten ein Interesse daran, die lokalen Sitten und Bräuche zu beschreiben, um daraus Strategien für eine adäquate Religionspolitik abzuleiten und – nicht minder wichtig – bestimmte Vorgehensweisen zu legitimieren. Im Folgenden soll untersucht werden, welche zeit- und kontextspezifischen Semantiken und Argumentationen sich dabei etablierten, wie also in den Korrespondenzen und Missionsberichten über die religiösen Verhältnisse im rätischen Alpenraum gesprochen wurde.402 Diese Semantiken werden vorerst deskriptiv zu rekonstruieren und in die entsprechenden Kommunikationszusammenhänge einzuordnen versucht, ohne ausführlich auf die dahinterstehenden Interessen und Handlungslogiken einzugehen. Für Letzteres wird es in Kapitel 2.4. Gelegenheit geben.
2.3.2.1. Vormauer und Einfallstor nach Italien: Semantiken des konfessionellen Grenzraums
Eine in den Korrespondenzen und Denkschriften immer wiederkehrende Charakterisierung der Drei Bünde und des Veltlins bezog sich auf deren konfessionelle Grenzlage. Der Churer Dompropst Christoph Mohr ließ gegenüber Francesco Ingoli verlauten, eine vollumfängliche Restauration des Churer Hochstifts sei dringend notwendig, auch und gerade »weil es an der Grenze zu Italien [liegt], und den katholischen Orten der Eidgenossenschaft als Vormauer und Gegengewicht gegen die protestantischen Kantone dient«403. Carlo Pestalozza verglich die Grafschaft Chiavenna mit einem »Tor zu Italien, zu Deutschland, Frankreich und den Niederlanden«404. Kardinal Marzio Ginetti (1585–1671) wiederum betonte, die rätischen Alpen bildeten die äußerste Grenze Italiens und des katholischen Glaubens.405 Und die Gemeinde Mesocco empfahl sich der Protektion der Propagandakongregation mit dem Argument, sie befinde sich »an der Grenze zu den Protestanten«406.
Ob »Grenze«, »Vormauer« oder »Tor zu Italien« – jeder dieser Begriffe versuchte der besonderen konfessionspolitischen Konstellation im rätischen Alpenraum gerecht zu werden. Im Zuge der kommunalen Bewegung der 1520er-Jahre wurden nämlich nicht nur die alten Herrschaftsträger, darunter auch der Bischof von Chur, nach und nach ausgeschaltet, sondern ein im Kontext der Ilanzer Disputation von 1526 erfolgter Bundestagsbeschluss schrieb überdies die freie Konfessionswahl fest.407 Damit konnte sich im Prinzip jedes Individuum nach eigener Gewissensprüfung frei zu einer Konfession bekennen. In der Praxis blieb diese Freiheit allerdings auf die Konfessionswahl durch die Gemeinde eingeschränkt.408 Wer sich mit dem Mehrheitsentscheid einer Gemeinde nicht abfinden konnte, war zuweilen gezwungen, sich in einer anderen niederzulassen.409 Das Prinzip der kommunalen Freiheit – und dies bedeutete in erster Linie gemeindliche Selbstbestimmung durch Mehrheitsentscheid – stand spätestens im 17. Jahrhundert in vielen Fällen über demjenigen der individuellen Gewissensfreiheit. Nur wo die konfessionelle Minderheit einer Gemeinde groß genug war, um Mitsprache einzufordern, kam es zur paritätischen Nutzung oder aber zur Aufteilung von Kirchen und Pfrundvermögen.410 Die Gewissensfreiheit in Verbindung mit dem kommunalen Entscheidungsfindungsprozess führte dazu, dass sich im 16. Jahrhundert rund zwei Drittel aller Kirchgemeinden in den Drei Bünden zur protestantischen Kirche bekannten. Die von Ulrich Pfister rekonstruierte konfessionelle Geographie der Drei Bünde glich folglich einem Flickenteppich: Die Konfession konnte von Tal zu Tal, von Gemeinde zu Gemeinde und in Einzelfällen auch von Haustür zu Haustür verschieden sein.411
Anders gestaltete sich die Situation im Veltlin. Dort fanden die Ideen der Reformation – mit Ausnahme in der Grafschaft Chiavenna, wo sich wegen der garantierten Konfessionsfreiheit zahlreiche italienische Glaubensflüchtlinge niedergelassen hatten412 – weitaus geringeren Anklang. Eine Erklärung hierfür hat man in der ebenfalls sehr hohen Autonomie der Gemeinden gefunden.413 Diese reglementierten noch etwas strikter als ihre Pendants in den Drei Bünden das kirchlich-religiöse Leben. So gaben die Tal- respektive Gemeindestatuten vor, welche kirchlichen Festtage eingehalten werden mussten und welche Konsequenzen bei Zuwiderhandlung drohten.414 Ein Verstoß gegen diese gemeindekirchlichen Gebote kam einer Nichtbeachtung kommunalen Zivilrechts gleich. Damit besaßen die Gemeinden rechtlich verbriefte Sanktionsmittel, um gegen jeglichen religiösen Dissens – das heißt von der herrschenden Glaubenspraxis abweichende Haltungen und Handlungen – vorzugehen und unter dem Vorwand der kommunalen Kohäsion eine konfessionelle Homogenität herbeizuführen. Aus diesem Grund blieb das Bekenntnis zum protestantischen Glauben im Veltlin und den beiden Grafschaften Bormio und Chiavenna auf eine überschaubare Gruppe, bestehend aus italienischen Dissidenten, den Bündner Amtsträgern, ihren Dienstleuten und einigen verwandtschaftlich mit protestantischen Bergellern oder Engadinern verbundenen Veltliner Familien, beschränkt. Angesichts dessen erschien das Veltlin als katholische Bastion, als eine Art Sperrriegel gegen den protestantischen und aus katholischer Sicht deshalb »häretischen« Norden. Aufgrund der Lage an der Grenze zu Italien sprachen die Entscheidungsträger am päpstlichen Hof ebenso wie die Habsburgermächte dem Veltlin mehr als nur eine lokalpolitische Relevanz zu, galt es doch hier Italien, das religiöse Zentrum der katholischen Christenheit, gegen die protestantische »Häresie« zu verteidigen.415
Diese Zusammenhänge vor Augen, unterstützte die spanische Krone im Jahr 1620 den Aufstand der Veltliner gegen die Bündner Herrschaft (je nach Standpunkt »Veltliner Mord« oder sacro macello genannt).416 In den daran anschließenden langwierigen politischen und militärischen Auseinandersetzungen, ausgetragen auch zwischen den beiden europäischen Großmächten Frankreich und Spanien, wurden die Metaphern »Grenze und »Vormauer«417 zu zentralen Leitkategorien politischen Handelns, indem nämlich der Kampf gegen die weitere Ausbreitung des Protestantismus gegen Süden als Legitimation für das Eingreifen in den eigentlich internen Herrschaftskonflikt angeführt wurde.418
Diese proaktive Interventionspolitik fand mit dem Mailänder Kapitulat von 1639 ein Ende, wobei damit zwar die ursprünglichen Herrschaftsverhältnisse wiederhergestellt waren, erstmals aber die konfessionelle Homogenität festgeschrieben, das heißt die freie Ausübung des protestantischen Glaubens in den Untertanengebieten verboten wurde. Spanien wurde als Garant dieser Bestimmungen eingesetzt, erfüllte diese Rolle aber nach Meinung katholischer Beobachter nur ungenügend. »Ewiger Streitpunkt«419 waren die Vertragsbestimmungen, wonach Bündner protestantischer Konfession als Amtsträger zugelassen waren und die vertriebenen Veltliner Protestanten ihren Besitz behalten und während einer gewissen Zeit auch bewirtschaften durften.420 Aus kirchlichen Kreisen wurde unermüdlich darauf hingewiesen, dass das Niederlassungsverbot für Protestanten so faktisch umgangen werde, wobei hierfür nun genau jene Argumentation übernommen wurde, die zuvor die spanische Krone für ihre Interventionspolitik ins Feld geführt hatte. Nuntius Carafa rief 1654 die Wichtigkeit der Veltlinfrage in Erinnerung, indem er betonte, mit einer konsequenten Umsetzung des Kapitulats könne sich Italien sicher sein, dass es »an seinen Toren nicht von Häresie wimmelt«421. 1670 entsandte das corpus catholicum der Drei Bünde eine Abordnung nach Mailand, um die Verstöße der Protestanten gegen das Mailänder Kapitulat anzuzeigen. In zugespitzter Weise hielt der entsprechende Bericht fest, der katholische Glaube werde aus der Region verdrängt, wenn nicht bald effiziente Hilfe von spanischer Seite versprochen werde.422 Dadurch drohe die Gefahr, dass die »Häresie« nicht nur das Veltlin, sondern auch Italien infiltriere; verliere man diese Region an die Protestanten, so gebe Italien sein Zugangstor aus der Hand.423 Jeder könne es sich leicht ausdenken, präzisierte der Churer Bischof, dass aus einer solchen Entwicklung auch für Italien Nachteile erwachsen würden, sei doch das Veltlin »die einzige Vormauer«424 Italiens.
Hervorgegangen aus dem Veltlinkonflikt, entwickelte sich die Tor- oder Grenzmetapher zu einem gebräuchlichen Argument, wenn es darum ging, Unterstützung für die katholische Kirche im rätischen Alpenraum zu erwirken. Helfe man seiner Heimat, so helfe man gleichzeitig Italien, gab Christian de Jochberg, der Pfarrer von Vella, einem Kardinal der Propagandakongregation zu verstehen.425 Und der Kapuziner Cristoforo da Toscolano, der im Auftrag des Churer Bischofs am päpstlichen Hof um Protektion und finanzielle Hilfe für die Bündner Katholiken bitten sollte, wies ebenfalls sehr pointiert auf die Grenzlage hin. Er schrieb an Francesco Ingoli:
»Das Bistum [Chur] bedarf größter Aufmerksamkeit […], und zwar sowohl wegen des geistlichen als auch des weltlichen Friedens in Italien, weil es gleichsam eine Mauer an den Grenzen zum Erzbistum von Mailand, den Bistümern von Como, Bergamo und Brescia bildet; sollte man diese [Mauer] verlieren, was Gott verhindern möge, so ist sicher, dass die Häresie mit all ihren schlimmen Folgen diese Bistümer heimsuchen wird.«426
An diese Argumentation anknüpfend, schilderten die katholischen Räte der Drei Bünde der Propagandakongregation einige politische Vorstöße der evangelischen Synode wie folgt:
»[…] [die Bedrängung der Katholiken durch die Protestanten ist] zum großen Schaden und eine große Gefahr für Italien, in das die Häresie viel einfacher eindringen kann. Wenn man diese Türen zuschlagen will, so erachten wir die Rückkehr von Pater Cristoforo da Toscolano als das nützlichste Mittel; er hat während vieler Jahre zur vollsten Zufriedenheit in der Mission gedient.«427
So wie hier, waren mit dem Hinweis auf die besondere Funktion der Region als »Türe« oder »Tor Italiens« fast immer konkrete Forderungen verbunden – hier die Rückkehr eines in seine Heimatprovinz zurückberufenen Kapuziners. Für solche Bittschriften war die Tor- oder Grenzmetapher insofern ein stichhaltiges und erfolgversprechendes Argument, als die Entscheidungsträger in Rom ebenso wie die Senatoren in Mailand kaum etwas dagegen einzuwenden hatten, denn sie selbst hatten ihre Interventionen in den Drei Bünden und dem Veltlin damit gerechtfertigt. Es bestand also weitgehend ein (argumentativer) Grundkonsens darüber, dass der rätische Alpenraum von größter religionspolitischer Relevanz für Italien, wenn nicht sogar für ganz Europa war.
Während die Rede vom »Einfallstor« in den 1620er- und 1630er-Jahren handlungsanleitend für Akteure der Politik und des Militärs war, wurde sie es nun ab den 1640er-Jahren auch für jene, die sich der Erneuerung des religiösen Lebens widmeten. Der Churer Domkustos Bernardino Gaudenzi lobte 1645, es sei »ein heiliges Werk, dass die Heilige Propagandakongregation einige beispielhafte Missionare in diese Gegend, [also] gewissermaßen an die Tore Italiens, geschickt«428 habe. Und in der 1702 veröffentlichten Geschichte der rätischen Mission von Clemente da Brescia ist zu lesen, die Kapuziner würden Missionare in alle Teile der Welt schicken, um den katholischen Glauben bei Ungläubigen bekannt zu machen, so etwa bei den Muslimen in Palästina, außerdem in Ägypten, Asien, Persien, Armenien, Amerika etc. Nicht weniger wichtig seien aber die Missionen im rätischen Alpenraum, weil dieser »das Tor zu Italien ist, das folglich gut bewacht werden muss«429. Noch in den 1720er-Jahren brachte der Nuntius in Luzern die Notwendigkeit der rätischen Mission mit der konfessionellen Grenzsituation in Verbindung. Er schrieb:
»[…] betrachtet man die Qualität des Ortes, den man als Vormauer oder Tor Italiens bezeichnen kann, so ist hinzuzufügen, dass es nicht genügend Vorkehrungen geben kann, um den Vorstoß der Häresie, die sich bereits wenige Jahre nach dem Kapitulat [von 1639] wieder im Veltlin und in Chiavenna auszubreiten begann, in dieser Region zu bremsen.«430
Mit den angesprochenen Vorkehrungen meinte Nuntius Passionei die Überprüfung der Missionare durch die Nuntien. Nur die integersten und eifrigsten Kapuzinerbrüder sollten an die Grenze zur Häresie geschickt werden. Den Kapuzinern der rätischen Mission schrieb man insgesamt eine zentrale Bedeutung für die Aufrechterhaltung dieses »Schutzwalls« zu. Einerseits galten sie als die an der Basis operierende Speerspitze der Gegenreformation, welche Konversionen herbeiführen und somit verlorenes Gebiet wieder zurückerobern sollte. Andererseits sollten sie den Glauben der Katholiken und deren Widerständigkeit gegen den protestantischen Einfluss stärken. Für die Beschreibung und Legitimierung beider Aufgaben etablierten sich bestimmte, immer wieder bemühte Semantiken, denen die folgenden Abschnitte nachgehen.
2.3.2.2. Häretische Seuche und Hexerei:Semantiken der religiösen Vielfalt
Für die Bedrohungslage an den Rändern Italiens schien vielen katholischen Beobachtern kein Sprachbild so treffend wie die Gefahr einer Ansteckung durch die »Krankheit« der »Häresie«. Im kirchlichen Sprachgebrauch bezeichnete »Häresie« zunächst alle von der katholischen Kirche abweichenden Glaubenslehren. In diesem Sinne wurden auch die protestantischen Bündner als »Häretiker«, ihr Glauben als »Häresie« beschrieben.431 Anlässlich der Visitation des Veltlins vermeldete Nuntius Farnese 1641, er sei besorgt über die »andauernde Krebserkrankung« im Veltlin, und meinte damit, dass trotz Aufenthaltsverbot nach wie vor Protestanten in der Grafschaft Chiavenna lebten.432 Schon in den frühen 1630er-Jahren zogen die Bewohner von Villa di Chiavenna einen ähnlichen Vergleich heran: Im Umfeld der damals grassierenden Pest gelobte die Gemeinde, eine Kirche zu Ehren der »Madonna des Heils« (Madonna della Salute) – im Volksmund durchaus verstanden im Sinne von »Madonna der Gesundheit« – zu errichten, nicht nur, um so auf ein Ende der tödlichen Krankheit hinzuwirken, sondern auch zur Abwehr der »Pest der Häresie«.433 In Sondrio forderte Erzpriester Paravicini 1654, Rom solle eine »Medizin gegen dieses akute Fieber« finden, um so den sonst sicheren »Tod«, genauer: die »zeitliche und geistige Zerstörung« der katholischen Kirche im Veltlin zu verhindern.434 Wie die Grenzmetapher wurde die Rede von einer ansteckenden Krankheit namens »Häresie« handlungsleitend für Akteure, die sich um die konfessionelle Situation im rätischen Alpenraum besorgt zeigten.
Nicht immer war »Häresie« allerdings konfessionell konnotiert. Der Agent des Mailänder Erzbischofs, der 1656 im Auftrag der Propagandakongregation im Misox Erkundigungen über die Kleriker des Tals einzog, musste feststellen, dass die Bündner darunter etwas ganz anderes verstanden. Fünf katholische Priester stünden unter dem Verdacht der Häresie, was in diesen Dörfern meine, dass sie von (verurteilten) Hexen abstammten.435 Auf der lokalen Ebene war der Häresiediskurs damit eng an den Vorwurf der Hexerei gekoppelt. »Häresie« meinte hier eine teuflische Sekte, deren Werk man im 17. Jahrhundert überall in den Drei Bünden zu erkennen glaubte.436 Als ihre konstituierenden Elemente galten der Schadenzauber (in den Quellen als »Malefiz« bezeichnet) und der Pakt mit dem Teufel, vollzogen im sogenannten »Barlot«, dem Hexensabbat. Diese in der Volkskultur verankerten Vorstellungen zusammen mit dem blutigen Vorgehen der kommunalen Gerichtsbarkeiten gegen Hexen formten das Bild, das man sich außerhalb der Drei Bünde von der religiösen Mentalität der Bündner machte, entscheidend mit. Die Propagandakongregation in Rom erfuhr aus einem Brief des Churer Dompropstes Christoph Mohr von 1655, im Valsertal existiere ein eigentliches »Reich des Satans«437. Er habe, so Mohr, nicht weniger als fünfzig verhexte Personen ausfindig machen können, von denen viele noch im Kindesalter seien. Er halte deshalb eine Mission der Kapuziner in diesem Tal für dringend notwendig.
Der von Mohr assoziierte Zusammenhang zwischen der Kapuzinermission und dem Kampf gegen die satanische Sekte ist, in verschiedensten Variationen, ein gängiger Topos in den Briefen und Berichten aus den Drei Bünden. 1654 beispielsweise informierten die Gemeinden Cama und Lostallo die Propaganda Fide, ein kürzlich durchgeführter Hexenprozess habe eine teuflische Verschwörung gegen die Kapuziner aufgedeckt. Der Satan habe Hexen und Hexer um sich versammelt, um mit einem Hexentanz (»Barlotto«) die Auflösung der Kapuzinermission herbeizuschwören.438 Warum die okkulten Praktiken der teuflischen Sekte sich gerade gegen die Kapuziner richteten, schien den beiden Gemeinden so offensichtlich, dass es nicht explizit ausgesprochen zu werden brauchte: Die Kapuziner besaßen Mittel und Wege, die Macht des Teufels zu bannen, weshalb dieser alle Anstrengungen unternahm, sich die Ordensbrüder vom Leibe zu halten. In diesem Lichte erschienen selbst die einheimischen Priester, von denen sich einige für eine Auflösung der Kapuzinermission aussprachen, als Werkzeug des Teufels, ja es verbreitete sich die Kunde, die von den Weltpriestern gespendeten Sakramente seien ungültig, zumal man bei einigen von ihnen verwandtschaftliche Verbindungen zu Personen nachweisen konnte, die der Hexerei bezichtigt oder gar als Hexen verurteilt worden waren.439
Wie beurteilten die Kardinäle in Rom solche Berichte über die scheinbar allgegenwärtige Präsenz der teuflischen Häresie? Inwiefern erwies sich dieser Hexendiskurs als anschlussfähig an kirchliche Interpretationen der im rätischen Alpenraum vorgefundenen religiösen Kultur? Festzustellen ist zunächst, dass die päpstliche Kurie der blutigen Hexenverfolgung äußerst kritisch gegenüberstand. So überstellte sie zwar die vom Dompropst Mohr der Hexerei bezichtigten Kinder aus dem Valsertal der Inquisition von Mailand, sie tat dies aber in der Absicht, die Kinder dadurch vor dem sicheren Tod zu retten.440 Der Disentiser Benediktiner Carli Decurtins, der bekannt war für seinen kompromisslosen Kampf gegen Hexen, wurde deswegen vor den Nuntius nach Luzern zitiert.441 Und die Propagandakongregation gab den Misoxern zu verstehen, ihre Angst wegen der von den Weltpriestern gespendeten Sakramente sei vollkommen unbegründet,442 die überall vermutete Hexerei bloßer Aberglaube. Dennoch wäre es verfehlt, den Hexendiskurs vollkommen von der kirchlichen Debatte über die Rechtmäßigkeit bestimmter Glaubensvorstellungen losgelöst zu betrachten. Die in der rätischen Mission tätigen Geistlichen verurteilten zwar zum Teil scharf die blutigen Auswüchse des Hexenglaubens, stellten aber gleichzeitig die damit in Verbindung stehenden religiösen Weltbilder und Praktiken in eine Reihe mit anderen Formen der populären Religiosität, die sie als schädlich einstuften und mit kirchlichen Mitteln bekämpften.443
Der Kapuzinermissionar Stefano da Gubbio hielt in einem Bericht über die Sitten und Bräuche der Bündner fest, Wahrsagerei (divinationi), Aberglauben (superstitioni) und Zauberei (fatuchiarie) seien überall zu finden und würden mit unterschiedlichen Mitteln vollführt, namentlich mit Deutungen von Zeichen (segni; caratteri), durch Natur- und Himmelsbeobachtungen (osservationi), mit Worten (parole) und Gebeten (orationi).444 Allen diesen Praktiken liege die Intention zugrunde, über einen Handel mit dem Teufel Einfluss auf das irdische Geschehen zu nehmen. Anwendung fanden diese Praktiken laut Pater Stefano bei Krankheiten von Menschen und Tieren, um verlorene Dinge wiederzufinden, um Diebe zu stellen, als Mittel gegen Schädlinge, um zu erfahren, wer als erster im Jahr sterbe, oder um den Vater eines unehelich geborenen Kindes ausfindig zu machen. Diese Praktiken, so Pater Stefano, seien so tief in den Köpfen verankert, dass es kaum möglich sei, sie auszumerzen.445 Daher gelte es, aus einer an sich schlechten Sache eine gute zu machen, indem den Bündnern in all den geschilderten Anwendungsfeldern magischer Praktiken die Wirksamkeit der kirchlichen Benediktion vor Augen geführt werde.446 Tatsächlich habe Gott mithilfe von »Sakramentalien«447, insbesondere des Agnus Dei und mit Weihwasser so manches »Wunder«448 bewirkt, sprich Krankheiten geheilt, Diebesgut ausfindig gemacht und böse Geister vertrieben. Die von Pater Stefano als Beweis angeführten Mirakelgeschichten zeugen einerseits von der Bemühung der Kapuziner, den angesprochenen Heils- und Heilungsbedürfnissen der Menschen mit »sakramentaler Magie«449, also mit kirchlichen Heilsmitteln gerecht zu werden, auch in Bereichen, die nicht primär mit der kirchlichen Heilsvermittlung assoziiert wurden.450 Andererseits kommt zum Vorschein, dass die Kapuziner die Sakramentalien ganz bewusst als kirchliche Gegenmittel zur Bekämpfung der mit teuflischer Hilfe praktizierten Zauberei einsetzten. Ein Mann, so Pater Stefano, sei mit seiner vom Teufel besessenen Frau zu ihm gekommen und habe ihn um einige gesegnete Gegenstände gebeten. Als er sich die Stola überzog, um die Gegenstände zu segnen, habe sich die Frau kräftig dagegen gewehrt und gebrüllt, sie wolle diese Gegenstände nicht – ein eindeutiges Zeichen, dass der Teufel sich durch Sakramentalien belästigt fühle, so Pater Stefano.451 Eine weitere Geschichte erzählt, wie eine gewisse Anna Durico aus Parsonz, vom Kapuziner über die Schädlichkeit von Zauberei aufgeklärt, eine Wurzel vernichten wollte, die ihr von Zigeunern als Mittel gegen Brandgefahr verkauft worden war. Sie habe die Wurzel ins Feuer geworfen, diese sei aber, wohl mithilfe des Teufels, mehrere Male wieder herausgesprungen; erst als sie die Wurzel und das Feuer mit geweihtem Wasser besprengt habe, sei sie verbrannt.452 Über solche Geschichten erarbeiteten sich die Kapuziner, ferner auch die als Apostolische Missionare agierenden Weltpriester,453 einen Ruf als religiöse Spezialisten im Kampf gegen Hexerei und Aberglauben. Aus den Hexenprozessakten geht hervor, dass ihre Exorzismen, also ihre mit gesegneten Gegenständen und Gebetsformeln vollzogenen apotropäischen Handlungen, sehr gefragt waren.454 Gerade damit bedienten die Missionare aber den Hexenglauben der ländlichen Bevölkerung und trugen so womöglich das Ihrige zur Hexenverfolgung im 17. Jahrhundert bei.
Das Hexereiverständnis der Missionare, wie es aus den nach Rom gesandten Berichten hervorgeht, kann als Versuch gewertet werden, im Rückgriff auf den Hexenglauben der ländlichen Bevölkerung sämtliche nicht-kirchengebundenen Formen der Religiosität als Werk des Satans zu diskreditieren. Sofern es den Missionaren gelang, gesegnete Gegenstände und den Ritus des Exorzismus als wirksame Mittel gegen Schadenzauber und andere Praktiken der »Alltagsmagie«455 zu etablieren, diente der Kampf gegen das angeblich ausgeprägte Hexenwesen der Verkirchlichung »popularer«456 Glaubensvorstellungen. Dies zeigte sich in jenen Fällen, bei denen die Kapuziner zwar die popularen Heilsmittel durch kirchliche ersetzten, nichts aber an der Wirkung und am Verwendungskontext änderten: Anstelle der als Teufelszeug betrachteten Zigeunerwurzel empfahlen sie das Agnus Dei als Schutz vor Dämonen, Hexen und Bränden,457 sodass man mit Hillard von Thiessen von einer »Marginalisierung der Alltagsmagie durch Sakramentalien«458 sprechen kann. Im Kontext der Mission stand der Hexendiskurs damit ganz im Zeichen des kirchlichen Vorgehens gegen den »Aberglauben« (superstizione). Er wurde dazu gebraucht, um die nicht nur kirchlich geformte religiöse Mentalität der Bündner begrifflich zu fassen und gleichzeitig die Notwendigkeit der innerkatholischen Mission vor Augen zu führen. In einem Bericht über die Kapuzinermission im Misox wird dies folgendermaßen auf den Punkt gebracht:
»Dieses [Tal Misox] war mit vielen Häresien übersät und ferner herrschten hier viel Hexerei und Zauberei, weil [das Tal] an das Land der Häretiker [Protestanten] angrenzt; der Grund hierfür war hauptsächlich der Mangel an guten und gewissenhaften Pastoren der Kirche, welche diese Seelen kultivierten, ferner waren beinahe alle Kirchen verfallen und schlecht ausgerüstet mit Messgewändern und liturgischem Gerät, sodass der Gottesdienst zu einem solchen Elend und Unglück herabgesetzt war, sodass man darin nur wenige Überreste des wahren und katholischen Glaubens erkennen konnte.
[…] die Missionare haben mit ihrer Anstrengung und mit göttlicher Hilfe diese Seelen dermaßen kultiviert, dass sie alle Häresien ausrotten und die Hexerei, Zauberei und andere schlechte Sitten zumindest zu einem großen Teil verbannen konnten; wo sie [die Kapuziner] eingeführt wurden, kann man sagen, dass dieses Dorf jetzt auf einer Stufe steht mit einem blühenden Christentum […].«459
Wie hier im Misox sahen sich die Kapuziner im ganzen Missionsgebiet mit einer pluralen religiösen Kultur konfrontiert, die sich nicht ausschließlich mit kirchlichen Kategorien fassen ließ. Ein nicht zu unterschätzender Teil des Heils- und Heilungsangebotes bewegte sich am Rande des kirchlich Erlaubten oder gar darüber hinaus und wurde deshalb als »Hexerei« und »Zauberei« beschrieben. Dies wirkte sich letztlich auch darauf aus, wie die Bündner Katholiken, ihre kirchliche Glaubenspraxis und ihr Kirchenverständnis zunächst von den Missionaren, dann auch von den römischen Institutionen wahrgenommen wurden.