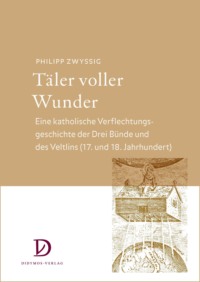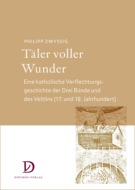Kitabı oku: «Täler voller Wunder», sayfa 2
1.2. Lokale Religion, hybride Glaubensformen und der »lange Arm Roms«: Erkenntnisse und Perspektiven der Forschung zum frühneuzeitlichen Katholizismus
Während Mirakelgeschichten und andere Zeugnisse von Gebetserhörungen lange Zeit fast ausschließlich von der »religiösen Volkskunde«20 als Objekte der Forschung betrachtet wurden, hat sich das Interesse an religiösen Wundern in den letzten Jahrzehnten auch in der Geschichtswissenschaft Bahn gebrochen. Historiker haben erkannt, dass sich aus Wundergeschichten, obgleich sie stets narrativen Konventionen und Erzählintentionen folgten,21 Einsichten in die praktizierte Religiosität und die religiöse Alltagswelt frühneuzeitlicher Individuen gewinnen lassen.22 Gewichtigen Anteil an diesem neuerwachten Forschungsinteresse hatte die Auseinandersetzung mit der von Heinz Schilling und Wolfgang Reinhard formulierten Konfessionalisierungsthese.23 In bewusster Abgrenzung zu deren obrigkeitszentrierten Perspektive auf die Normierung und Uniformierung religiöser Verhaltensweisen formierten sich Forschungsfelder, die den unbestrittenen (qualitativen) Wandel von Kirchlichkeit und Religiosität in der Frühen Neuzeit dort nachzuvollziehen versuchten, wo er sich tatsächlich auch praktisch bemerkbar machte, nämlich in den einzelnen Kirchgemeinden und in den Lebens- und Erfahrungswelten der Menschen.24
Diese forschungsgeschichtliche Entwicklung führte zunächst zu einem besseren Verständnis der (kollektiven) Glaubenspraxis. Für Spanien, Frankreich, Italien und den süddeutschen Raum ist aufgezeigt worden, dass veräußerlichte Formen der Glaubensmanifestation auch in der nachtridentinischen Ära allgegenwärtig waren,25 obschon im Zuge der katholischen Reform universale und verinnerlichte religiöse Wissensbestände über die orts- und objektgebundene Religiosität gestellt wurden.26 Lokalspezifische Heiligenpatronate, Festtage, Prozessionen und Bruderschaften waren nach wie vor fester Bestandteil der religiösen Kultur und gehörten zur Selbstvergewisserung kommunaler Gemeinwesen dazu. In diese kommunale Religiosität miteinbezogen wurden neben den jeweiligen Pfarrkirchen und örtlichen Heiligtümern mitunter auch Kapellen und religiöse Kleindenkmäler (Wegkreuze, Bildstöcke etc.), ferner auch die Natur, etwa in Form sogenannter »heiliger Bäume«.27 Damit prägten örtliche Besonderheiten und weit zurückreichende Kulttraditionen das religiöse Leben in den Kirchgemeinden, ungeachtet der universalisierenden Tendenzen des nachtridentinischen Katholizismus. Vor diesem Hintergrund hat man der tridentinisch erneuerten Kirche ein »Vollzugsdefizit«28, der lokalen Gesellschaft dagegen einen von der Kirchengeschichte ebenso wie von der Konfessionalisierungsforschung unterschätzten Einfluss auf die Ausbildung einer »katholischen« beziehungsweise »konfessionellen Identität«29 bescheinigt. Darüber noch hinausgehend haben Studien zur sogenannten »Volksfrömmigkeit«30 auf Formen der »Widerständigkeit«31 des »Volkes« gegen »obrigkeitlich verordneten Glaubenszwang«32 und religiöse Disziplinierung aufmerksam gemacht, sodass sich insgesamt ein Bild eines spannungsreichen Verhältnisses zwischen dem auf Gemeindeebene praktizierten Glauben und den von der römischen Konfessionskirche vertretenen Frömmigkeitsidealen ergab. Während diese Schlussfolgerung vor allem aus der Untersuchung kollektiver Glaubensmanifestationen resultierte, relativierten kulturhistorische Studien zur (individuellen) religiösen Alltagspraxis indessen die grundsätzliche Unvereinbarkeit von älteren lokalen und neuen, tendenziell universalen Formen katholischer Religiosität. Zwei Themenkomplexe haben sich als erkenntnisleitend herausgestellt: die katholische Mission und die kultische Verehrung von als heilig erachteten, aber nicht (oder noch nicht) heiliggesprochenen Personen.
Forschungen zur sogenannten »inneren« (also innerkatholischen) Mission haben zunächst ans Licht gebracht, wie akribisch sich Akteure des tridentinisch erneuerten Katholizismus mit der Religiosität der ländlichen Bevölkerung in Europa auseinandergesetzt haben. Insbesondere die Jesuiten eigneten sich einen reichhaltigen Wissensbestand über lokalspezifische Glaubensvorstellungen und Frömmigkeitstraditionen an.33 Indem sie von »unseren Indianern« sprachen, deuteten sie an, dass ihnen die Glaubenswelt auf dem Lande teilweise ebenso fremd vorkam wie diejenige nichtchristlicher Religionen, die sie von den Missionen in Übersee kannten.34 Wie in China oder in Nord- und Südamerika versuchten sie bestmöglich auf die lokalen religiösen Eigenheiten Rücksicht zu nehmen, um die reformkatholischen Frömmigkeitsideale der Laienbevölkerung vermitteln zu können. Das von der Missionsforschung neuerdings vielfach besprochene Ergebnis waren hybride und synkretistische Glaubensformen, hervorgegangen aus Strategien der »Aneignung« von und »Anpassung« an lokale religiöse Traditionen.35 Vor diesem Hintergrund schien es angebracht, von einer Vielfalt des Katholischen beziehungsweise vom Christentum als »lokaler Religion«36 auszugehen und die »traditionelle Sicht einer geschlossenen, einheitlichen, von oben gelenkten […] römischen (›papistischen‹) Kirche«37 aufzugeben. Folgerichtig ist die neueste Forschung dazu übergegangen, die frühneuzeitlichen Konfessionskirchen weniger als starre, homogene Blöcke zu beschreiben, sondern vielmehr auf die Heterogenität der Konfessionskulturen38 sowie auf religiöse Grenzüberschreitungen verschiedenster Art39 aufmerksam zu machen.
Den Blick für die Lokalität und Hybridität religiöser Praktiken geschärft haben zweitens auch Studien zu katholischen Kulten, in deren Mittelpunkt charismatische, als heilig erachtete Personen aus dem nahen Umfeld standen. Wie sie zeigen konnten, gab es in der Frühen Neuzeit neben den offiziellen Heiligen- und Seligenverehrungen eine Vielzahl lokalspezifischer Personenkulte.40 Dabei lag meistens ein in der lokalen Gesellschaft verankertes, (spät)mittelalterliches Verständnis von Heiligkeit vor, das im Sinne einer »instrumentellen Heilserwartung«41 die Heiligmäßigkeit einer Person daran maß, inwiefern sie als Vermittler zum Transzendenten aufzutreten fähig war. Das entscheidende Kriterium für die Heiligkeit war nicht so sehr die tugendhafte und »christusnahe«42 Lebensführung, wie es das nachtridentinische Heiligkeitsmodell eigentlich vorsah,43 sondern vielmehr die konkrete Wirkmächtigkeit der Heilsvermittlung, etwa die Fähigkeit, mit jenseitiger Hilfe Krankheiten heilen zu können. Nach dem Tod dieser »lebenden Heiligen« war die Verehrung kaum von den kirchlich approbierten Heiligenkulten zu unterscheiden: Es zirkulierten Reliquien, die Grabstätten wurden zum Pilgerort und zuweilen fanden die entsprechenden Kultpraktiken sogar ihren Platz im kirchlich-liturgischen Rahmen.44 Trotz eines regelrechten Aktionismus unter Papst Urban VIII. (1623–1644), der strenge Richtlinien für die Verehrung heiligmäßiger Personen erließ und die Nuntien ermahnte, Missbräuche dem Heiligen Offizium anzuzeigen,45 duldete die römische Kirche solche lokalen Kulte um »im Ruf der Heiligkeit« (fama sanctitatis) stehende Figuren oft stillschweigend, sodass in der Frühen Neuzeit parallel zu kirchlich sanktionierten immer auch nicht oder nur bedingt kirchengebundene katholische Kultformen existierten.
In seiner praktizierten Form war der katholische Glaube in der Frühen Neuzeit damit stets lokal eingebettet, das heißt er orientierte sich an orts- und gesellschaftsspezifischen Frömmigkeitstraditionen, Bedürfnislagen und (religiösen) Normvorstellungen. Diese lokalen Spielarten katholischer Religiosität haben in der neueren Forschung zu Recht große Aufmerksamkeit gefunden, weil sie aufzuzeigen vermochten, dass die nachtridentinische Glaubenswelt mitnichten ausschließlich das Resultat einer obrigkeitlich initiierten religiösen Disziplinierung war, wie dies vor allem Kirchen- und Konfessionalisierungshistoriker angenommen hatten.46 Allerdings hat der eine oder andere Historiker dabei die lokalen Komponenten in der Glaubenspraxis zulasten universal-katholischer Elemente überzeichnet. Zuweilen wurde vergessen, dass in der vor Ort praktizierten Religiosität auch romgebundene Kulte und Glaubenspraktiken eine zentrale Rolle spielten. Viele frühneuzeitliche Katholiken, wie stark sie sich auch mit dem religiösen Brauchtum ihrer unmittelbaren Lebenswelt identifizieren mochten, betrachteten den Papst (in zunehmendem Maße) als oberste Instanz der kirchlichen Heilsvermittlung; den von ihm gesegneten Sakramentalien schrieben sie eine besonders hohe Heils- und Heilungswirkung zu. Eine Pilgerreise nach Rom war nach wie vor – und vielleicht sogar wie nie zuvor47 – ein anzustrebendes Ziel eines erfüllten religiösen Lebens;48 die Nachfrage nach päpstlichen Ablässen49 und römischen Katakombenheiligen50 war enorm hoch.51 Der katholische Glaube in der Frühen Neuzeit war damit nicht nur lokal eingebettet, sondern zugleich auch translokal verflochten, das heißt er war eingebunden in ein gesamtkatholisches, von Rom ausgehendes System der Heilsvermittlung, ermöglicht durch eine grundlegende »Neujustierung symbolischer Ressourcen am päpstlichen Hof«52, die sich seit dem späten 16. Jahrhundert in einem intensiver werdenden informellen und materiellen Austausch zwischen dem römischen Zentrum und den »lokalen Kirchen«53 bemerkbar machte.
Schon früher als andere Fürstenhöfe bildete die päpstliche Kurie innovative, weitgehend zentralisierte Verfahren zur Durchsetzung von Herrschafts- und Kontrollansprüchen auch über territoriale Grenzen hinweg aus. Sie tat dies, indem sie das Potenzial nutzte, das in der Doppelrolle von weltlicher Herrschaft und spirituellem Primat steckte.54 Das unter Sixtus V. (1585–1590) neugeordnete Kongregationswesen verstärkte den römischen Zugriff auf die lokalen Kirchen (zunächst in Italien), etwa mittels Prüfungsverfahren zur Ernennung von Bischöfen und strikten Dispensregelungen für deren Residenzpflicht.55 Papst Gregor XV. (1621–1623) unterstellte die weltweite Missionstätigkeit – zumindest dem Anspruch nach – der römischen Kontrolle;56 Urban VIII. (1623–1644) etablierte die 1588 gegründete Ritenkongregation als über allen Lokalkirchen stehende Autorität von Heiligsprechungen;57 und das seit 1542 bestehende Heilige Offizium wachte streng über die papsttreue Auslegung der Glaubenslehre, indem es von Rom abhängige lokale Inquisitionstribunale einrichtete58. Mit diesem institutionellen Ausgreifen in die Kirchenprovinzen hinein setzte eine kommunikative Verdichtung zwischen dem römischen Zentrum und den Außenposten der römisch-katholischen Kirche ein, die zwar nur ansatzweise erforscht ist,59 die aber so manche Berührungspunkte mit den zeitgleichen, von Markus Friedrich jüngst untersuchten Zentralisierungstendenzen im Jesuitenorden aufweisen dürfte. Der »lange Arm Roms« zeigte sich demnach in »bürokratischen«60 Verfahren der Informationsbeschaffung und im Anspruch der Ordenskurie, möglichst genau über die Verhältnisse in den Provinzen informiert zu sein. Neben der praktischen Funktion, nämlich der Schaffung einer wissensbasierten Entscheidungsgrundlage, besaß das zentralisierte Sammeln und Verwalten von Information auch eine »symbolische Dimension«61: Gegenüber untergeordneten Hierarchiestufen ließ sich so der römische Suprematieanspruch bekräftigen, etwa indem vorgegeben wurde, über welche Instanzenwege, mit welcher Regelmäßigkeit und in welcher Form sich diese zwingend an die römische Kurie zu wenden hatten.62
Wenngleich also außer Frage steht, dass Rom im Verlauf des 17. Jahrhunderts den Zugriff auf die kirchliche Peripherie mit neugeschaffenen Institutionen intensivierte, sind Zweifel an der Reichweite dieser Zentralisierungsbestrebungen angebracht.63 Wie Christian Windler am Beispiel der Persienmission aufzeigt, waren die Kurienkongregationen nur dann in der Lage, ihren Suprematieanspruch auch wirklich geltend zu machen, wenn sie von den Akteuren in der Peripherie de facto angegangen wurden. Andernfalls waren die Handlungsfreiheiten weitab von Rom beträchtlich, »sogar in Schlüsselfragen der Orthodoxie und Orthopraxie«64. Der »lange Arm Roms«, um bei der Metapher von Markus Friedrich zu bleiben, vermochte sich also nur in die Kirchenprovinzen zu erstrecken, falls ihm die Akteure vor Ort – seien es Bischöfe, Missionare oder Pfarrgemeinden – die Hand dazu reichten.65 Zweckdienlich schien diesen Akteuren die Appellation an die römischen Institutionen vor allem dann, wenn sich damit die eigenen Interessen gegen den Widerstand lokaler Konkurrenten durchsetzen ließen. Analog zu weltlichen Herrschaftsverbänden schmälerte die vom Zentrum ausgehende Herrschaftsintensivierung damit die Handlungsmacht subalterner Akteure und Instanzen keineswegs, sondern eröffnete ihnen gleichsam neue Handlungsspielräume.66 Angesichts dessen ist auch für die kirchlichen Zentrum-Peripherie-Beziehungen von vielschichtigen Verflechtungen zwischen unterschiedlichen Handlungsebenen auszugehen. Während in weltlichen Herrschaftsverbänden solche Verflechtungen über die Distanz vor allem personeller Natur waren,67 kannte die Papstkirche als religiöse Institution weitere Mittel der großräumigen Verflechtung. Weil ihre Wirkweisen bisher kaum bekannt sind, setzt sich die vorliegende Studie zum Ziel, die vielschichtigen Beziehungsstränge zwischen Rom als dem Zentrum der katholischen Christenheit und den lokalen Kultgemeinschaften auszuleuchten. Erkenntnisinteresse und analytisches Instrumentarium einer solchermaßen erweiterten katholischen Verflechtungsgeschichte gilt es nachfolgend zu skizzieren.
1.3. Katholische Verflechtungsgeschichte: Entwurf eines integrativen Erklärungsmodells
Katholische Verflechtungen sollen in der vorliegenden Arbeit jene Beziehungen von einer gewissen Dauer und Verbindlichkeit heißen, die mittels typisch katholischer Ressourcen die verschiedenen lokalen Glieder der römisch-katholischen Kirche zu einem erkennbaren Zusammengehörenden verbanden. Art und Intensität dieser Beziehungen lassen sich zunächst durchaus mit dem von Wolfgang Reinhard für den Kirchenstaat entwickelten Verflechtungsmodell beschreiben.68 Verflechtungen stellten sich demnach ein über personale Bindungen wie Verwandtschaft, Freundschaft, Patronage oder Landsmannschaft und verfestigten sich über materiellen und immateriellen Austausch innerhalb dieser Beziehungsnetze. Nimmt man aber das Papsttum nicht nur als Herrschaftsverband, sondern als weit über Italien hinausreichende religiöse Kultgemeinschaft in den Blick, so muss dieser personale Verflechtungsansatz um zwei wesentliche Aspekte ergänzt werden.69 Erstens muss der Bindungstyp der Patronage auch auf Institutionen ausgedehnt werden, denn auch Kurienkongregationen wie die Propaganda Fide konnten gegenüber untergeordneten Akteuren oder lokalen Kultgemeinschaften als Patron auftreten.70 Zweitens ist zu bedenken, dass die durch Einzelpersonen oder Gruppen hergestellten Verflechtungen auf der symbolischen Ebene auch über die effektive Dauer des anfänglichen Beziehungsverhältnisses hinaus wirksam bleiben konnten:71 Während personale Beziehungskanäle an die Kurie etwa für die Beschaffung von Reliquien aus den römischen Katakomben oder für die vom Papst gewährten Ablässe und Bruderschaftsprivilegien zweifelsohne unabdingbar waren, traten diese personalen Verflechtungen in der kultischen Handlung mit ebendiesen Reliquien und Ablässen in den Hintergrund. Was dabei auf lange Sicht jedoch evident blieb, war der symbolische Aspekt der Rombindung: Gerade die Ablässe machten den Einfluss Roms auch in der entferntesten Provinz deutlich, denn die Gnade des Sündenstrafennachlasses konnte nur der Papst gewähren, entsprechende Ablässe ausstellen nur die von ihm dazu eingesetzten Kirchengremien.72 Diesbezüglich haben wir es also mit spezifisch katholischen Formen der Verflechtung zu tun, die im ekklesiologisch-theologischen Profil der tridentinisch erneuerten Kirche73 begründet lagen: In ihrer heilsvermittelnden Position bestätigt, verfügte die nachtridentinische Kirche über einen reichen Schatz an Gnadenmitteln (Thesaurus ecclesiae), mit dessen Hilfe sie in der Lage war, die verstreuten Kultgemeinschaften in die katholische Gesamtkirche einzubinden. Diese Vorgänge der Verflechtung, die daran beteiligten Akteure sowie die Auswirkungen dieser Verflechtungsprozesse auf die lokalen Kultgemeinschaften werden in der vorliegenden Studie untersucht.
Eine katholische Verflechtungsgeschichte, wie sie mit der vorliegenden Arbeit geschrieben werden soll, kommt dem Versuch gleich, die in der neueren Forschung vor allem in ihren lokalen Zusammenhängen untersuchten »Frömmigkeitskulturen«74, verstanden als Ensemble von Glaubensvorstellungen, Glaubenspraktiken und materieller Kultur, in ein integratives Erklärungsmodell einzupassen. Integrativ soll das Erklärungsmodell aus zwei Gründen heißen:75 Auf der analytischen Ebene sollen erstens kulturgeschichtliche Betrachtungen zur lebensweltlichen Bedingtheit von Religiosität zusammengeführt werden mit bisher an Außen- und Herrschaftsbeziehungen erprobten Beschreibungen von grenzüberschreitenden »Interdependenzgeflechten«76 (Integrativ I). Zweitens wird auf einer inhaltlichen Ebene von einer sich durchaus auch räumlich manifestierenden Integration lokaler Kultgemeinschaften in ein von Rom ausgehendes, gesamtkatholisches System der Heilsvermittlung ausgegangen (Integrativ II). Aus dieser doppelten Fokussierung ergeben sich Konsequenzen für die Anlage der Studie, die es in den nachfolgenden Abschnitten zu erläutern gilt.
Integrativ I
Der Rahmen der Untersuchung ist insofern eng gesteckt, als letztlich die Grundtendenzen des kirchlich-religiösen Lebens und Erlebens in einem geographisch kleinräumigen Gemeinwesen im Alpenraum im Zentrum stehen. Um diese lokale Glaubenswelt besser zu verstehen, genügt es jedoch nicht, nur nach den lokalspezifischen Traditionen und den lebensweltlichen Kontexten zu fragen: Studien insbesondere aus dem Forschungsfeld der neueren Missionsgeschichte haben nämlich gezeigt, dass katholische Glaubensformen in der Frühen Neuzeit stets sowohl von lokalen Kultpraktiken als auch von den innovativen Frömmigkeitsstilen der tridentinisch erneuerten Kirche geprägt waren. Über die lokalen Zutaten dieser Mischformen weiß die historische Forschung recht viel, zumal mehrfach schon rekonstruiert wurde, an welche lokalen religiösen Weltbilder sich Jesuiten, Kapuziner oder andere katholische Reformakteure anpassten.77 Demgegenüber möchte die vorliegende Arbeit stärker auch die universal-katholischen Elemente in den Fokus rücken und fragen, wie diese die lokalen Frömmigkeitskulturen mitformten. Interessieren soll einerseits der Versuch kirchlicher Akteure, die religiöse Kultur im rätischen Alpenraum mittels Symbolressourcen der Papstkirche an das römische Kultverständnis anzugleichen. Andererseits sollen die Handlungsspielräume lokaler Akteure, die analog zu weltlichen auch in kirchlichen Zentrum-Peripherie-Konstellationen bestanden, Beachtung finden. Konkret ist zu fragen, inwiefern es vonseiten der lokalen Kultgemeinschaften nicht auch ganz bewusst zu einer Übernahme von nachtridentinischen Frömmigkeitsstilen kam. Hierfür muss geklärt werden, welchen Mehrwert die kultische wie institutionelle Anbindung an die römische Kirche mit sich bringen konnte: Welchen Nutzen vermochten die Bündner und Veltliner Katholiken aus ihrer Zugehörigkeit zu einer sich als universal verstehenden und von Rom maßgeblich mitbestimmten Kultgemeinschaft zu ziehen? Inwiefern fanden sie darin Mittel und Wege, um ihre Heils- und Heilungsbedürfnisse zu befriedigen, für die es auf engstem Raum auch alternative Angebote aus Medizin, »Volksmagie«78 und nicht zuletzt vonseiten der protestantischen Kirche gab? Was mit solchen Fragen zur Diskussion steht, ist die von verschiedenen – nicht bloß von kirchlichen oder obrigkeitlichen – Akteursgruppen angestrebte Einbindung in eine konfessionell definierte Kirchlichkeit, womit gleichzeitig die Frage aufgeworfen wird, ob Phänomene der kulturell-religiösen Grenzziehung in der Frühen Neuzeit womöglich nicht doch wichtiger und tiefgreifender waren, als dies die neuere Forschung zur »Interkonfessionalität« und »Transkonfessionalität«79 behauptet hat – auch und gerade in einem bikonfessionellen Gemeinwesen wie den Drei Bünden.
Eine solche Fragestellung verlangt einen Untersuchungsgegenstand, mit dem sowohl lokale Praktiken des Sakralen als auch die römisch-katholische Kirche als heilsvermittelnde Institution ins Blickfeld geraten. Möglich wird dies mit den sogenannten »Gnadenorten«, mit jenen Kirchen und Kapellen also, »bei denen Gebetserhörungen dokumentiert sind durch Votiv- und Weihegaben oder Mirakelbilder, -bücher, -protokolle, [und] auch Ablasstermine«80. An Gnadenorten manifestieren sich individuelle Erfahrungen mit dem Sakralen, was noch etwas deutlicher aus den äquivalenten französischen und italienischen Begriffsbildungen »sanctuaire« und »santuario« hervorgeht.81 Ein »Heiligtum«, oder eben ein »santuario«, zeichnet sich demnach aus durch eine außergewöhnliche Qualität des Sakralen82, die bezeugt ist durch Wunder, die dort geschehen oder dokumentiert sind. Ein »santuario« wird von den Menschen aus freien Stücken83 und mit einem ganz bestimmten Ziel aufgesucht,84 meistens »in der Hoffnung, dass sich ein Wunder manifestiert«85, oder aus Dankbarkeit für eine bereits erfahrene Gnade.86 Die Dokumentationen von Gnadenorten geben folglich Aufschluss über die individuellen Beziehungen der Gläubigen zum Transzendenten, über die religiösen Praktiken, mit denen diese Beziehungen eingegangen, aufrechterhalten und aktualisiert wurden, und nicht zuletzt über die Heils- und Heilungsbedürfnisse der Menschen.87 Gleichzeitig werden an Gnadenorten kirchliche Umgangsformen mit dem Sakralen sichtbar. Viele Gnadenorte wurden von Ordensgeistlichen errichtet, betreut und mit Wundern beworben.88 Darüber hinaus waren die größeren unter ihnen mit von Rom gewährten geistlichen Privilegien, allen voran mit Ablässen, ferner mit Reliquien römischer Märtyrer oder mit Zweigstellen römischer Erzbruderschaften ausgestattet.89 Gnadenorte sind daher, wie Alexandra Walsham betont, nicht nur aus heutiger Sicht als Schnittstellen zwischen der vor- und der nachtridentinischen Religiosität zu betrachten, sondern sie wurden bereits von den Vorkämpfern der katholischen Reform dazu benutzt, um die instrumentellen Heilserwartungen älterer Formen von Kirchlichkeit in das reformkatholische Kultangebot zu integrieren.90 Sie eignen sich deshalb besonders gut, um die Eingebundenheit lokaler Glaubenswelten in die römisch-katholische Gesamtkirche zu untersuchen.
Es ist nicht das Ziel dieser Arbeit, eine Geschichte der Gnadenorte im rätischen Alpenraum zu schreiben. Es soll nicht um die historische Entwicklung einzelner Gnadenorte, auch nicht um ihre Stellung innerhalb der lokalen Kirchenorganisation gehen.91 Vielmehr dienen die vielen Gnadenstätten in den Drei Bünden und im Veltlin als Ausgangspunkt für die Untersuchung lokaler, aber trotzdem in weiträumige Bezugssysteme eingebundener Kultpraktiken. Was diese Kultpraktiken anbelangt, so haben die Quellenrecherchen ergeben, dass die Gnadenorte als Orte der Wunderbezeugung zwar von zentraler Bedeutung waren, darüber hinaus sich aber die Gnadenerlebnisse und die mit ihnen verbundenen religiösen Handlungen größtenteils in der alltäglichen Lebenswelt abspielten. In Anbetracht dessen muss das gehäufte Aufkommen und die »ausgesprochen dezentrale Struktur der Gnadenorte«92 im rätischen Alpenraum seit der Zeit um 1600 auch mit Veränderungen in der räumlichen Konzeption von Sakralität93 zu erklären versucht werden.
Integrativ II
Die Blütezeit der Gnaden- und Wallfahrtsorte von ca. 1600 bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert,94 die zugleich den Untersuchungszeitraum dieser Studie absteckt, fiel bezeichnenderweise mit dem »Auftreten neuer Vorstellungen der Beziehungen zwischen Himmel und Erde«95 zusammen. Dieser Wandel im religiösen Weltbild machte sich, so eine der Hauptthesen der vorliegenden Studie, in einer zunehmenden sakralen Durchdringung der Lebenswelt bemerkbar: Im Verlaufe des 17. Jahrhunderts griff die Sphäre des Sakralen96 über die Gotteshäuser hinaus, was individuelle Erfahrungen mit dem Transzendenten auch im Alltag möglich machte. Wir haben es hier mit einer räumlichen Konzeption von Sakralität zu tun, die aus der »Katholischen Reform«97 hervorging und die auf der Vorstellung beruhte, dass sich (überall) innerhalb der katholischen Einflusssphäre ein besonderes Beziehungsfeld zwischen Himmel und Erde aufspannt, in dem Gott erfahr- und erlebbar wird. Räume waren und sind, wie die neuere sozial- und kulturwissenschaftliche Forschung mit Nachdruck betont, keine physischen Tatsachen, sondern sie sind als sozial generiert und praktiziert zu verstehen.98 Vorstellungen und Wahrnehmungen von Raum formieren sich nach zeittypischen Ordnungsvorstellungen und in bestimmten sozialen und kulturellen Kontexten.99 Räume können, müssen sich aber nicht entlang geographischer oder politischer Demarkationslinien entfalten. Folglich ist es naheliegend, dass auch die römische Konfessionskirche mit ihrer theologisch-dogmatischen Weltsicht und ihrer hierarchischen Ordnungsstruktur ein ihr eigenes Raumverständnis aufwies und Räume konstituierte, die sich über alle lokalen Kirchenglieder hinweg erstreckten.100 Wir werden im Verlaufe der Untersuchung sehen, dass die Sakralität, also die sicht- und erlebbare Präsenz des Göttlichen auf Erden, ein konstitutives Element dieser reformkatholischen Raumauffassung war: Nur dort, wo die heilsvermittelnde Kirche präsent war, konnte sich ihr zufolge das Eingreifen Gottes in die Welt manifestieren, sodass von Gott bewirkte Wunder implizit das Gnadenterritorium beziehungsweise den Einflussbereich der Papstkirche absteckten. Es ist daher sinnvoll, sich die in der Zeit nach dem Konzil von Trient angestrebte Einbindung »kirchlicher Peripherien«101 auch als Integration in diese Sphäre des Sakralen vorzustellen. Oder anders formuliert: Es gilt in Betracht zu ziehen, dass die Schaffung einer als sakral wahrgenommenen Lebenswelt, in der von Gott bewirkte Wunder zur religiösen Alltagserfahrung dazugehörten, von römischer Seite bewusst als Strategie der (räumlichen) Einbindung von katholisch-konfessionellen Rand- und Grenzzonen eingesetzt wurde. In diesem Sinne ist die katholische Verflechtung als räumliches Ineinandergreifen und somit als kulturell-religiöses Pendant zur »territorialen Integration«102 frühneuzeitlicher Staatsgebilde zu verstehen.
Räumliche Konstellationen wie die eben bezeichnete sind nicht starr, sondern Dynamiken unterworfen, wie insbesondere Susanne Rau in ihrem methodisch-theoretischen Aufriss einer historischen Raumanalyse betont: Räume verändern sich »unter dem Einfluss von Menschen, die sich diese Räume aneignen, sie gestalten, anders anordnen, gegebenenfalls auch wieder auflösen«, wobei es »bei räumlichen Dynamiken […] immer auch um Fragen der Macht (wer ist an solchen Prozessen beteiligt?) und der Durchsetzung«103 geht. Für die Untersuchung räumlicher Verflechtungsprozesse katholischen Zuschnitts bedeutet dies, dass wir in einem ersten Schritt diejenigen Akteure identifizieren müssen, die die katholische Gesellschaft und Kultur im rätischen Alpenraum mitzubestimmen und mitzuformen in der Lage waren (2. Translokaler Katholizismus):104 Welche Rolle spielten von Rom eingesetzte Institutionen und Akteure? Inwiefern zeigten katholische Fürstenhäuser Interesse an den lokalen religiösen Verhältnissen? Und welche Handlungsmacht besaßen die örtlichen Pfarrgemeinden? Nachdem dies geklärt ist, kann in einem zweiten Schritt nachgezeichnet werden, wie im Zusammenspiel dieser Akteure materielle und symbolische Güter (Gotteshäuser, Reliquien, Gnadenbilder, Ablässe etc.) zu Räumen angeordnet wurden, in denen sich das Eingreifen Gottes in die Welt manifestieren konnte (3. Barocke Gnadenlandschaften). Zu fragen ist dabei zunächst nach der konfessionspolitischen Relevanz dieser räumlichen Aneignungs- und Gestaltungsprozesse: Inwieweit konnte die römisch-katholische Kirche so ihre heilsvermittelnde Macht inszenieren? Und inwiefern ließ sich dadurch das konfessionelle Grenzgebiet stärker in die römisch-katholische Amtskirche einbinden? Daran anschließend sollen in einem dritten und letzten Schritt die Rückwirkungen dieser derart gestalteten Räume auf die Menschen und ihr religiöses Handeln in den Mittelpunkt rücken (4. Ökonomien des [Un]Heils): Welchen Nutzen zogen die Gläubigen aus der Einbindung in die als sakral erscheinende römisch-katholischen Einflusssphäre? Wie eigneten sie sich diese sakralen Lebensräume an und inwiefern waren sie dadurch in der Lage, die barocke Gnadenlandschaft mitzugestalten? Im Verbund werden diese drei analytischen Perspektiven zu einem Gesamtbild der katholischen Gesellschaft im rätischen Alpenraum führen, das die Kirche als heilsvermittelnde Institution ebenso wie die praktizierte Laienreligiosität, nebst kirchenpolitischen Entwicklungen auch die Frömmigkeitskultur und schließlich sowohl die lokalen Kultgemeinschaften als auch externe Einflusssphären berücksichtigt.